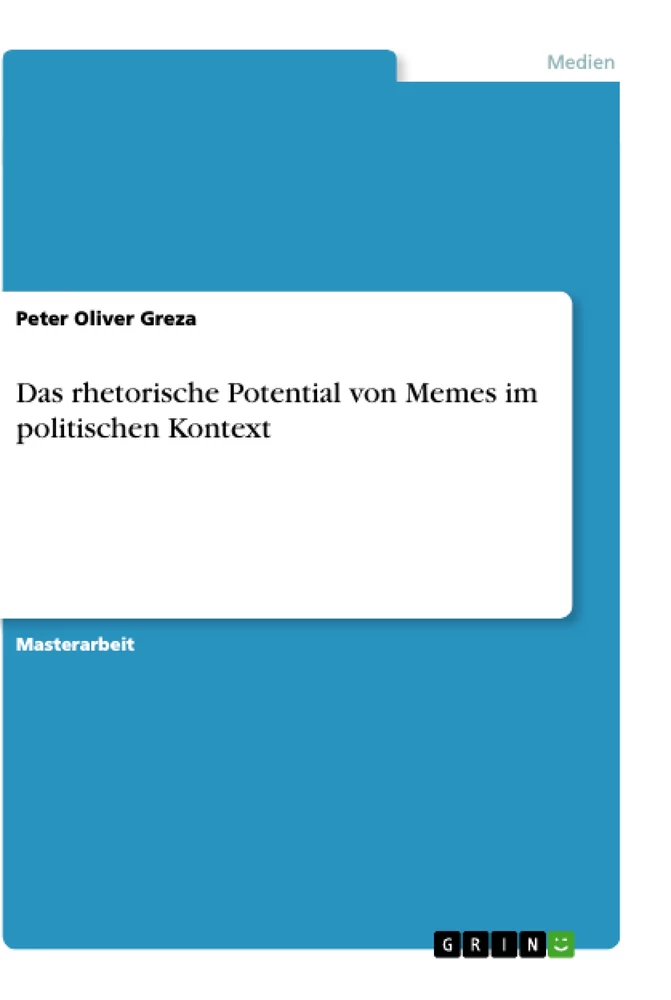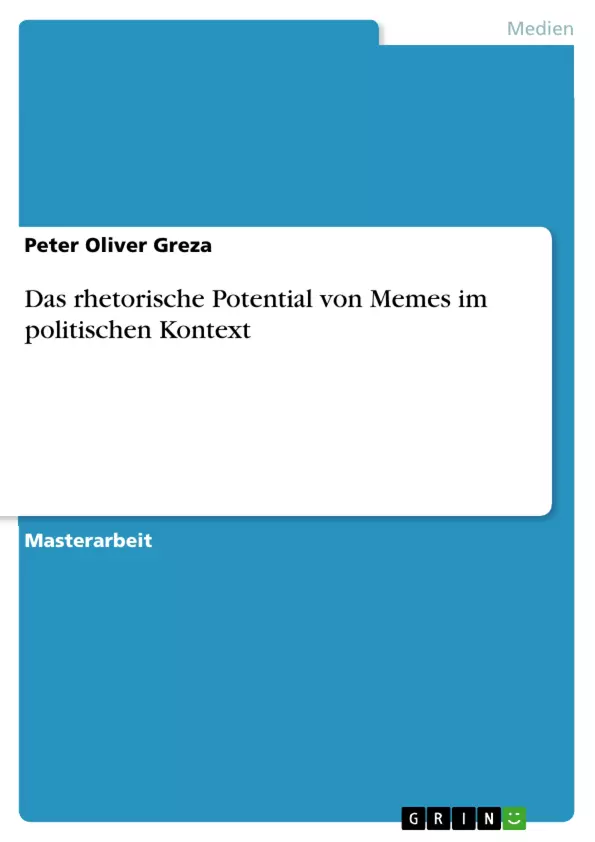Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist der Versuch einer erstmaligen rhetorischen Einordnung des Phänomens der Memes.
Diese Arbeit verortet sich dabei in der Tübinger Rhetoriktradition, versteht unter Rhetorik also die strategische Kommunikation eines handlungsmächtigen Orators. Es soll anhand eines qualitativen Korpus verschiedener Memes, die während des amerikanischen Wahlkampfs 2016 gepostet wurden, untersucht werden, ob Memes prinzipiell dazu geeignet sind, rhetorisches Potential zu entfalten. Falls diese Frage bejaht werden kann, soll weiterhin untersucht werden, worin sich dieses rhetorische Potential zeigen kann. Um in diesen Fragen zu einem aussagekräftigen Ergebnis zu kommen, werden aufgrund des beschränkten Umfangs der Arbeit mehrere rhetorisch relevante Kategorien untersucht, anstatt nur einige wenige Themenbereiche zu vertiefen. Letzteres wäre sodann Aufgabe möglicher Folgeuntersuchungen.
Welchen kommunikativen Mehrwert sehen Menschen in der Verwendung eines Memes? Welche kommunikativen Funktionen kann so ein Meme erfüllen? Dass diese Fragestellungen durchaus relevant sind und immer wichtiger werden, zeigt sich nicht nur daran, dass Memes seit einigen Jahren immer häufiger von InternetnutzerInnen zur alltäglichen und auch politischen Kommunikation herangezogen werden, sondern auch darin, dass die Forschung sich verstärkt mit diesem Phänomen beschäftigt.
Dabei wird dieses Phänomen von vielen verschiedenen Seiten betrachtet, wobei eine eingehende rhetorische Untersuchung bisher noch fehlt. Dass Memes auch für die Rhetorik, also die Untersuchung strategischer Kommunikation, einiges an Relevanz besitzen, zeigt sich darin, dass Memes nicht nur in der Alltagskommunikation, sondern auch in der politischen Kommunikation, unter anderem auch von offiziellen Parteien im Wahlkampf, verwendet werden und das in immer größerem Umfang. Also in Kommunikationssituationen, in denen Menschen von anderen Standpunkten überzeugt werden sollen, per definitionem dem Kerngebiet der Rhetorik. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit der Blick auch spezifisch auf Memes im politischen Kontext gerichtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Meme
- Begriffsgeschichte
- Memes im Internet
- Unterschiedliche Meme-Formen
- Definitionen Meme
- Meme-Genese
- Methode und Fragestellung
- Das Korpus
- Das Meme als Kommunikationsform
- Das Meme in der strategischen Kommunikation
- Der Meme-Orator
- Das Meme in Hinblick auf kommunikative Widerstände
- Das persuasive Potential von Memes anhand der Orientierungsaspekte
- Das Meme als Mittel zur Erzeugung von Systase
- Memes als Mittel zur Erregung, Erhaltung und Lenkung von Aufmerksamkeit
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit unternimmt den Versuch einer erstmaligen rhetorischen Einordnung des Phänomens der Memes, basierend auf der Tübinger Rhetoriktradition. Es wird untersucht, ob Memes im politischen Kontext rhetorisches Potential entfalten und wie sich dieses zeigt. Die Analyse konzentriert sich auf Memes aus dem amerikanischen Wahlkampf 2016. Aufgrund des beschränkten Umfangs werden mehrere rhetorisch relevante Kategorien untersucht, anstatt wenige vertieft.
- Genese und Definition des Memes
- Das Meme als Kommunikationsform in der Alltagskommunikation
- Das Meme in der strategischen politischen Kommunikation
- Persuasive Potentiale von Memes
- Memes und die Erzeugung von Aufmerksamkeit und Konsens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie anhand eines Beispiels aus dem US-Wahlkampf 2016 die Relevanz von Memes in der politischen Kommunikation verdeutlicht. Sie betont die Notwendigkeit einer rhetorischen Untersuchung von Memes und formuliert die Forschungsfrage nach dem rhetorischen Potential von Memes und dessen Manifestation. Die Arbeit verortet sich in der Tübinger Rhetoriktradition und kündigt die Methodik an, die auf einer qualitativen Analyse eines Korpus von Memes basiert.
Das Meme: Dieses Kapitel befasst sich mit der Begriffsgeschichte und den grundlegenden Konzepten des Memes, unterscheidet zwischen „Mem“ (im Sinne von Dawkins) und „Meme“ (als Internetphänomen) und etabliert eine Arbeitsdefinition. Es beleuchtet die Ambivalenz des Begriffs und die Schwierigkeiten seiner Abgrenzung, untersucht verschiedene Meme-Formen und liefert eine fundierte Basis für die spätere Analyse. Es wird der Forschungsstand zum Meme vorgestellt und eine klare begriffliche Trennung zwischen den verschiedenen Bedeutungen des Terminus vorgenommen.
Methode und Fragestellung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit, die Themeneingrenzung und die Forschungsfragen. Es wird die qualitative Forschungsmethode erläutert und das Korpus der untersuchten Memes vorgestellt. Der Fokus liegt hier auf der klaren Definition der methodischen Vorgehensweise und der Begrenzung des Untersuchungsumfangs.
Das Meme als Kommunikationsform: Dieses Kapitel analysiert das Meme als Kommunikationsform in der Alltagskommunikation. Es untersucht die formalen Eigenschaften von Image-Macros, die Bedeutungskonstitution in Abhängigkeit von Vorwissen und Kontext, und bildrhetorische Aspekte. Die Analyse konzentriert sich auf die spezifischen Kommunikationsmerkmale des Memes und seinen Kontextbezug.
Das Meme in der strategischen Kommunikation: In diesem Kapitel wird das Meme unter dem Aspekt der strategischen Kommunikation analysiert. Es wird der "Meme-Orator" als strategisch agierender Kommunikator eingeführt und die Überwindung von kommunikativen Widerständen (kognitiv, sprachlich, textuell, medial/situativ) untersucht. Der Fokus liegt auf der persuasiven Wirkung von Memes anhand verschiedener Orientierungsaspekte (instruktiv, verifikativ, axiomatisch, evaluativ, emotiv, direkt-stimulativ, voluntativ) sowie der Fähigkeit, Systase und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Analyse konzentriert sich auf die strategischen Möglichkeiten der Verwendung von Memes in der politischen Kommunikation.
Schlüsselwörter
Meme, Internet-Meme, Rhetorik, Politische Kommunikation, Strategische Kommunikation, Persuasion, Bildrhetorik, Kommunikative Widerstände, Wahlkampf, Viralität, Meme-Genese, Orientierungsaspekte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Das Meme in der strategischen politischen Kommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das rhetorische Potential von Internet-Memes im politischen Kontext, speziell im amerikanischen Wahlkampf 2016. Sie fragt, ob und wie Memes rhetorisch wirken und ordnet das Phänomen der Memes in die Tübinger Rhetoriktradition ein.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Genese und Definition von Memes, Memes als Kommunikationsform im Alltag und in der strategischen politischen Kommunikation, persuasive Potentiale von Memes und deren Fähigkeit, Aufmerksamkeit und Konsens zu erzeugen. Es werden verschiedene Meme-Formen analysiert und bildrhetorische Aspekte beleuchtet.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer qualitativen Analyse eines Korpus von Memes aus dem amerikanischen Wahlkampf 2016. Die methodische Vorgehensweise und die Eingrenzung des Untersuchungsumfangs werden detailliert beschrieben.
Welche Aspekte der Kommunikation werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die Überwindung kommunikativer Widerstände (kognitiv, sprachlich, textuell, medial/situativ) durch Memes. Die persuasive Wirkung wird anhand verschiedener Orientierungsaspekte (instruktiv, verifikativ, axiomatisch, evaluativ, emotiv, direkt-stimulativ, voluntativ) untersucht. Die Fähigkeit von Memes, Systase und Aufmerksamkeit zu erzeugen, wird ebenfalls analysiert.
Wie wird der Begriff "Meme" definiert?
Die Arbeit unterscheidet zwischen dem biologischen Begriff "Mem" (Dawkins) und dem Internetphänomen "Meme". Sie etabliert eine Arbeitsdefinition und beleuchtet die Ambivalenz des Begriffs sowie die Schwierigkeiten seiner Abgrenzung. Es wird eine klare begriffliche Trennung zwischen den verschiedenen Bedeutungen vorgenommen.
Welche Rolle spielt der "Meme-Orator"?
Der "Meme-Orator" wird als strategisch agierender Kommunikator eingeführt, der Memes gezielt in der politischen Kommunikation einsetzt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Meme, Internet-Meme, Rhetorik, Politische Kommunikation, Strategische Kommunikation, Persuasion, Bildrhetorik, Kommunikative Widerstände, Wahlkampf, Viralität, Meme-Genese, Orientierungsaspekte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Thema "Das Meme", ein Kapitel zu Methode und Fragestellung, ein Kapitel zum Meme als Kommunikationsform, ein Kapitel zum Meme in der strategischen Kommunikation und ein Fazit mit Ausblick.
Wo liegt der Fokus der Analyse?
Der Fokus liegt auf der Untersuchung des rhetorischen Potentials von Memes in der politischen Kommunikation und der Manifestation dieses Potentials. Die Arbeit untersucht mehrere rhetorisch relevante Kategorien, anstatt wenige vertieft zu behandeln.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler*innen und Studierende im Bereich der Kommunikationswissenschaft, Rhetorik, Politikwissenschaft und Medienwissenschaften, die sich mit dem Phänomen der Internet-Memes und deren Rolle in der politischen Kommunikation auseinandersetzen.
- Quote paper
- Peter Oliver Greza (Author), 2020, Das rhetorische Potential von Memes im politischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1025662