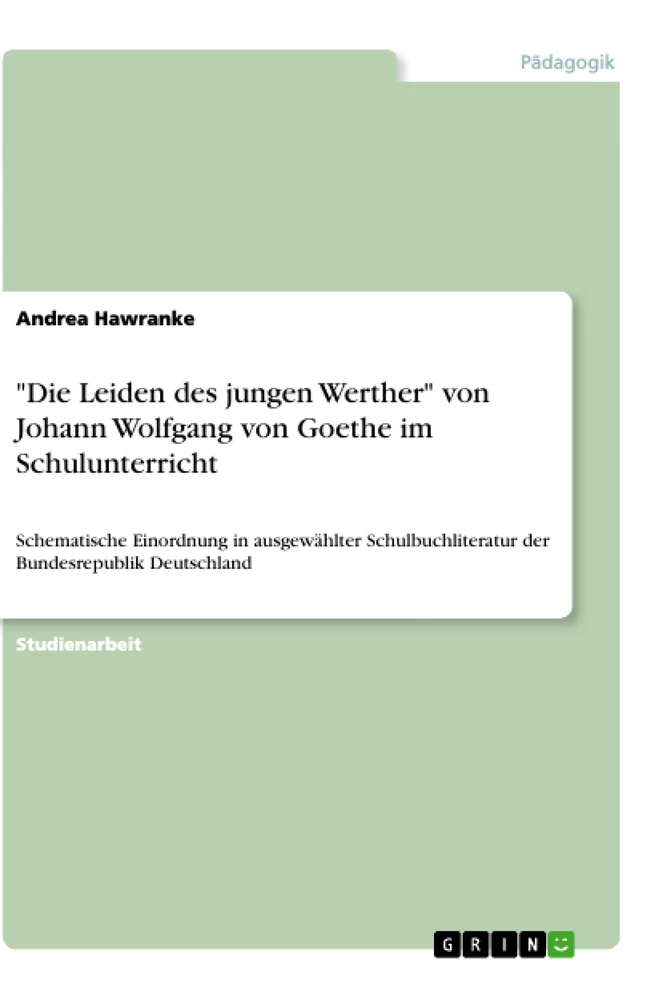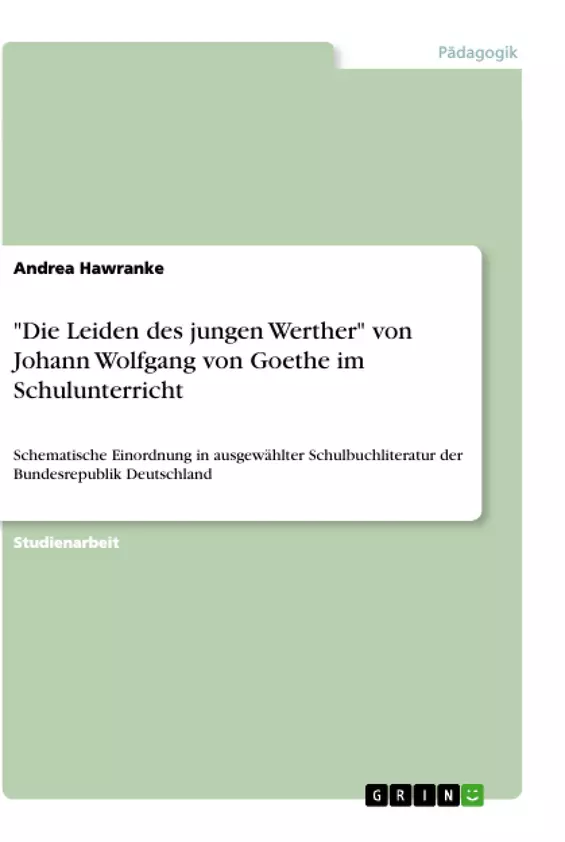Wie nehmen junge Menschen in der Schule „Die Leiden des jungen Werther“ von Goethe wahr? Und wie können Lehrkräfte eine Unterrichtseinheit gestalten, in der die Motivation für das Werk von Beginn an vorhanden ist und die Lust an den verschiedenen Themen nicht vermindert wird?
In der Bundesrepublik Deutschland stehen für den Deutsch- oder Literaturunterricht klassische Lektüren, wie zum Beispiel der Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“ von Johann Wolfgang von Goethe, auf den Lehrplänen der Schulen. Dabei werden meist literaturhistorische, kulturelle und sozialgeschichtliche Aspekte untersucht, um den Horizont der Schülerinnen und Schüler dahingehend zu erweitern und sie für die klassische Poesie zu sensibilisieren. Dabei wird sich häufig auf der syntaktischen und semantischen Ebene bewegt, indem die Lehrerinnen und Lehrer unter anderem auf sprachliche Veränderungen eingehen. Dieser Aspekt ist dahingehend bedeutsam, dass die Poetizität und Historizität bei den SuS steigen, je älter die Texte sind. Insofern ist es wichtig, wie die Lehrkräfte im Unterricht mit dem Thema umgehen. Sie müssen einen Zugang zu der Literatur herstellen, auch wenn es zu Beginn in der Klasse gewisse Sprachbarrieren gibt, die zu einer Unlust und Langeweile führen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Goethes ,,Werther" im Schulunterricht
- Präsenz des ,,Werther" in Schulbüchern des Deutschunterrichts
- Klassenstufe und Schulform
- Brief- und Themenauswahl
- Methodische Hinweise für die Umsetzung im Unterricht
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die spezifische Art der Rezeption von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ in der jungen Bevölkerung, insbesondere in der Schülerschaft. Dabei werden verschiedene Schulbücher aus der Bundesrepublik Deutschland analysiert, um zu erforschen, wie der Roman in der Vergangenheit vermittelt wurde und welche Briefe, Texte und intertextuelle Verweise zum Einsatz kamen. Das Ziel ist es, die Schwerpunkte im Unterricht zu identifizieren und die Unterschiede in der Vermittlung des Werks durch verschiedene Verlage, Klassenstufen und Schulformen zu beleuchten.
- Die Wahrnehmung von „Die Leiden des jungen Werther“ durch junge Menschen im Schulunterricht
- Die Gestaltung einer Unterrichtseinheit, die die Motivation und die Lust an den Themen des Romans von Beginn an fördert
- Die Analyse der Häufigkeit und des Zeitpunkts, zu dem der „Werther“ in Schulbüchern behandelt wird
- Der Vergleich des „Werthers“ mit anderen Werken Goethes, die in Schulbüchern abgedruckt wurden
- Die Identifizierung wiederkehrender und differierender Akzente in der Vermittlung des Romans
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz von klassischen Lektüren wie Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ im Deutschunterricht und die Herausforderungen, die sich aus dem veränderten Leseverhalten der Schüler ergeben. Kapitel 2 befasst sich mit der Präsenz des Werthers in Schulbüchern, der Auswahl der Briefe und Themen sowie den methodischen Hinweisen für die Umsetzung im Unterricht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Fokusgebiete der Arbeit sind Goethes „Die Leiden des jungen Werther“, Rezeption, Schulunterricht, Deutschunterricht, Schulbuchliteratur, Briefroman, Sturm und Drang, Empfindsamkeit, Literaturgeschichte, Didaktik, Pädagogik, Motivation, Unterrichtsgestaltung.
- Arbeit zitieren
- Andrea Hawranke (Autor:in), 2021, "Die Leiden des jungen Werther" von Johann Wolfgang von Goethe im Schulunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1025945