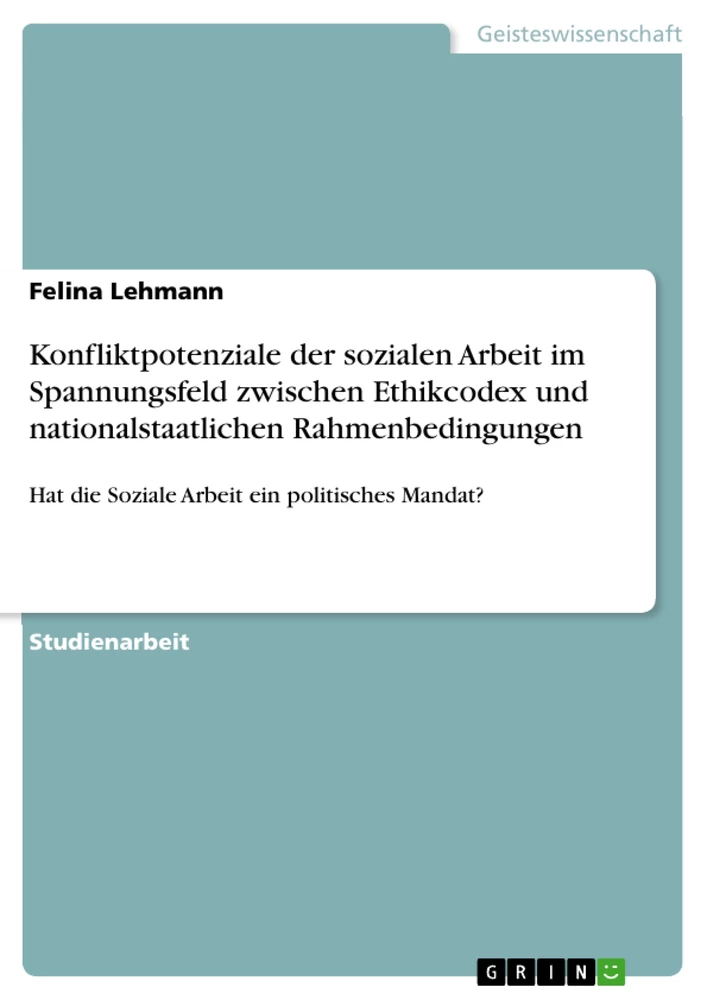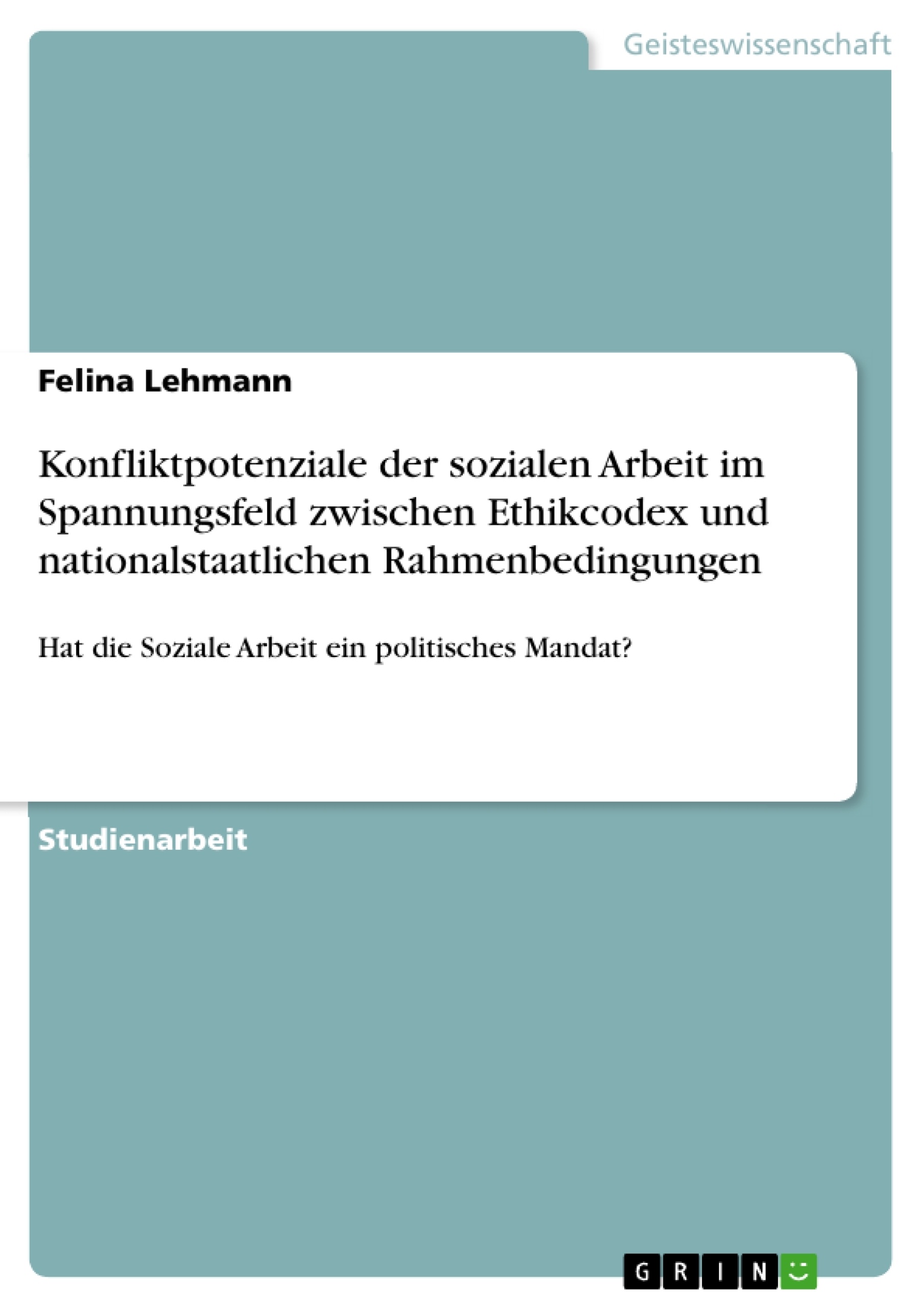Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Frage nach der Positionierung der Sozialen Arbeit mit dem Fokus auf die Verstrickung in Machtstrukturen. Dabei sollen vor allem grundlegende Spannungsfelder in den Blick genommen werden, in denen sich Soziale Arbeit im Zusammenhang mit ihrer wohlfahrtsstaatlichen Anbindung befindet. Nimmt man die normativen Selbstzuschreibungen der Sozialen Arbeit in den Blick, die auch mit der Bemühung um ein professionelles Selbstverständnis einhergehen, zeichnet sich eine Diskrepanz zwischen dem professionellen Selbstkonzept und ihrer Rolle im oft eher eingeschränkten Umgang mit Geflüchteten ab.
Die Arbeit geht der Frage nach, inwieweit die Soziale Arbeit ein politisches Mandat, ein politisches Selbstverständnis hat. Die Handlungstheorie nach Silvia Staub-Bernasconi und die systemischen Überlegungen nach Albert Scherr in dem Zusammenhang mit Geflüchteten werden im Zuge dieser Arbeit herangezogen und unter ausgewählten Aspekten vergleichend erörtert, um der Frage nach dem politischen Selbstverständnis der Sozialen Arbeit nachzugehen. Zunächst soll jedoch noch einmal umfassender verdeutlicht werden, wie die Soziale Arbeit im Verhältnis zu Politik zu verorten ist, und was in dieser Ausarbeitung unter einem politischen Mandat zu verstehen ist. Daran anschließend werden die Theorien von Bernasconi und Scherr unter den Aspekten der Menschenrechte, die Funktionen der Sozialen Arbeit und dem eigenen Selbstverständnis erörtert. Im Fazit sollen die beiden Positionen der theoretischen Überlegungen zum politischen Selbstverständnis zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Ziel der Arbeit
- Das Verhältnis Sozialer Arbeit zur Politik: Auftrag und Abhängigkeit
- Vergleich und kritische Beleuchtung der Theorien von Silvia Staub-Bernasconi und Albert Scherr in Bezug auf die Soziale Arbeit mit Geflüchteten
- Menschenrechte: Die Berufsethik der Sozialen Arbeit in der Krise?
- Funktion der Sozialen Arbeit (im Kontext staatlicher Regulierung von Geflüchteten)
- Zum professionellen und damit auch politischen Selbstverständnis Sozialer Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage nach dem politischen Mandat der Sozialen Arbeit im Kontext ihrer Arbeit mit Geflüchteten. Sie analysiert die Spannungsfelder, die sich aus dem Verhältnis von professionellem Selbstverständnis, staatlichen Rahmenbedingungen und humanitären Prinzipien ergeben. Im Zentrum steht dabei die Frage, inwieweit die Soziale Arbeit ein politisches Selbstverständnis und ein politisches Mandat hat.
- Die Positionierung der Sozialen Arbeit im Spannungsfeld zwischen Ethikcodex und nationalstaatlichen Rahmenbedingungen
- Die Diskrepanz zwischen dem professionellen Selbstverständnis der Sozialen Arbeit und ihrer Rolle im Umgang mit Geflüchteten
- Das Verhältnis von Menschenrechten und dem professionellen Ethos der Sozialen Arbeit im Kontext der Arbeit mit Geflüchteten
- Die Funktionen der Sozialen Arbeit im Kontext der staatlichen Regulierung von Geflüchteten
- Die Bedeutung des politischen Selbstverständnisses der Sozialen Arbeit im Umgang mit Geflüchteten
Zusammenfassung der Kapitel
Hinführung
Das Kapitel führt in die Thematik der Sozialen Arbeit mit Geflüchteten ein. Es beleuchtet die prekäre Situation von Geflüchteten in Deutschland und weltweit und stellt die Frage nach der Verantwortung und den Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit.
Das Verhältnis Sozialer Arbeit zur Politik: Auftrag und Abhängigkeit
Dieses Kapitel analysiert das Spannungsverhältnis zwischen dem doppelten Mandat der Sozialen Arbeit und beleuchtet die Herausforderungen, die sich im Kontext der Arbeit mit Geflüchteten ergeben. Die Arbeit im Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle und die Abhängigkeit von politischen Rahmenbedingungen werden diskutiert.
Vergleich und kritische Beleuchtung der Theorien von Silvia Staub-Bernasconi und Albert Scherr in Bezug auf die Soziale Arbeit mit Geflüchteten
Das Kapitel befasst sich mit den theoretischen Überlegungen von Staub-Bernasconi und Scherr im Hinblick auf die Soziale Arbeit mit Geflüchteten. Die beiden Theorien werden hinsichtlich ihrer Positionierung im Spannungsfeld von Machtgefügen, sozialer Gerechtigkeit und Inklusion/Exklusion analysiert und kontrastiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bereiche Soziale Arbeit, Geflüchtete, politisches Mandat, professionelles Selbstverständnis, Menschenrechte, Sozialpolitik, Inklusion und Exklusion, Handlungstheorien, Staub-Bernasconi, Scherr, Flüchtlingspolitik, staatliche Regulierung, Ethikcodex, nationalstaatliche Rahmenbedingungen.
- Arbeit zitieren
- Felina Lehmann (Autor:in), 2021, Konfliktpotenziale der sozialen Arbeit im Spannungsfeld zwischen Ethikcodex und nationalstaatlichen Rahmenbedingungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1026146