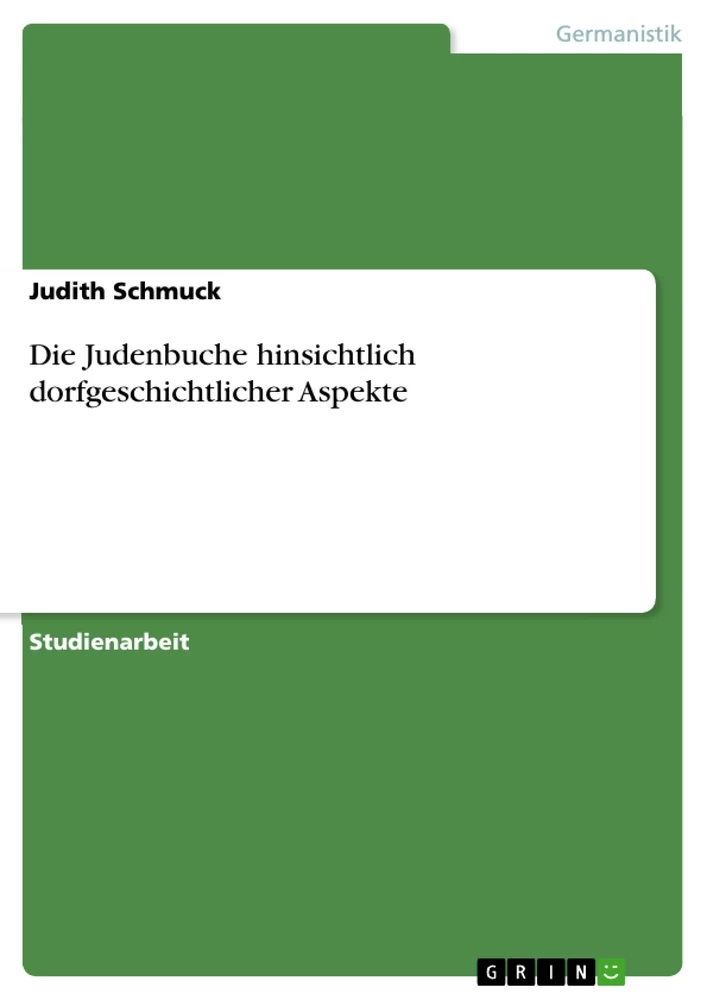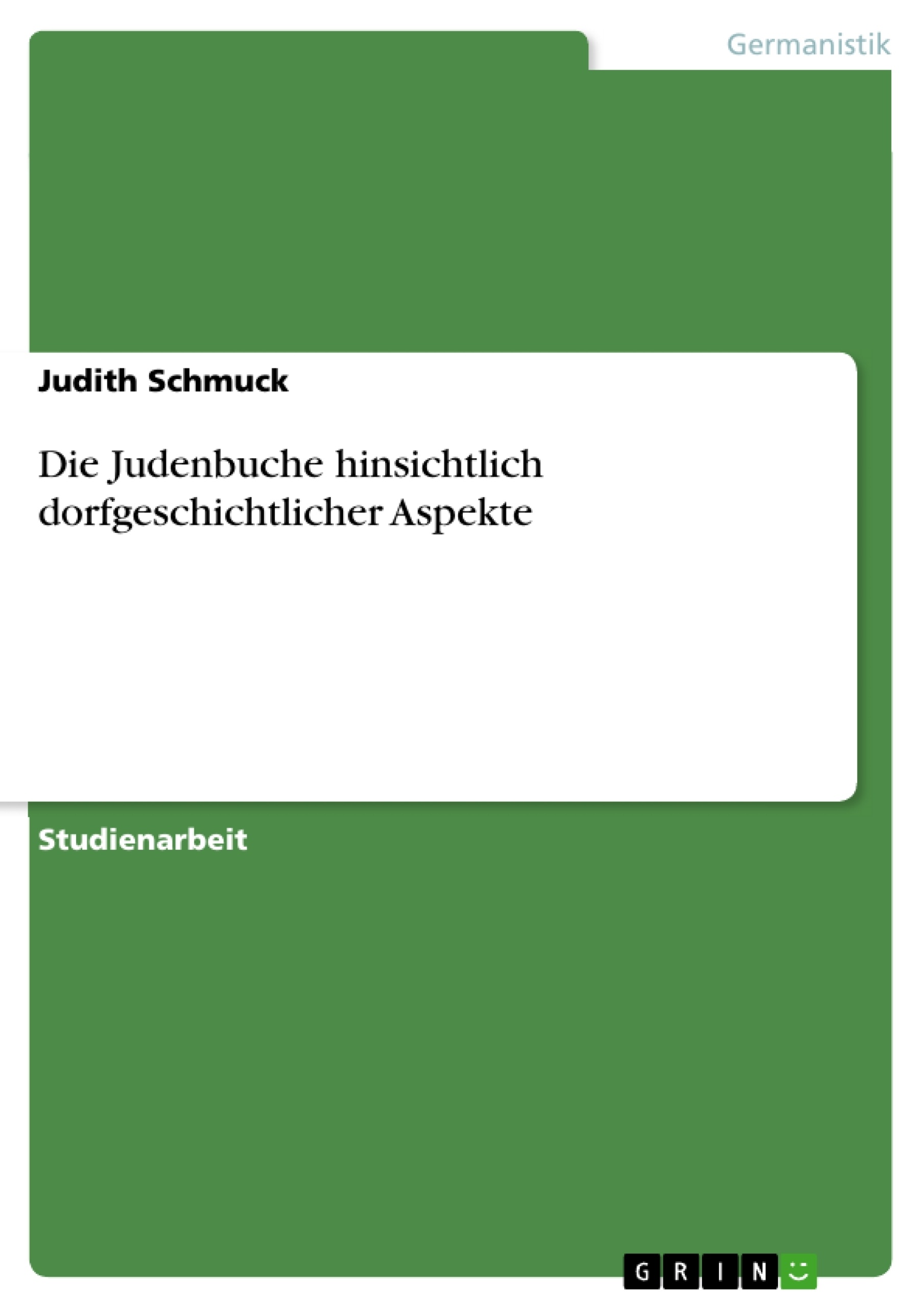Inmitten der düsteren Wälder Westfalens, wo Recht und Unrecht in einem komplizierten Tanz verschmelzen, entfaltet sich eine erschütternde Geschichte von Schuld, Sühne und der unerbittlichen Macht des Schicksals. Anna Elisabeth, Freiin Droste zu Hülshoff, besser bekannt als Annette von Droste-Hülshoff, zeichnet in diesem Sittengemälde des 19. Jahrhunderts das Leben von Friedrich Mergel nach, einem Mann, der von seiner Herkunft und den finsteren Machenschaften seiner Umgebung gezeichnet ist. Aufgewachsen in einem Dorf, in dem Holzdiebstahl und Wilderei an der Tagesordnung sind, gerät Friedrich immer tiefer in einen Strudel aus Gewalt und Verbrechen. Als der Jude Aaron eines Nachts sein geliehenes Geld zurückfordert, eskaliert die Situation und Friedrich flieht, des Mordes verdächtigt. Jahre später kehrt ein gebrochener Mann zurück, doch die Vergangenheit lässt ihn nicht los. Die Dorfgemeinschaft, tief verwurzelt in Traditionen und Hierarchien, wird Zeuge eines tragischen Schicksals, das an der symbolträchtigen Judenbuche seinen grausamen Höhepunkt findet. Droste-Hülshoff seziert meisterhaft die sozio-moralischen Verhältnisse ihrer Zeit, indem sie die Rolle der Religion, die Bedeutung von Ehre und Scham sowie die ewige Suche nach Gerechtigkeit beleuchtet. Die Novelle, basierend auf einer wahren Begebenheit, ist mehr als nur eine Kriminalgeschichte; sie ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur, der Macht des Schicksals und der Frage, ob Schuld jemals wirklich gesühnt werden kann. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen und die Wahrheit oft im Dunkeln verborgen liegt. Erleben Sie die beklemmende Atmosphäre des westfälischen Dorfes und begleiten Sie Friedrich Mergel auf seinem Weg in die Verdammnis. Die Judenbuche ist ein literarisches Meisterwerk, das den Leser noch lange nach der letzten Seite beschäftigt und zum Nachdenken über die dunklen Abgründe der menschlichen Seele anregt. Eine Geschichte über Verbrechen, Strafe, die Last der Vergangenheit und die unerbittliche Gerechtigkeit der Natur, die in den abgelegenen Winkeln Westfalens spielt und die Leser in ihren Bann zieht. Die subtile Psychologie der Charaktere und die atmosphärische Dichte machen diese Novelle zu einem zeitlosen Klassiker der deutschen Literatur, der bis heute nichts von seiner Relevanz und Aussagekraft verloren hat. Entdecken Sie die verborgenen Schichten dieser komplexen Erzählung und lassen Sie sich von der literarischen Brillanz der Annette von Droste-Hülshoff verzaubern.
Leben und Werk der Droste
Am 12.01.1797 erblickt eine gewisse Anna Elisabeth, Freiin Droste zu Hülshoff auf Schloss Hülshoff bei Münster in Westfalen das Licht der Welt. Von großer Bedeutung ist zunächst ihre Herkunft, ihre Einbindung in Familie, Stand und Landschaft. Ihre Eltern, Clemens August und Therese Luise stammen aus altem westfälischem Adelsgeschlecht. Ihre Mutter nimmt gegenüber dem Vater, der sehr für Musik und Nautwissenschaften schwärmt, die dominierende Rolle ein. Sie ist ein nüchtern- pragmatischer Typ, dem sich Annette auch meist willig unterwirft. Zu Eltern, Schwester und Bruder - sie werden alle eingehend und liebevoll porträtiert in der Gutsherrenfamilie des Werkes" Bei uns zu Lande" - tritt eine ausgedehnte Verwandtschaft, die den Lebenskreis der Droste bis in ihr Alter weitgehend absteckt und auch am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Sie schafft es dennoch, sich innerhalb dieses durch gesellschaftliche Konventionen beschränkten Familienkomplexes einen Freiraum für ihr literarisches Schaffen einzurichten. Dieser blieb allerdings stets bescheiden und war auch bis zum Ende immer bedroht. Vielleicht beklagt man aus diesem Grund manchmal die Schmalheit ihres Werks, das aber eben aus diesem Eingebunden-Sein, in einen nach außen hin abgeschlossenen Adelsclans, eruiert.
Einer weiteren biographischen Prägung ist zu gedenken: der durch ihre enge Heimat, durch Westfalen, durch das Münsterland. Sie wendet sich ihrer Heimat vielfach auch literarisch zu ( Heidebilder; Bilder aus Westfalen; Bei uns zu Lande...) In vielen ihrer lyrischen sowie ihrer epischen Dichtungen ist ihr Heimatland der Grundstein für Droste-Hülshoffs Eigenart. Das eigentliche Zentrum des literarischen Werkes der Droste bildet allerdings tiefe Religiosität, Angst um Strafe und Hoffnung, unterschiedliche Zeichen von Schuld und Vergeltung. Weiters tragen natürlich ihr betrachtungswürdiger Charakter zu Art ihrer Literatur bei. Gezeichnet von Krankheiten wie Tuberkulose und Schilddrüsen-Erkrankungen, nähern sich der jungen Droste immer wieder Todesgedanken, die sich wiederum als dunkler Grundton durch ihre Werke ziehen. Annette von Droste-Hülshoff ist sehr sensibel und stets in Sorge und Angst um die Menschen, die ihr nahestehen. Dieser Angst kommt auch in ihrer Religiosität eine bedeutdende Srolle zu: Sie stellt sich oft die durch die Religion für sie nicht geklärte Sinnfrage.
Einschneidend ist ebenfalls und wahrscheinlich in höchstem Maße die sogenannte Jugendkatastrophe. Die junge Droste stand zwischen zwei Verehrern, blieb eine Zeit lang unentschlossen und verlor beide. In ihren Augen trägt sie die Schuld für familiäre Konflikte, die dieses Ereignis mit sich brachte, was ihren Hang zur häufig auftauchenden Schuldfrage in ihren Werken erklären lässt. Verglichen mit dieser tiefgehenden Krise und ihren Folgewirkungen verlieren alle anderen Fakten der Drosteschen Biographie an Gewicht. Annettte von Droste-Hülshoff stirbt am 24.5.1848 an den Folgen ihrer Krankheiten.
Entstehung der Novelle - Quellen
Die Judenbuche" wurde als einzige von vier größeren Prosaarbeiten vollendet und verhalf Annette von Droste-Hülshoff nicht nur zu Lebzeiten zum literarischen Durchbruch. Auch heute noch ist das Werk in der literaturwissenschaftlichen Diskussion.
Besonders interessant daran ist die wahre Begebenheit, auf der die Handlung aufbaut. Den Kern bildet nämlich eine von vielen hundert Menschen bezeugte historische Begebenheit im Gutsbezirk des Werner Adolf von Haxthausen, des Großvaters der Dichterin. Im Jahre 1783 im Februar erschlug Hermann Georg Winkelhagen den Schutzjuden Soestmann-Behrens, genannt Pinnes, wegen eines zurückgeforderten Geldbetrages. Der Tatort lag nach dem Zeugnis eines Verwandten des Opfers im Bollkasten-Wald nordöstlich von Bellersen. Der Mörder Winkelhagen geriet nach seiner Flucht in algerische Gefangenschaft und konnte sich erst 1805 aus der Sklaverei befreien. Ein Jahr später kehrte er in seine Heimat zurück und begang im Bollkasten-Wald Selbstmord durch Erhängen.
Diese Geschichte diente Droste-Hülshoff als Modell für ihre "Judenbuche". Sie hatte Auszüge aus den Akten des damaligen Falles zu lesen bekommen, die ihr Onkel in der Zeitschrift "Die Wünschelrute" vom 5. Bis 9. Februar 1818 unter dem Titel "Geschichte eines Algierer Sklaven" veröffentlichen ließ, und baute rund um die historischen Tatberichte eine Geschichte auf. Allerdings übernimmt die Autorin keine Charakterzüge der Personen, die sich, so gut wie eben möglich, aus den Überlieferungen abzeichnen. Während ihrer Arbeit am Manuskript schreibt Annette von Droste- Hülshoff 1839:
" Ich habe jetzt wieder den Auszug aus den Akten gelesen, den Mein Onkel August schon vor vielen Jahren in ein Journal rücken ließ und dessen ich mich nur den Hauptumständen nach erinnerte. Es ist schade, dass ich nicht früher drüber kam; es enthält eine Menge höchst merkwürdiger Umstände und Äußerungen, die ich jetzt nur zum Teil benutzen kann, wenn ich die Geschichte nicht ganz von neuem schreiben will. Vor allem ist der Charakter des Mörders ein ganz anderer , aber mich nötigt, mitunter das Frappanteste zu übergehen, weil es durchaus nicht zu meinem Mergel passen will. [...]; so fürchte ich die Vergleichung nicht, die sonst jedenfallst zu meinem Nachteil ausfallen würde ,denn einfache Wahrheit ist immer schöner als die bester Erfindung."
Sie entfernt sich offensichtlich von der Vorlage, was besonders deutlich wird mit der Aussage über ihren Mergel, der sich nicht mit dem historischen Mörder deckt. Sie behauptet auch, dass die Geschichte, so wie sie ihr Onkel verfasste, die bessere sei, allein aus dem einen Grund, da sie der Wahrheit entspräche. Die Autorin baut also um das historische Gerüst eine neue und dennoch alte, spannende Geschichte auf, mit neuen Figuren und Handlungsträgern. Verhüllt natürlich in eine Sprache, die der der Droste entspricht. Dennoch rückt sie nicht zu sehr von den Tatsachen ab: klar übernommen hat Droste-Hülshoff einige eindrucksvolle Motive: die Buche, in der die Juden ihre Racheformel einhauen, die Heimkehr des Mörders, der keine Ruhe findet, sondern von Gespenstern gehetzt wird, und dessen Selbstmord an der Stelle, wo dieser vor Jahren zur Flucht aufgebrochen ist. Ebenso die Sklaverei, in der Friedrich Mergel jahrelang ausharren muss und die nicht ausreicht, um für die begangene Schuld zu sühnen.
Das Verhältnis der Erzählerin zu ihrem Modell, vor allem das Verhältnis zur Hauptfigur Friedrich Mergel, tragen zum Verständnis, oder eher gesagt zur Faszination der Judenbuche bei. So liegten ihr die Fakten einer Judenmörders ihrer Zeit zu Grunde, den sie in ihrer Erzählung zwar beschreibt und dessen Schandtat sie zwar wieder aufrollt, den sie aber nicht richtet. Sein Mord ist natürlich ein Verbrechen, das nicht so ohne weiteres vergessen werden kann ( was sich auch im Verhalten Mergels selbst deutlich erkennen lässt!), allerdings hebt Droste-Hülshoff die Vorgeschichte, die ja zwei Drittel der Novelle ausmachen, bedeutend hervor. Mergels Leben erscheint simple als die zufälligen Umstände, die zu seiner schrecklichen Tat führen. Sie tut alles, um den Mord nicht als einen Akt des Jähzorns erscheinen zu lassen. Die Ereignisse sprechen eher für Zwang und Schicksal, unter denen sich das zuvor genannte Leben eher vollstreckt als erfüllt. Die Gestaltung und die Verknüpfung der Vorfälle lassen erkennen, dass es der Dichterin darum geht, das Böse als ein trauriges Faktum der Menschlichkeit zu erkennen, das manchmal die Oberhand gewinnt und welchem man nur durch Mitmenschlichkeit entgegenwirken kann. Das von ihr geschilderte Bild der Juden, ihrer Rolle als ewige Sündenböcke und Opfer, ist ebenfalls getränkt in dieses angesprochene Böse, welchem zu entrinnen in der Novelle so schwierig scheint. Besonders in der Situation der ländlichen Bevölkerung, der in eine enge Gemeinschaft eingebundener Dorfbewohner, wo jeder jeden kennt, erlangt der Begriff von Recht und Unrecht, Gut und Böse einen eigenen Stellenwert: Schande und Scham werden automatisch größer, wenn sich alles, auch Privates, in nächster Nähe zu Nachbarn und Bekannten abspielt. Hier findet sich ein dorfgeschichtlicher Aspekt, den ich persönlich sehr interessant finde. Es ist nicht nur materielles Besitztum, auf den Menschen äußerst sensibel reagieren, sondern auch der "Besitz" von Ehre und der Stellung in der Gemeinschaft im Dorf, der mit allen Kräften und im Namen Gottes verteidigt werden will.
Annette von Droste-Hüslhoff hinterlässt dank ihrem Modell mit ihrem Werk nicht nur einen literarischen Leckerbissen, sondern auch einen tiefen Einblick in das sozio-moralische Leben und Denken der Gesellschaft im 19ten Jahrhundert.
Inhalt
"Ein Sittengemälde aus dem gebirgigten Westfalen", so lauter der Untertitel der 1842 erschienenen Novelle. Um die Mitte der 18. Jahrhunderts in einem kleinen westfälischen Dorf spielend, beschreibt die Geschichte den Werdegang Friedrich Mergels, der als Sohn eines brutalen Trinkers und einer stolzen und frommen Mutter geboren wird. Margret Semmler ist bereits die zweite Frau Hermann Merglers, nachdem die erste noch in der Hochzeitsnacht das Weite suchte. Die Familienverhältnisse stehen nicht gerade gut, im Elternhaus herrschen Gewalt Brutalität und Unruhe. So ist Friedrich Mergel also vom ersten Tag seines Lebens durch seine Herkunft geprägt. Sein Vater wird als verkommene Kreatur von den anderen Dorfbewohnern nicht geschätzt, sondern von manchen sogar gefürchtet. Unverständlich, warum eine Frau wie Margret Semmler sich auf eine Ehe mit Mergel einlassen kann. Das kurz darauf geborene Kind ist gesund und hübsch, wird aber bald in das Unheil seines Vaters hineingezogen. Dieser kommt eines Nachts nicht nach Hause und wird ermordet im Wald aufgefunden. Der Tod des Mannes bleibt ungeklärt, wundert aber niemanden im Dorf. Friedrich wächst heran und wird unter die Fittiche seines dubiosen Onkels Simon Semmler genommen, der seiner Schwester verspricht, etwas aus Friedrich zu machen..
Holz- und Jagdfrevel sind in B. (der genaue Name des Dorfes bleibt ungenannt) an der Tagesordnung und die Männer beschließen, Tag und Nacht Wache zu schieben. Die gefürchtete Blaukittel-Bande kann jedoch nicht überführt werden. Wie von Geisterhand verschwinden Nacht für Nacht Bäume aus dem Wald, ohne eine Spur zu hinterlassen. Als Friedrich eines Tage den Förster Brandis willkürlich in eine falsche Richtung schickt, wird dieser vermutlich von den Blaukitteln erschossen. Auch dieses Mal findet sich kein Mörder, der angeklagt und gerichtet werden könnte. In Friedrich tauchen allerdings Spuren von Schulgefühlen auf, die auf seine falschen Weisungen zurückzuführen sind.
Im Laufe der Jahre verschafft sich Friedrich durch Tapferkeit eine "bedeutenden Ruf", wird im Dorf bewundert und gleich So wandelt sich Friedrich vom unbeliebten, verschmähten Kuhhirten zu einem gut gekleideten, angesehenen jungen Mann . Seit dem Tod seines Vaters haftet ihm dennoch ein Hauch von Unheimlichem an, welchen es ihm nie gelingt, abzulegen. Friedrich Mergel hat einen Freund, dessen Rolle ganz ausschlaggebend für das Ende der Erzählung ist; Johannes Niemand, der Schweinehirt der Onkels, und vermutlich sein unehelicher Sohn, weicht ihm nicht mehr von der Seite, bildet seinen Schatten
Eines Nachts auf einer Hochzeit fordert der Jude Aaron die geliehenen 10 Taler zurück, die ihm Friedrich längst schuldig ist. Peinlichst blamiert, da er eben noch mit einer teuren Uhr geprahlt hat, entsteht ein Streit, worauf die Frau des Juden nach einigen Tagen zum Gutsherren kommt und die Abgängigkeit ihres Mannes meldet. Der Leichnam Arons wird kurze Zeit später im Brederholz gefunden. Der Verdacht fällt natürlich auf Friedrich Mergel, welcher bereits zusammen mit Johannes Niemand die Flucht ergriffen hat. So existiert zwar ein Verdächtiger, die völlige Klärung des Falles wird aber wieder nicht gewährleistet. Dieser Mord ist bereits der dritte, dessen Tatverlauf mehr oder weniger im Dunkeln verborgen bleibt.
Den Juden der Gemeinde wird gestattet auf der Buche, unter der man den Leichnam des Glaubensbruders fand, eine Gedenktafel anzubringen; auch wenn der Wald rundherum abgeholzt werden soll, wird das Weiterleben dieses einen Baumes garantiert.
Friedrich Mergel und sein Begleiter geraten in türkische Gefangenschaft , aus der bloß einer erst nach 28 Jahren in seine Heimat zurückkommt. Der Mann widerspricht nicht, als man in ihm den vor langer Zeit verschwundenen Johannes Niemand zu erkenne glaubt und lebt einige Zeit lang versteckt hinter dem Namen seines wahrscheinlich schon verstorbenen Freundes.
Nur den wenigsten im Dorf ist die Geschichte des Juden Aron noch geläufig, viele sind bereits verstorben oder nicht mehr im Dorf. Der Gutsherr, mittlerweile auch alt geworden, ist besorgt um den Zurückgekehrten, gibt ihm aus Mitleid Kleider und interessiert sich für seine Geschichte. Der vermutliche Johannes Niemand verdient sich sein täglich Brot durch Botengänge und kleine Aushilfsarbeiten. Als er eines Tages nicht von einem solcher Botengänge zurückkehrt, macht man sich besorgt auf die Suche. Drei Tage s später findet man den Alten an der Judenbuche baumelnd, eigenhändig erhängt an einem dünnen Strick. In diesem Moment wird den Dorfbewohnern bewusst, dass nicht Johannes Niemand aus der Fremde heimgekehrt ist, sondern Friedrich Mergel. Seine Schuldgefühle haben ihn schließlich in den Tod getrieben und der Spruch, den die Juden vor vielen Jahren an der Buche anbrachten behält seine Richtigkeit:" Wenn du dich diesem Orte nahest, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast."
Interpretation
Der Begriff Sittengemälde, unter welchen sich die Erzählung stellt, ist in der Zeit des Biedermeier eine beliebte Schilderung der Lebensweise eines Volkes oder einer Gemeinschaft und seiner landschaftlichen Umgebung. Und Sitten und Verhalten spielen auch wirklich eine große Rolle in "Die Judenbuche". Verbrechen und Brutalität gehören zur Tagesordnung, nicht nur im Hause Mergel, im gesamten Dorf und den ringsum liegenden Brederholz. Eingehüllt in Nacht und Dunkelheit bietet die Natur dem Verbrechen Schutz und verhindert in gewissem Sinne das Aufklären der Schandtaten. Hermann Mergel, Friedrichs Vater ist das erste Opfer, dessen Tod im Dunkeln verborgen bleibt. Es folgen im Zuge der illegalen Holzschlägerungen der Blaukittel der Mord am Förster Brandis, der zumindest Verdächtige mit sich führt. Der Mord am Juden Aaron ist der einzige in der Geschichte, der einer konkreten Person zugeordnet werden kann. Friedrich Mergel bleibt dennoch ungestraft, in dem Sinn, dass er von keiner Justiz gerichtet wird. Die Justiz scheint generell etwas in den Hintergrund zu treten, die Dorfbewohner stehen dem Treiben entweder hilflos oder untätig gegenüber. Rechtsprechende Funktion steht dem Gutsherrn zu, der an der Spitze der Dorfhierarchie steht. In diesem Fall ist es aber vielmehr die Natur, die nicht nur Symbol für Bedrohung und Verheimlichung darstellt, sondern auch als strenge Richterin fungiert. Der Gutsherr ist in diesem Fall kein vom Dorf gefürchteter Tyrann, der über sein Gesinde gnadenlos herrscht. Er wirkt, besonders durch sein Verhalten dem Heimgekehrten gegenüber, äußerst gutherzig. Diese Person passt ohne weiteres in die Gattung der Dorfgeschichte, deren Züge in der "Judenbuche" erkennbar sind. Außerdem besitzt "Die Judenbuche" einige Züge einer Kriminalgeschichte, wobei dem Leser mit Hilfe von Indizien und Fakten das Umfeld eines Verbrechens deutlich gemacht wird, ihm aber die endgültige Aufklärung der Morde selbst überlassen bleibt. Einzig und allein Friedrich Mergel wird als Mörder genannt und steht mit seinem vollen Namen für das ein, was er vergangen hat. Allerdings hat der Zeitraum, der sich zwischen Mord und Rückkehr aus der Sklaverei auftut, seine unmenschliche Handlung verblassen lassen. Schon kurz nach Verschwinden der beiden
Schuldigen, Johannes Niemand ist immerhin Mitwisser, äußert sich der Gutsherr " den Fleck von Mergels Namen zu löschen". Ebenfalls ein Zeichen für seine Milde, seinem Einsatz, das Böse wettmachen zu wollen. Ist der Mord für die im Dorf Gebliebenen auch längst verjährt, so hat er sich doch in Friedrichs Erinnerung eingebrannt. Es kann nicht genügend Zeit vergehen, das Verbrechen bleibt für den Mörder selbst ungesühnt.
Es fällt auf, dass selbst Droste-Hülshoff Friedrich Mergel als Judenmörder nicht eindeutig richtet. Sie lenkt starke Betonung auf seine furchtbare Kindheit, die Schande, die durch seinen Vater in sein Leben gedrungen ist, die Prägung, die er durch die gesetzwidrigen Geschäfte seines Onkels Simon Semmler erhalten hat. Schon als Kind wurde Friedrich von den anderen verspottet und gemieden, da ihn allein die Gestalt seines Vaters, zu dem er sich bekennen muss, unheimlich und furchteinflößend machte. Die Dichterin lässt den Druck, der auf Friedrich lastet, mit dem Tod des Juden kulminieren. Wieder findet sich die Leiche im Brederholz, in dem der böse Geist des verstorbenen Hermann Mergels umzugehen scheint. Das Brederholz symbolisiert also ebenfalls das Böse, das Dunkle und Unheimliche. Fast 30 Jahre später, strahlt dieser ominöse Wald immer noch immense Anziehungskraft aus, birgt immer noch unbenennbar Böses. Die Judenbuche hingegen, wird zum Dingsymbol von Kraft und gleichzeitig Rache. Wahrscheinlich steht sie auch für Macht und Stärke, die die jüdische Gemeinde bewusst machen will.
Das Schicksal der Juden in Preußen zu dieser Zeit kann man nur als bejammernswert bezeichnen. Erst im Zuge der Hardenberg'schen-Reformen im Jahr 1812 erlangt das Edikt über die bürgerlich Verhältnisse in Preußen Gültigkeit. Liest man die darin aufgelisteten Änderungen, kann man sich die bedauernswerte Lage in der vorangehenden Zeit bildhaft vorstellen. Die Juden galten in den Augen der Dorfbewohner, die sich selbst als Einheimische betrachteten, als Fremde, Schutz- und Rechtslose und Unliebsame. Häufig vorkommende Judenmorde in dieser Zeit sind somit verständlich. Derartiges schien am Moralgefühl der sich christlich nennenden Bürger nicht zu rütteln.
Ähnliches gilt für den Holzdiebstal und anderes Unwesen, das in den Wäldern getrieben wurde und welches von den ungleichen und ungeklärten Besitzverteilungen herrührt.
Die Dorfgesellschaft gliedert sich natürlich in eine Hierarchie, an deren oberster Spitze in diesem Fall der Gutsherr und der direkt in seinem Dienst stehende Förster Brandis. Gefolgt von Forstbeamten, Forstpflegern, Waldhütern, Gerichtsschreibern, Boten... Von der Menge abhängig sind Bauern und Halbmeier, unter welchen sich das Gesinde, die Knechte und Mägde schart. Innerhalb der Knechtschaft herrscht ebenfalls eine sukzessive Einteilung: Schaf-Kuh- und Schweinehirten. Die Szenerie und das Umfeld der Erzählung sind ebenfalls typisch dorfgeschichtlich.
In "Die Judenbuche" tritt gleichfalls die Hierarchie in der Familie hervor, auch die Stellung verschiedener Familien eines Standes zu einander. In Besitz von Geld zu sein bedeutet Ansehen und Achtung, was auf der Hochzeit der Familie Hülsmayer deutlich wird. Friedrich Mergel schämt sich derartig über die öffentliche Rückforderung des geliehenen Geldes, dass er den Juden sogar erschlägt. Die eigene Ehre ist in dem Fall um vieles wichtiger als das Menschenleben eines anderen. In dieser Hierarchie spalten sich Recht und Unrecht, der Begriff gerät einigermaßen in Verwirrung. Vollkommene Schuldzusprechung gibt es nicht, auch keine deutliche Definition von Schuld. Der Mord am Förster könnte sogar als Notwehrhandlung gesehen werden, da aufgrund der Besitzlosigkeit der Armen das Stehlen von Holz zur Lebenserhaltung notwendig wird. Der Förster wird also nicht vorsätzlich getötet, die Mörder sehen in ihm nicht den Menschen, sondern den Förster. Anders ist die Verbindung zwischen Friedlich Mergel und Brandis. Wie bereits weiter oben erwähnt, wird der Förster von Mergel absichtlich in die falsche Richtung geschickt. Mir ist allerdings nicht klar, ob Mergel in diesem Augenblick an die Gefahr der Blaukittel denkt, die sich der Förster durch die Fehlweisung aussetzen wird. Es scheint eher der Fall zu sein, dass Mergel, geprägt und verletzt durch das Gerede über seinen Vater und seine Familie, dem Förster einfach nicht helfen will und ihn darum in die Irre leitet. Er wird also wieder zur Tat getrieben, durch den ungewollten Verlauf seines Lebens, seiner Kindheit.
Friedrichs Mutter Margreth steht eindeutig für Religiosität und Frömmigkeit, ihr wird das Symbol des Rosenkranzes zugeordnet. Ihr Bitten und Flehen zu Gott erinnert allerdings stark an Aberglaube, an ein Fürchten vor etwas Namenlosen. Mit der Mutter trifft man auf eine der wenigen Frauenfiguren in der "Judenbuche" und gewiss verdient auch die soziale Stellung der Frau jener Zeit gehöriges Interesse. Anhand der beiden Ehefrauen Hermann Mergels wird die völlig patriachalische Struktur solcher Dorfgemeinschaften deutlich. Auch das makabre Bruder-Schwester Verhältnis (Simon - Margreth) und sogar das Mutter-Sohn-Verhältnis sprechen eine deutliche Sprache. Die Mutter hat, was die Erziehung des Sohnes betrifft, keinen Einfluss mehr, sowie der Vater verstirbt. Der Onkel, der der Inbegriff des satanisch Bösen ist und der Religiosität der Schwester drohend und am Ende mächtiger gegenüber steht. Margreth übernimmt zwar die Rolle einer starken Frau, einer in gewissem Sinne außergewöhnlichen Frau, die trotz der Brutalität eine Ehe mit Hermann Mergel eingeht, scheitert aber dennoch an der in der Gesellschaft immer noch stärkeren Welt der Männer. Sie muss sich ihr Scheiter auch selbst eingestehen. Ihre Erziehungsmethoden greifen nicht wirklich, oder nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, von wo an Friedrich in Berührung mit Geld und Ansehen kommt.
Bei genauer Betrachtung lässt sich nun feststellen, dass "Die Judenbuche" sehr wohl eine Dorfgeschichte ist, eben eine mit tatsächlichem Hintergrund und einer Fülle von literarischen Kunstgriffen.
Häufig gestellte Fragen zu "Leben und Werk der Droste" und "Die Judenbuche"
Wer war Annette von Droste-Hülshoff?
Annette von Droste-Hülshoff war eine deutsche Dichterin des Biedermeier. Sie wurde am 12. Januar 1797 auf Schloss Hülshoff bei Münster in Westfalen geboren und starb am 24. Mai 1848. Ihre Werke zeichnen sich durch tiefe Religiosität, die Auseinandersetzung mit Schuld und Sühne sowie die Darstellung ihrer westfälischen Heimat aus.
Was sind die wichtigsten biographischen Einflüsse auf Droste-Hülshoffs Werk?
Zu den wichtigsten Einflüssen zählen ihre Herkunft aus dem westfälischen Adel, ihre tiefe Verwurzelung in ihrer Heimat, ihre Religiosität, ihre Krankheiten (Tuberkulose und Schilddrüsenerkrankungen) und die sogenannte "Jugendkatastrophe", in der sie zwischen zwei Verehrern stand und beide verlor. Diese Ereignisse prägten ihre Themenwahl und den düsteren Grundton ihrer Werke.
Was ist "Die Judenbuche"?
"Die Judenbuche" ist eine Novelle von Annette von Droste-Hülshoff, die 1842 erschien. Sie wird als "Sittengemälde aus dem gebirgigten Westfalen" untertitelt und basiert auf einer wahren Begebenheit im Gutsbezirk ihres Großvaters. Die Novelle handelt vom Werdegang Friedrich Mergels, der in eine Reihe von Verbrechen verwickelt wird und schließlich an der Judenbuche Selbstmord begeht.
Worauf basiert die Handlung der "Judenbuche"?
Die Handlung basiert auf einer historischen Begebenheit aus dem Jahr 1783, als Hermann Georg Winkelhagen den Schutzjuden Soestmann-Behrens (genannt Pinnes) erschlug. Droste-Hülshoff hatte Auszüge aus den Akten des Falles gelesen und baute um diese historischen Tatberichte ihre Geschichte auf.
Wie unterscheidet sich die Novelle von der historischen Vorlage?
Droste-Hülshoff entfernt sich von der Vorlage, indem sie eigene Charaktere und Handlungsträger erfindet. Sie betont, dass ihr "Mergel" (Friedrich Mergel) sich nicht mit dem historischen Mörder deckt und dass die Wahrheit der Geschichte ihres Onkels eigentlich besser sei. Sie übernimmt jedoch einige eindrucksvolle Motive, wie die Buche, die Racheformel der Juden, die Heimkehr des Mörders und seinen Selbstmord.
Welche Rolle spielt Friedrich Mergel in der "Judenbuche"?
Friedrich Mergel ist die Hauptfigur der Novelle. Er wird als Opfer seiner Umstände dargestellt, dessen Leben von Gewalt, Armut und sozialer Ausgrenzung geprägt ist. Obwohl er einen Mord begeht, wird er von Droste-Hülshoff nicht eindeutig gerichtet. Sie betont die Umstände, die zu seiner Tat geführt haben, und deutet den Mord eher als Ergebnis von Zwang und Schicksal denn als Akt des Jähzorns.
Welche Themen werden in der "Judenbuche" behandelt?
Zu den wichtigsten Themen gehören Schuld und Sühne, Recht und Unrecht, die Rolle der Gesellschaft, die Bedeutung von Ehre und Ansehen, das Schicksal der Juden in Preußen sowie die Darstellung des Bösen als ein trauriges Faktum der Menschlichkeit.
Welche Bedeutung hat die Judenbuche selbst?
Die Judenbuche ist ein Dingsymbol von Kraft, Rache und Gerechtigkeit. Sie steht für die Macht und Stärke der jüdischen Gemeinde und dient am Ende der Novelle als Ort der Sühne, als Friedrich Mergel sich dort erhängt.
Wie ist die Dorfgesellschaft in der "Judenbuche" dargestellt?
Die Dorfgesellschaft wird als hierarchisch und von Sitten und Gebräuchen geprägt dargestellt. Verbrechen und Brutalität gehören zur Tagesordnung, und die Natur bietet dem Verbrechen Schutz. Der Gutsherr steht an der Spitze der Hierarchie, aber die Dorfbewohner stehen dem Treiben oft hilflos oder untätig gegenüber.
Welche literarischen Einflüsse sind in der "Judenbuche" erkennbar?
"Die Judenbuche" vereint Züge des Sittengemäldes, der Dorfgeschichte und der Kriminalgeschichte. Sie bietet einen Einblick in das sozio-moralische Leben und Denken der Gesellschaft im 19. Jahrhundert.
- Arbeit zitieren
- Judith Schmuck (Autor:in), 2001, Die Judenbuche hinsichtlich dorfgeschichtlicher Aspekte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102641