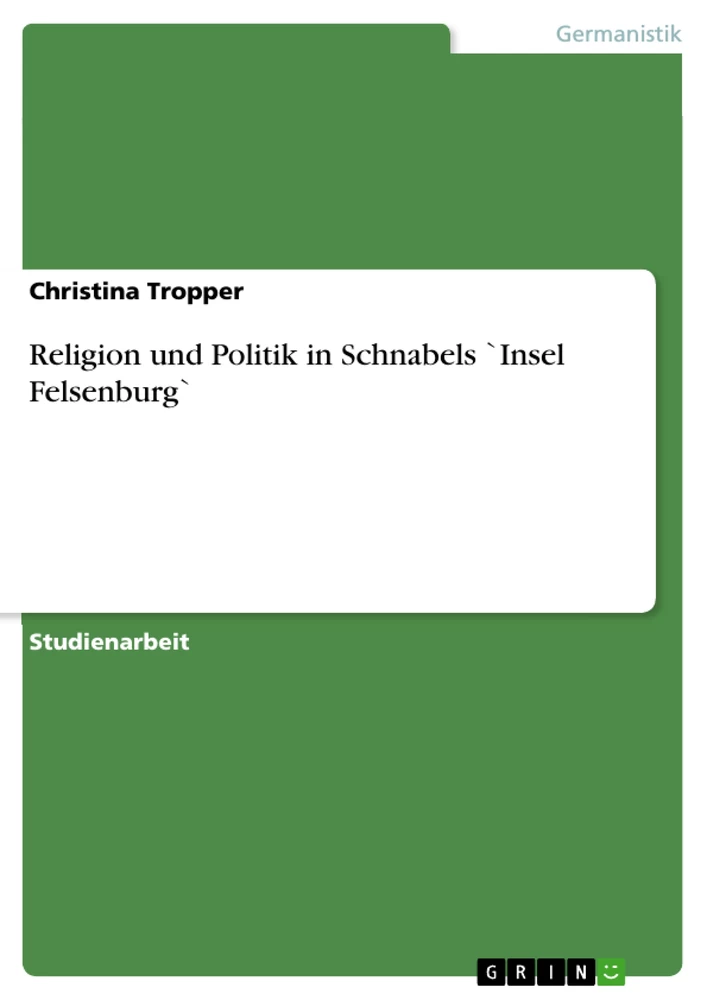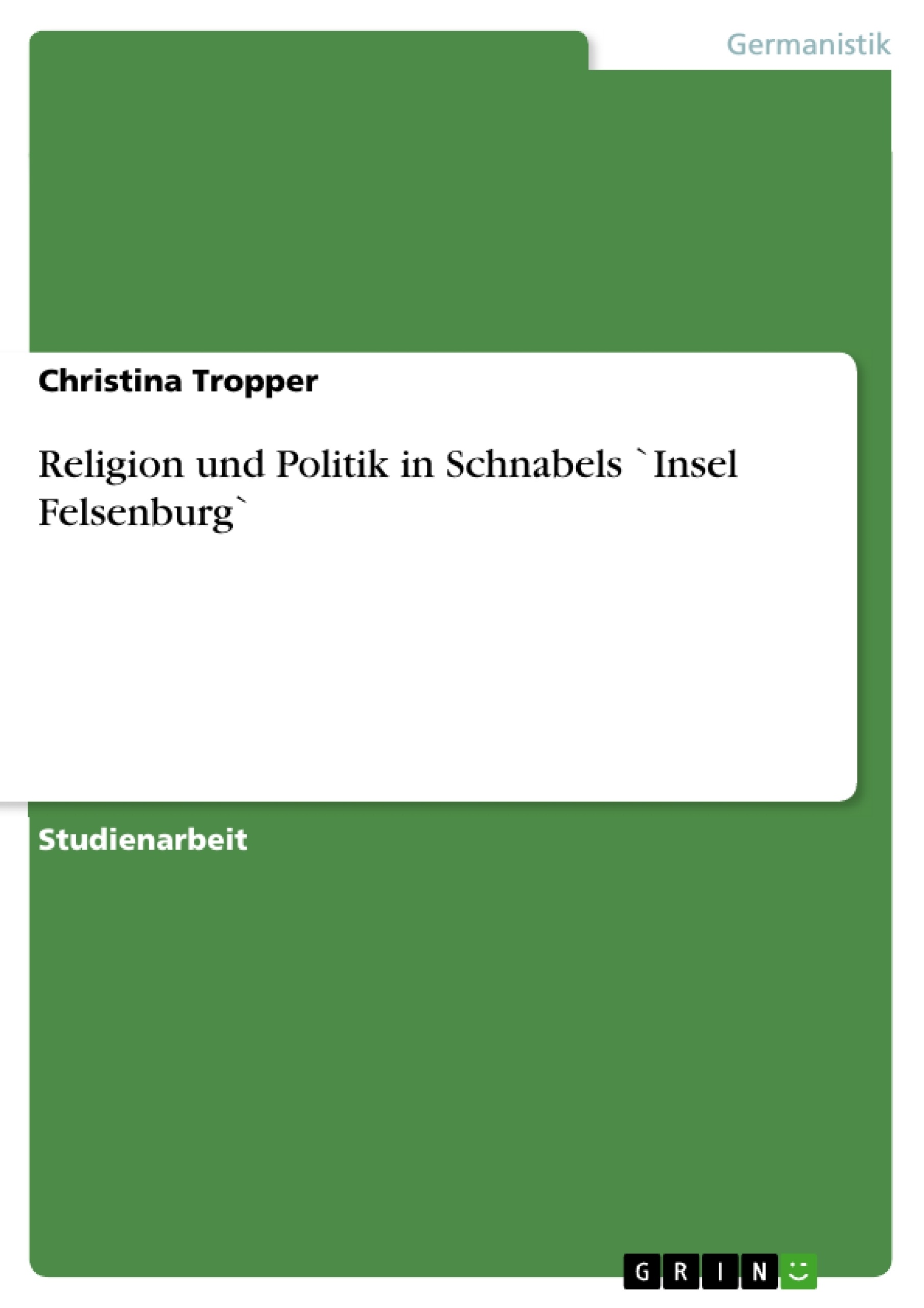INHALTSVERZEICHNIS:
1. Definitionen und Allgemeines
2. Religion in der „Insel Felsenburg“
2.1 Die Berufsidee nach Weber in der „Insel Felsenburg“
2.2 Der Prädestinationsglaube nach Weber in der „Insel Felsenburg“
2.3 Die Herausbildung von Freikirchen nach Weber in der „Insel Felsenburg“
3. Politik in der „Insel Felsenburg“
4.1 Johann Gottfried Schnabels Leben und Wirken
4.2 Schnabels Zeit
4.3 Philosophischer Hintergrund
4.4 Zusammenhänge der „Insel Felsenburg“ und der Zeit
5. Zusammenfassung
6. Literaturnachweis
1. Definitionen und Allgemeines
Der Begriff „Utopie“ stammt ursprünglich von dem griechischen Wort „ou topos“, was so viel wie „kein Ort“ bzw. „Nichtort“ bedeutet.
Inhaltlich spiegelt eine Utopie die Schilderung eines erdachten, erhofften oder befürchteten, nirgends realisierten Gesellschaftszustands wider.1
Im alltäglichen Sprachgebrauch findet der Begriff „Utopie“ seine Anwendung im Sinne eines nicht durchführbaren Zukunftsbildes. Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene Richtungen von Utopien herauskristallisiert: zum einen existiert die Utopie als eine Denkform, zum anderen nimmt die Utopie in der Literatur eine bedeutende Rolle ein. Oft sind utopische Werke in der Literatur in Form von Reiseberichten geschrieben, richten sich meist satirisch gegen die bestehende Staatsform und entwerfen einen Idealstaat. Utopien verkörpern Beschreibungen von Idealzuständen menschlichen Beisammenseins. Sie fordern eine völlige soziale Harmonie, was eine völlige Gleichheit, einen Zustand völligen Friedens, sowie vollständige Befriedigung menschlicher Bedürfnisse impliziert.
Sie bringen Gesellschaftskritik zum Ausdruck indem sie im unübersehbaren Widerspruch zu bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen stehen.
Die Utopie beansprucht eine zeitlose und objektive Gültigkeit. Sie ist gekennzeichnet durch eine völlige Kompromißlosigkeit und lehnt somit jegliche Toleranz gegenüber Andersdenkenden ab.
Die klassischen, bis ca. 1900 vorherrschenden idealisierenden Utopien sind seit den Weltkriegen einer modernen Form der Utopie gewichen, die ein Ausdruck der Skepsis, des Pessimismus, des Zynismus oder der Verzweiflung ist. Diese „negative“ Utopie (oder Gegenutopie) gipfelt in der Vorstellung eines gespenstischen Infernos, in dem die Perfektion der Technik, der Wissenschaft und der Machtausübung endet.2
2. Religion in der „Insel Felsenburg“
Betrachtet man die „Insel Felsenburg“ unter dem Aspekt der Religion, so merkt man bald, daß es sich bei den gestrandeten Inselbewohnern um tief religiöse Menschen handelt. Der Protestantismus, der als Grundlage und Haupthandlung für den Roman gesehen wird, spiegelt sich in vielen Situationen wider und gibt dem Leser auch einen Einblick in den protestantischen Glauben. Die Religion weitet sich auf alle Bereiche des Lebens aus und bietet eine Basis, eine Art „Rettungsanker“ für die redlichen Menschen der Insel.
Nun ist es wohl wichtig, zuerst den Protestantismus näher zu betrachten. Dazu empfiehlt sich Max Webers Aufsatz „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“, in dem Weber von einem grundlegenden Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein einer bestimmten religiösen Ethik und der Entwicklung eines kapitalistischen Geistes aus, welcher wiederum eine entscheidende Voraussetzung für das Entstehen des modernen Kapitalismus darstellt.
Der Ausgangspunkt für diese These sind empirische Untersuchungen, bei denen ganz klar zu Tage trat, daß Protestanten im wirtschaftlichen Leben oft führende Rollen einnahmen, Katholiken dagegen eher selten.3
Zuerst stellt sich natürlich die Frage, was „protestantische Ethik“ in Webers Sinne überhaupt ist.
Erklärtes Ziel der Reformatoren Luther, Calvin und Zwingli war es, die Ideale des Christentums von ihrer Beschränkung auf einen kleinen elitären Kreis von Klerikern und einzelne kirchliche Feiertage zu lösen. Kirchliches Leben bzw. christliche Lehren sollten auf den Alltag eines jeden Gläubigen ausgedehnt werden.
Nicht weniger, sondern mehr Religiosität wurde von den Protestanten gefordert. Somit kam es zu einer Disziplinierung der Gesamtpersönlichkeit des einzelnen Christen.4
So kann man auch in der „Insel Felsenburg“ erkennen, wie sich der Glaube in alle Bereiche des Lebens einmischt und die Insulaner in ihren Entscheidungen, Verhaltensweisen, Einstellungen und den Abläufen des Tages beeinflußt.
Kennzeichnend für dieses neue disziplinierte Lebensweise der Protestanten sind vor allem drei Merkmale: 1. die Berufsidee, 2. die Prädestinationslehre und 3. die Herausbildung von Freikirchen.
2.1 Die Berufsidee nach Weber in der „Insel Felsenburg“
Der Protestantismus wertete die tägliche Arbeit sittlich auf. Bisher galt der Beruf lediglich als Zwang der Lebensfristung, der notwendig war, aber mehr auch nicht. Im Zuge der Reformation wurde Arbeit nun zum sittlichen Verdienst. Der Beruf wurde zur Aufgabe und Erfüllung des Lebens.5
[...] die ü brige Zeit mu ß ten sie [die Kinder] mit n ü tzlicher Arbeit, so viel ihre Kr ä fte vermochten, hinbringen, das Schie ß -Gewehr brauchen lernen, Fische, V ö gel, Ziegen und Wildpret einfangen, in Summa, sich die Zeiten so gew ö hnen, als ob sie so wol als wir Zeit Lebens auf dieser Insul bleiben solten. 6
Die Erziehung von Kindern in einer Kultur sagt viel über deren Lebensschwerpunkte und Lernziele aus. Die Felsenburger, in diesem Fall Concordia und Albert Julius wollen also ihren Nachkommen schon von Kindesbeinen ihre Werte weitergeben, sowie auch die Tüchtigkeit, die sie unermüdlich an den Tag legen.
Dies kann, wie auch viele weitere Passagen in der „Insel Felsenburg“, auf Luther zurückgeführt werden, der in den weltlichen Berufen eine dem Individuum von Gott zugeteilte Verpflichtung zum sittlichen Wirken in der Welt sah. Der Beruf wurde zur Berufung (engl.: ,,vocation", ,,calling", ,,profession") im eigentlichen Sinne.7
Die Berufsarbeit wird zum äußeren Ausdruck der Nächstenliebe, da die Arbeitsteilung jeden einzelnen zwingt, nicht nur für sich, sondern für andere zu arbeiten. Diese innerweltliche Pflicht zur Arbeit ist nach dem Willen der Reformatoren der einzige Weg, ein gottgefälliges Leben zu führen. Dabei gilt jeder Beruf als Gottes Wille und ist deshalb, sofern er die Grenzen der Legalität nicht überschreitet, als gleichwertig zu betrachten.8
Es ist auffallend, daß ein großer Teil des Tages durch die Berufsausübung zugebracht wird. Die Bewohner häufen riesige Mengen an Kleidungs- und Nahrungsmittelvorräten an und produzieren Überschüsse, die sie selbst nie verbrauchen können.
[...] so da ß wir vor unsere und wohl von 20. Personen auf Lebens- Zeit nothd ü rfftige Kleider daraus verfertigen konnten. 9
Calvin radikalisierte Luthers Berufsauffassung. Er sah die Welt nicht mehr als gottgewollte vorgegebene Ordnung, sondern als Ansammlung von Werkzeugen und Materialien, die erst noch zur Errichtung von Gottes Reich auf Erden dienen sollten. Es galt, den Beruf zu nutzen, um durch seine pflichtgemäße und möglichst erfolgreiche Ausübung die eigene Erwähltheit durch Gott zu beweisen. Dabei durfte ohne weiteres großer Reichtum angehäuft werden. Dieser war als äußeres, deutlich sichtbares Zeichen des Erfolges, sogar erwünscht. Ein Leben in Luxus, verschwenderisches Genießen des Geldes dagegen, war verboten und gottlos.10
Dies zeigt sich auch in der Felsenburg, als Albert Julius und Monsieur van Leuven durch Zufall in der Höhle eine Unmenge an Kostbarkeiten finden, verstecken sie diese wieder, um dem gottlosen Lemelie, der vermutlich mit den Schätzen geprahlt und somit gegen Gottes Gebote verstoßen hätte, den Fund zu verheimlichen.
Ermeldete Schatzkammer aber, die wir dem Lemelie nicht wolten wissen lassen, wurde von unsern H ä nden wohl vermauret, auswendig mit Leimen beschlagen, und so zugerichtet, da ß niemand vermuthen konte, als ob etwas verborgenes darhinter steckte. 11
Die kalvinistischen Christen wurden nun von der Auflage befreit, sich in ihrem angeborenen Stand bewegen zu müssen. Stände- bzw. Zunftordnungen sollten die Entwicklung des Einzelnen nicht mehr hemmen.
Die Standesunterschiede, wie sie in der „Insel Felsenburg“ beschrieben werden, sind unter den Bewohnern der Insel kaum von Bedeutung. Schnabel betont sogar, daß ein Leben frei von „klassenorientierten“ Unterschieden geführt wird, was sich auch in Monsieur van Leuvens Verhalten zeigt. Er arbeitet fleißig wie alle anderen Gestrandeten und hilft tatkräftig mit Schlafstellen zu bauen und Nahrung herbeizuschaffen.
Es ist jedoch auffallend, daß anstelle der sonstigen Dienerschaft und dem Gesinde ein Ersatz für die unangenehme Arbeit in Form von Affen gefunden wird. Diese wohnen abgetrennt in eigenen Behausungen und sind (verständlicherweise) nicht in den Familienverband aufgenommen und werden bei falschem Verhalten sogar hart bestraft.
Unsere Unterthanen, die Affen, schienen hier ü ber sehr verdr üß lich zu seyn, indem sie vielleicht selbst gro ß e Liebhaber, dieser edlen Frucht waren, hatten auch aus Leichtfertigkeit viel Schanden gemacht, doch, da ich mit der Flinte entliche mahl blind Feuer gegeben, geriethen sie in ziemlichen Gehorsam und Furcht. 12
Weiters erhielt das Erwerbsleben einen Eigenwert gegenüber dem privaten Haushalt und wurde so erfolgreich von diesem gelöst, was sich auch in der „Insel Felsenburg“ zeigt.13
Die Gestrandeten gehen äußerst sorgfältig ihrer Arbeit nach und Schnabel betont ganz besonders, daß Concordia nach ihrer Niederkunft schon bald wieder ihren täglichen Pflichten nachkommen kann und dieses auch tut.
Solchergestalt befand sich nun nicht allein das Kind vollkommen befriedigt, sondern die Mutter konte 4. Tage hernach selbiges, zu aller Freude, aus ihrer Burst stillen, und am 6ten Tag frisch und gesund das Bette verlasse, auch, wiewol wider meinen Rath, allerhand Arbeit mit verrichten. 14
2.2 Der Prädestinationsglaube nach Weber in der „Insel Felsenburg“
Ein weiterer Grundpfeiler der protestantischen Religion, der Prädestinationsglaube ist in vielen Passagen der „Insel Felsenburg“ zu finden.
Der kalvinistische Prädestinationsglaube lehrt, daß Gott mit seiner absoluten Entscheidungsmacht einigen Individuen seine Gnade zukommen läßt und sie zu himmlischer Seligkeit an seiner Seite führt, andere dagegen zu ewiger Verdammnis verurteilt sind. Die Entscheidung zwischen Eingehen in den Himmel bzw. Verdammung der Seele eines Menschen kann dabei nicht durch gute Taten oder Erfolg auf Erden erwirkt werden, sondern ist von vornherein festgelegt. Die Entscheidung Gottes ist absolut, unumstößlich und für den Menschen mit seinem beschränkten Horizont nicht rational begreifbar.15
Die von Gott verdammten Geschöpfe werden von Schnabel gleich von Anfang an als gottlos und unehrlich beschrieben, er läßt dem Leser nicht einmal die Gelegenheit sich ein Bild von den einzelnen Charakteren zu machen, sondern betont von Beginn an die schlechten Eigenschaften der ‚unelected‘.
Dieser Severin Water war ein junger Holl ä ndischer, sehr frecher und woll ü stiger Kauffmann, und hatte schon ö ffters in Amsterdam Gelegenheit gesucht, mich zu einem sch ä ndlichen Ehe-Bruche zu verf ü hren. 16
Es stellt sich die Frage, wie der gläubige Kalvinist nun mit dieser unsicheren Situation, die seinen Gnadenstand betrifft, umgeht. Was immer auch geschieht, wie immer man auch lebt, man kann sich nie seines Gnadenstandes oder seiner Verdammung sicher sein. Ein völlig gottloses hedonistisches oder anarchisches Leben könnte also ebenso zur Erlösung führen wie die strenge Beachtung kirchlicher Regeln.
Daß die erste Variante im Regelfall nicht gewählt wurde, schreibt Weber einer in der damaligen Zeit vorherrschenden religiösen Grundstimmung zu. Das Jenseits nahm im Leben der Menschen die wichtigste Stellung ein. Somit setzte man sich nicht damit auseinander, was man im Diesseits alles machen könnte, sondern quälte sich mit Fragen nach der Gewißheit der eigenen Erlösung.17
Während Calvin selbst die Annahme, anhand des irdischen Lebens eines Menschen dessen Erwähltheit nachzuweisen, als vermessenen Versuch, in die Geheimnisse Gottes einzudringen, ablehnte, dachten viele seiner Nachfolger hier ganz anders. Den Gläubigen wurde es zur Pflicht gemacht, sich selbst für erwählt zu halten. Unsicherheit hätte ihre Gründe in einem unsicheren Glauben, also in einer unzulänglichen Wirkung göttlicher Gnade. So wurden aus demütigen Sündern bald schon selbstbewußte und selbstsichere Heilige.18
Das Mittel der Erlangung eben dieser Selbstsicherheit wurde die rastlose Berufsarbeit. Durch die aufopferungsvolle Hingabe zum Beruf sollten religiöse Zweifel verscheucht und die Sicherheit des Gnadenstandes geboten werden. Weber ist der Meinung, daß die Aufgabe der weltlichen Berufsarbeit darin bestünde, religiöse Angstaffekte abreagieren zu können.19
Diese rastlose Hingabe an den Beruf ist also quasi eine zumindest von Calvin unbeabsichtigte Folge von Unsicherheiten, die durch die Prädestinationslehre erzeugt wurden.
Dennoch ist die allgemeine Gottesfurcht der Menschen dieser Zeit nicht zu übersehen, die sich in allen ihren Taten auf Gott und dessen Gnade verlassen.
Ich fuhr vor grossen Freuden im Schlafe auf, und streckte meine Hand nach der Pflantze aus, welche mir, meinen Gedancken nach, von Don Cyrillo vorgehalten wurde, merckte aber sogleich, da ß es ein Traum gewesen. Concordia fragte mit weinenden Augen nach meinem Zustande. Ich bat sie,[233]solte einen frischen Muth fassen, weil mit GOTT bald helffen w ü rde, nahm mir auch kein Bedencken, ihr meinen nachdencklichen Traum v ö llig zu erzehlen. 20
Dieser, wie wir ihn heute nennen würden Zufall oder Umstand, wird von den Insulanern als gottgewollt bezeichnet und nicht hinterfragt, sondern Gottes Herrlichkeit zugeschrieben. Er wird nicht kritisch aufgenommen, sondern anstandslos hingenommen, selbst Schicksalsschläge werden nach weiterem Betrachten als positiv akzeptiert.
Allein ich [Concordia] wei ß , da ß Gl ü ck und Ungl ü ck von der Hand des HERRN k ö mmt, welchen ich bey allen F ä llen in Demuth k ü sse. 21
Die Freikirchen, welche die dritte und letzte Säule des protestantischen Glaubens darstellt, findet der Leser auch in der „Insel Felsenburg“ wider.
2.3 Die Herausbildung von Freikirchen in der „Insel Felsenburg“
Viele protestantische Strömungen wählten als Organisationsformen Sekten oder Freikirchen (z.B. Puritaner, Quäker, Baptisten). Diese lehnten jegliche Amtshierarchien, in denen religiöse Lehrsätze oder Sakramente monopolartig verwaltet wurden, ab. Sie verstanden sich als nach innen radikal egalitäre, nach außen aber ebenso elitäre religiöse Gemeinschaften. Hier liegt auch schon der wichtige Unterschied im Vergleich auf die uns heute bekannten Sekten. Während damals viel Wert auf den inneren antiautoritären Charakter gelegt wurde, zeichnen sich heutige Sekten wie z.B. Scientology eher durch autoritäre Bindungen aus. Sie orientieren sich an charismatischen Führern und sind nicht durch demokratische Organisationsformen geprägt, wie sie z.B. bei den Quäkern oder den Baptisten durchaus vorhanden waren.22
In diesen Sekten bzw. Freikirchen griffen die kalvinistischen Dogmen viel intensiver als in den herkömmlichen Amtskirchen, da sich in diesem kleineren Rahmen vieles natürlich effizienter kontrollieren ließ. Mißachtungen der Regeln wurden sofort mit sozialer Ächtung beantwortet, schlimmstenfalls konnte auch ein Ausstoß erfolgen. Aber auch positive Sanktionen, beispielsweise für besonders erfolgreiches ökonomisches Handeln, waren an der Tagesordnung und verstärkten so den Anreiz nach beruflichem Erfolg.23
Die protestantischen Freikirchen waren ökonomisch sehr aktiv. Das lag u.a. auch daran, daß Mitgliedern der Kirchen aufgrund der gesellschaftlichen Minderheitsposition oft der Weg einer staatlichen Beamtenlaufbahn, aber auch eine Betätigung innerhalb der Zünfte oder in der Landwirtschaft verwehrt wurde. Daher wanden sie sich oft mit großem Erfolg neuen, vor allem industriellen Erwerbsformen zu.24
Die „Insel Felsenburg“ kann also in diesem Sinn als eigenständige Freikirche gesehen werden, da sie völlig unabhängig von Importen eine freie Religionsgemeinschaft bildet.
3. Politik in der „Insel Felsenburg“
Man kann die „Insel Felsenburg” als eine Art kommunistische Urgemeinschaft, aber streng lutherisch und unter einem sanften patriarchalischen Regiment bezeichnen. Der patriarchalische Charakter zeigt sich in mehreren Stellen, in der Albert Julius des öfteren als „Urvater“ bezeichnet wird.
Im Jahr 1694. fingen meine s ä mmtlichen Kinder an, gegenw ä rtiges viereckte sch ö ne Geb ä ude auf diesem H ü gel vor mich [Albert Julius], als ihren Vater und K ö nig, zur Residentz aufzubauen, mit welchen sie erstlich nach 3en Jahren v ö llig fertig wurden, we ß wegen ich meine alte H ü tte abreissen und gantz hinweg schaffen lie ß , das neue hergegen beohe, und es Alberts-Burg nennete [...]. 25
Albert Julius sieht sich als selbst als der König und das Familienoberhaupt der Inselgemeinschaft und wird als dieses auch akzeptiert.
Im Gegensatz zu Europa, das für eine imbezile und gänzlich amoralische Aristokratie, für Korruption, Gier, militärische Barbarei und die Intoleranz des Klerus steht, stellt sich die Felsenburg. Der Roman wechselt somit zwischen Fluchtutopie eines resignativen, politisch noch nicht emanzipierten Bürgertums und Fundamentalkritik am Ancien régime. Daß die Inselbewohner nicht daran interessiert sind, sich von der Insel zu retten, zeigt sich schon bald nach dem Schiffbruch. Vorerst wird noch versucht eine Rettung durch vorbeifahrende Schiffe zu anzustreben, doch bald wird klar, daß alle Alteuropäer sehr zufrieden auf ihrer Insel der Seligen sind.
Mein Vaterland, oder nur einen eintzigen Ort von Europa wieder zu sehen, ist niemals mein Wunsch gewesen, derowegen habe mein weniges zur ü ck gelassenes Verm ö gen, so wol als Schimmer, gern im Stich gelassen und frembden Leuten geg ö nnet, bin auch entschlossen, bi ß an mein Ende dem Himmel unaufh ö rlichen Danck abzustatten, da ß er mich an einen solchen Ort gef ü hret, allwo die Tugenden in ihrer angebohrenen Sch ö nheit anzutreffen, hergegen die Laster des Landes fast g ä ntzlich verbannet und verwiesen sind. 26
4.1 Johann Gottfried Schnabels Leben und Wirken
Johann Gottfried Schnabel, auch Gisander, wurde am 7.11 1692 in Sandersdorf bei Bitterfeld geboren. Das Leben Schnabels ist nur in Bruchstücken bekannt. Sein Tod wird zwischen 1751 und 1758 angesiedelt. Der Sohn eines Pfarrers trat 1702 in die Lateinschule in Halle ein. 1708-1710 nahm er am Spanischen Erbfolgekrieg teil.27
4.2 Schnabels Zeit
Schnabel gilt als Vertreter der Frühaufklärung, die eine gesamteuropäische Bewegung war und von Frankreich und England ausging, in Deutschland allerdings erst verspätet aufgenommen wurde. Trotz der verschiedenen Strömungen gab es gemeinsame Grundlagen wie zum Beispiel die Weltorientiertheit des aufklärerischen Menschen, der die Natur und die Geschichte mit Hilfe der Vernunft zu begreifen versucht.
Das vernünftige Denken und Verhalten soll die Ordnung und die Harmonie in der Gesellschaft garantieren. Damit ist ein moralisches und tugendhaftes Leben gemeint, zu dem in Appellen an das Gute und Ehrbare zu tun, immer wieder aufgerufen wird. Tugenden wie Pflichtbewußtsein, Fleiß, Wirtschaftlichkeit und ähnliches, die von den bürgerlichen Aufklärern propagiert werden, stehen in bewußtem Widerspruch zur Lebensweise des Adels.
Die Literatur wird als Werkzeug der Erziehung angesehen (vor allem in der Frühaufklärung) um den bürgerlichen Menschen aufzuklären und moralisch zu stärken. „Prodesse et delectare“ (dt.: Nutzen und Vergnügen) werden zu den Stichwörtern der Literatur der Aufklärung und bezeichnen ganz allgemein die Methode mit der die Ideen der Aufklärung vermittelt werden. Besonders in der Frühaufklärung wird im belehrenden Vergnügen und in einer Verbesserung der Moral die Kunst der Literatur gesehen.28
4.3 Philosophischer Hintergrund
Das zentrale Motiv der Aufklärung, die Vernunft meint, daß das ganze menschliche Verhalten geplant und begründet sein soll und als Endzweck das vollkommene Glück der Menschen steht. Die menschliche Vernunft könnte durch logische Schlüsse (rational) und die Erfahrung der Sinne (empirisch) alle Probleme des Lebens lösen. Die Vorbilder dieser Denkmethode kommen aus England (Empirismus) und Frankreich (Rationalismus); ihre wichtigsten Vertreter sind Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, René Descartes und Voltaire. Der Empirismus sieht in der Beobachtung von Vorgängen und der Sinneswahrnehmung die Quelle der Erkenntnis. Der Rationalismus hält die menschliche Vernunft für maßgeblich für die Erkenntnis.29
René Descartes, der Begründer des Rationalismus, drückt seine Denkschule durch „Ich denke also bin ich“ radikal aus. Er begreift den menschlichen Geist als einzige nicht zu bezweifelnde Größe.
4.4 Zusammenhänge des 18. Jahrhunderts und der „Insel Felsenburg“
Die Insel Felsenburg ist ein für die Aufklärung typischer Roman. Das Stichwort ‚Nutzen und Vergnügen‘ ist in Schnabels Werk deutlich herauszulesen. Es ist ein Faktum, daß alle unredlichen Menschen, die versuchen sich auf der Insel zu etablieren, schon von Anfang an scheitern, sterben, oder sie gelangen erst gar nicht auf die Insel.
Fremde und neu Gestrandete werden äußerst kritisch aufgenommen und müssen die Vorsicht und das Mißtrauen der Bewohner überwinden, bevor sie in der Inselgemeinschaft respektiert werden.
Zu Beginn müssen alle Neuankömmlinge ihre Lebensgeschichte erzählen und Schnabel integriert diese durch 22 Autobiographien europamüder Auswanderer, die das süße Leben im Insel- Eldorado aufs schärfste kontrastieren.
5. Zusammenfassung
Die „Insel Felsenburg“ ist ein protestantischer, der frühen Aufklärung typischer Roman, der ein gültiges Vollbild der Jahre zwischen 1710 und 30 aufzeigt.
Sie offenbart eine soziale Idylle, in der die Menschen in aller Frömmigkeit, Liebe und Einigkeit miteinander leben, und nach dem Exempel der ersten christlichen Kirche eine treuherzige Gemeinschaft gründen. Kein Eigennutz, auch nicht im allergeringsten Sinne wird von den Inselbewohnern gezeigt, sondern sie dienen ihren Nächsten und sich selbst wobei jegliche Arbeit mit Lust verrichtet wird.
Die Religion, die die Lebensgrundlage der Romanfiguren darstellt, greift sowohl in das Berufsleben, als auch in den privaten Bereich ein und bietet eine Art ‚Ersatzpolitik‘. Es muß nichts gesetzlich festgelegt werden, da die Bürger durch die Religion schon so diszipliniert agieren, daß eine autoritäre Führung gänzlich überflüssig ist.
Die Insulaner sind von so einer tiefen Gottesfurcht durchdrungen, daß sie selbst entscheiden ob etwas unrecht oder tugendhaft ist. Sie brauchen keine Justiz, da die reinen und ehrlichen Bewohner, die durch den Überfluß an Nahrungsmitteln keine Not leiden müssen, keine Verbrechen begehen die aus Notsituationen heraus geschehen.
Gewaltverbrechen oder ähnliches werden durch die tiefe Gottesfurcht erst gar nicht zur Debatte, da ein harmonisches, glückliches Leben im Einklang mit dem protestantischen Glauben angestrebt wird.
Aus dem Umstand heraus, daß weitgehend ein klassenloses Leben geführt wird und der aristokratische Prunk des alten Europa gänzlich fehlt, können Gefühle wie Neid und Habgier erst gar nicht aufkommen.
Politik und Religion sind also stark miteinander verwoben und man kann diese deswegen nicht Separat betrachten sondern stellen eine Symbiose dar.
LITERATURVERZEICHNIS:
Afhüppe, Sven: Gottgewollter Reichtum. Max Weber: Die protestantische Ethik; in: Die Zeit Nr. 34/1999
Bünting, Karl- Dieter: Deutsches Wörterbuch. Chur/ Schweiz: Isis Verlag 1996.
Guttandin, Friedhelm: Einführung in die „Protestantische Ethik“ Max Webers. Opladen: Westsdt. Verlag 1998.
Lessnoff, Michael: The Spirit of Capitalism and the Protestant Ethic - An Enquiery into the Weber Thesis. Cambridge: University Press 1994, S. 5
Rainer, Gerald: Stichwort Literatur. Linz: Landesverlag 1995.
Schnabel, Johann Gottfried: Insel Felsenburg. Stuttgart: Reclam 1998.
Tenbruck, Friedrich: Nachwort; in Max Weber: Wissenschaft als Beruf. Stuttgart: Reclam 1995
Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. I. 1988 (Unvollständige bibliographische Angaben!!)
http://www.fulgura.de/etc/kapitel2.htm, 22.12.2000
http://www.unibabenberg.de/~ba5sgl/lehre/ws9596kuck/webtit2.htm, 22.12. 2000
[...]
1 Vgl.: Karl- Dieter Bünting: Deutsches Wörterbuch. Chur/ Schweiz: Isis Verlag 1996, S.1231
2 Vgl.: ebd.
3 Vgl.: Sven Afhüppe: Gottgewollter Reichtum. Max Weber: Die protestantische Ethik; in: Die Zeit Nr. 34/1999 S.17
4 Vgl.: http://www.unibabenberg.de/~ba5sgl/lehre/ws9596kuck/webtit2.htm, 22.12. 2000
5 Vgl.: Friedrich Tenbruck: Nachwort; in Max Weber: Wissenschaft als Beruf. Stuttgart: Reclam 1995, S. 52
6 Johann Gottfried Schnabel: Insel Felsenburg. Stuttgart: Reclam 1998, S. 257
7 Vgl.: Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. I. 1988 (Unvollständige bibliographische Angaben!!) S. 71
8 Vgl.: ebd. S. 76ff.
9 Johann Gottfried Schnabel: Insel Felsenburg. Stuttgart: Reclam 1998, S. 222
10 http://www.unibabenberg.de/~ba5sgl/lehre/ws9596kuck/webtit2.htm, 22.12.2000
11 Johann Gottfried Schnabel: Insel Felsenburg. Stuttgart: Reclam 1998, S. 177
12 Johann Gottfried Schnabel: Insel Felsenburg. Stuttgart: Reclam 1998, S. 216
13 http://www.unibabenberg.de/~ba5sgl/lehre/ws9596kuck/webtit2.htm, 22.12.2000
14 Johann Gottfried Schnabel: Insel Felsenburg. Stuttgart: Reclam 1998, S. 210
15 Vgl.: Michael Lessnoff: The Spirit of Capitalism and the Protestant Ethic - An Enquiery into the Weber Thesis. Cambridge: University Press 1994, S. 5
16 Johann Gottfried Schnabel: Insel Felsenburg. Stuttgart: Reclam 1998, S. 364
17 Vgl.: Friedhelm Guttandin: Einführung in die “Protestantische Ethik” Max Webers. Opladen [ u.a.]: Westdeutscher Verlag 1998, S. 138
18 Vgl.: Friedhelm Guttandin: Einführung in die “Protestantische Ethik” Max Webers. Opladen [ u.a.]: Westdeutscher Verlag 1998 S. 138
19 Vgl.: ebd. S. 138f.
20 Johann Gottfried Schnabel: Insel Felsenburg. Stuttgart: Reclam 1998, S. 212
21 Johann Gottfried Schnabel: Insel Felsenburg. Stuttgart: Reclam 1998, S. 236
22 Vgl .: http://www.unibabenberg.de/~ba5sgl/lehre/ws9596kuck/webtit2.htm, 22.12.2000
23 Vgl.: ebd.
24 Vgl.: http://www.unibabenberg.de/~ba5sgl/lehre/ws9596kuck/webtit2.htm, 22.12. 2000
25 Johann Gottfried Schnabel: Insel Felsenburg. Stuttgart: Reclam 1998, S. 373
26 Johann Gottfried Schnabel: Insel Felsenburg. Stuttgart: Reclam 1998, S. 325
27 http://www.fulgura.de/etc/kapitel2.htm, 22.12.2000
28 Vgl.: Gerald Rainer: Stichwort Literatur. Linz: Landesverlag 1995, S. 72
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Dokuments "Insel Felsenburg"?
Das Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter der "Insel Felsenburg" enthält. Es analysiert Themen im Zusammenhang mit Religion, Politik und Philosophie im Werk von Johann Gottfried Schnabel.
Was sind die Hauptthemen, die in der "Insel Felsenburg" behandelt werden?
Die Hauptthemen umfassen Definitionen und Allgemeines zur Utopie, Religion (insbesondere Protestantismus, Berufsidee nach Weber, Prädestinationsglaube, Herausbildung von Freikirchen), Politik, Johann Gottfried Schnabels Leben und Wirken, Schnabels Zeit, philosophischer Hintergrund und Zusammenhänge der "Insel Felsenburg" mit ihrer Zeit.
Wie wird der Begriff "Utopie" im Dokument definiert?
Der Begriff "Utopie" stammt vom griechischen Wort "ou topos" und bedeutet "kein Ort" bzw. "Nichtort". Inhaltlich spiegelt eine Utopie die Schilderung eines erdachten, erhofften oder befürchteten, nirgends realisierten Gesellschaftszustands wider.
Wie wird die Rolle der Religion in der "Insel Felsenburg" dargestellt?
Die Bewohner der "Insel Felsenburg" werden als tief religiöse Menschen dargestellt, deren Leben stark vom Protestantismus geprägt ist. Der Glaube durchdringt alle Lebensbereiche und dient als Basis für ihre Entscheidungen und Verhaltensweisen.
Was ist die Bedeutung der Berufsidee nach Weber in Bezug auf die "Insel Felsenburg"?
Der Protestantismus wertete die tägliche Arbeit sittlich auf. Der Beruf wurde zur Aufgabe und Erfüllung des Lebens, zu einer von Gott zugeteilten Verpflichtung zum sittlichen Wirken in der Welt. Dies spiegelt sich in der Erziehung der Kinder und der fleißigen Arbeit der Inselbewohner wider.
Wie wird der Prädestinationsglaube in der "Insel Felsenburg" dargestellt?
Der kalvinistische Prädestinationsglaube, der lehrt, dass Gott einige zur Seligkeit und andere zur Verdammnis vorherbestimmt hat, beeinflusst die Wahrnehmung der Charaktere. Die "unelected" werden von Anfang an als gottlos dargestellt.
Inwiefern kann die "Insel Felsenburg" als eine Art Freikirche betrachtet werden?
Die "Insel Felsenburg" kann als eigenständige Freikirche gesehen werden, da sie unabhängig von Importen eine freie Religionsgemeinschaft bildet. Dies spiegelt die Ablehnung von Amtshierarchien und die Betonung der Egalität in einigen protestantischen Strömungen wider.
Wie wird die Politik in der "Insel Felsenburg" dargestellt?
Die "Insel Felsenburg" wird als eine Art kommunistische Urgemeinschaft unter einem sanften patriarchalischen Regiment beschrieben. Im Gegensatz zu Europa, das für Korruption und Intoleranz steht, stellt die Insel eine Fluchtutopie dar.
Wer war Johann Gottfried Schnabel und was war seine Zeit?
Johann Gottfried Schnabel war ein Vertreter der Frühaufklärung, die eine gesamteuropäische Bewegung war. Seine Zeit war geprägt von dem Bestreben, die Welt mit Hilfe der Vernunft zu begreifen und ein moralisches und tugendhaftes Leben zu führen.
Wie hängen die philosophischen Hintergründe der Aufklärung mit der "Insel Felsenburg" zusammen?
Die zentralen Motive der Aufklärung, wie Vernunft und Glück der Menschen, spiegeln sich in der "Insel Felsenburg" wider. Das Stichwort 'Nutzen und Vergnügen' ist deutlich herauszulesen, und unredliche Menschen scheitern im Roman.
- Arbeit zitieren
- Christina Tropper (Autor:in), 2001, Religion und Politik in Schnabels `Insel Felsenburg`, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102658