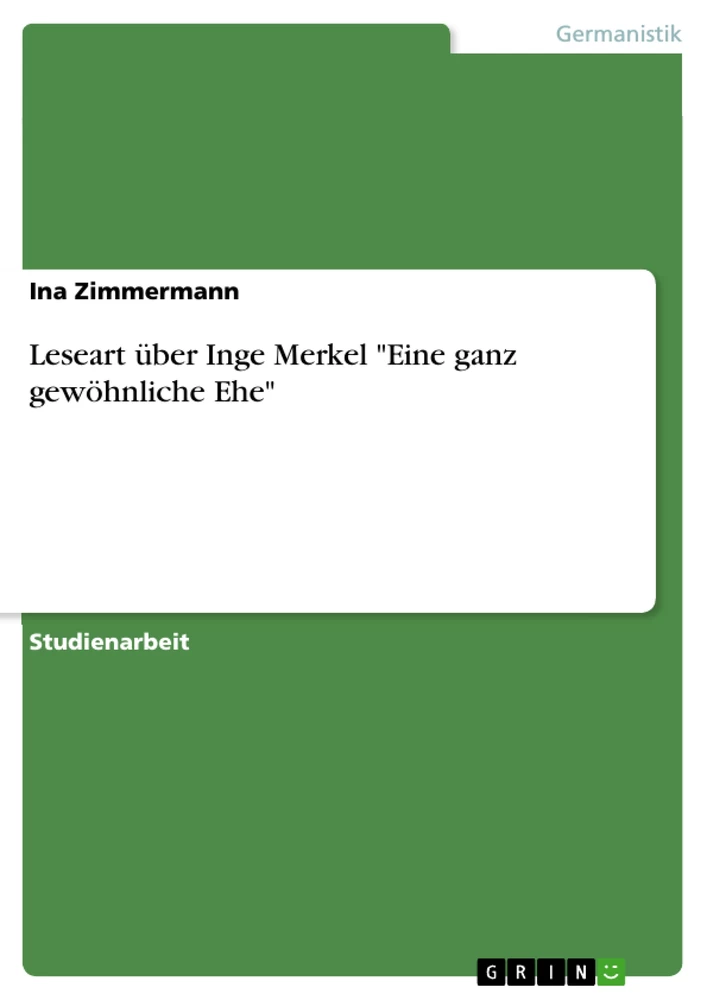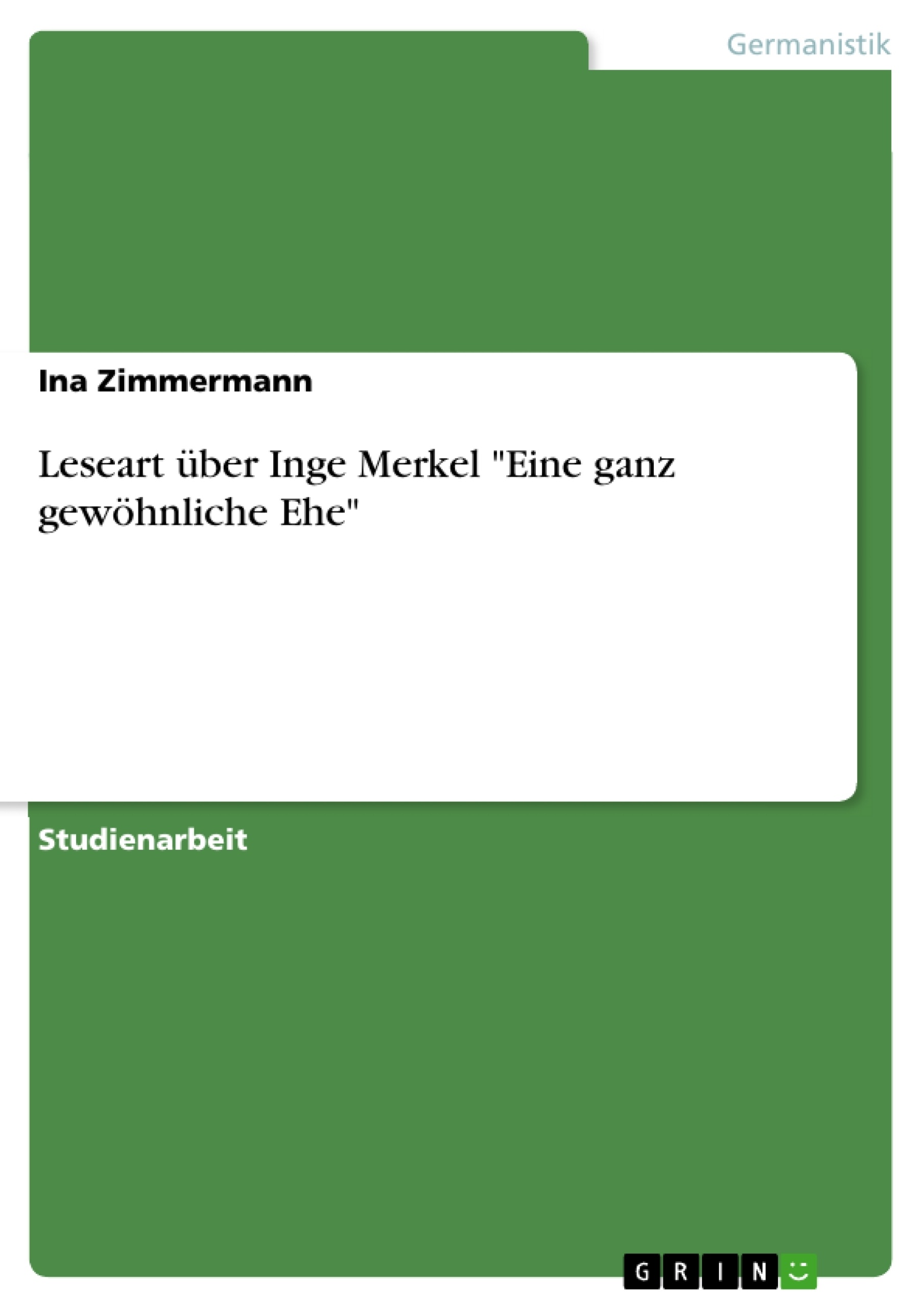Eine Lesart über das Buch:
„Eine ganz gewöhnliche Ehe; Odysseus und Penelope“ von Inge Merkel
Wieder ein neuer Versuch den Mythos von Odysseus und Penelope in unsere Gegenwart zu rücken. Doch was hat dieses Buch für eine Hintergrundaussage?
Ich betrachte zunächst erst einmal den Titel.
Sollte das eine Aussage über den Inhalt dieses Buches sein? Was ist eine ganz gewöhnliche Ehe überhaupt? Vielleicht wenn Partnerin und Partner in ihre gesellschaftlich vorgeformten Rollen schlüpfen, als Ehefrau und Ehemann ihre Aufgaben nicht nur gut, sondern auch mit Überzeugung erfüllen?
Während des Lesens des Buches hat sich allerdings eine andere Meinung in mir entwickelt, aus der Perspektive ist die Ehe von Odysseus und Penelope nämlich nicht sehr gewöhnlich. Ich stelle nun die Frage: Hat Inge Merkel den Titel selbst gewählt oder war es eine Korrektur des Verlages?
Während zu Beginn des Textes zwar die Charakterzüge der jeweiligen Figuren vorgestellt werden, wird Penelope als sehr führsorglich und kinderliebend beschrieben. Doch ihr großer Gebärwunsch wird letztendlich nicht erfüllt. Penelope ist eine Frau, die für mein Empfinden nicht wirklich in die Rolle einer „normalen“ Fürstin passt. Sie beschäftigt sich mit den Dingen einer Bauersfrau, hilft im Stall, übt Landarbeit aus und geht der Erziehung ihres Kindes Telemach nach. Sie ist bemüht, aus Telemach einen stattlichen Mann zu machen. Ist sogar bekümmert darüber, dass Odysseus, als Vater, die Erziehung seines Sohnes im Kämpfen und Fechten et cetera, nicht war nimmt. Penelope setzt sich also von der ursprünglichen Rolle als Fürstin ab.
Was aber geschieht mit Odysseus? Nimmt er in diesem Buch die Rolle als Ehegatte war?
Schließlich ist er immerhin zwanzig Jahre, nachdem er grade erst ein Jahr mit Penelope vermählt ist und ein Kind gezeugt hat, unterwegs, seinen „Mann zu stehen“.
Er schafft es nicht, seine Frau wenigstens einmal nach ihren Wünschen zu fragen und sie zu erfüllen oder zu versuchen, diese zu erfüllen.
Von Beginn an von Eurykleia geleitet, gelangt Penelope, gewollt oder aufgezwungen, in die Figur der immer einstecken müssenden Ehefrau. Ob sich ihr Verhalten über die ganze Ehe hinweg als günstig für sie erweist, wage ich zu bezweifeln. In den zwanzig Jahren der Einsamkeit macht Penelope einen langen Entwicklungsprozess durch, so dass sie sich später aus eigenem Willen zu ihren Handlungen entschließt. Sie lässt Odysseus viel Spielraum, ich möchte fast sagen, seine Grenzen sind gar unbegrenzt, da er sich alles erlauben kann. Er betrügt Penelope in seiner Abwesenheit mehrmals und sie zeigt Verständnis, tröstet ihn über seine schlimmen Erfahrungen hinweg, frei nach dem Motto: Wer versteht, ist nicht sauer und kennt keine Eifersucht.
Die Frage nach der Rollenverteilung, wird dann auf Seite 264 ausführlich im Gespräch zwischen Odysseus und Penelope geklärt: „Du denkst wie eine Frau“, ereiferte sich Odysseus „...Mann im Bett, Kinder gemacht und aufgezogen...Wir Männer jedoch, wenn wir im Haufen sind, da denken wir anders.“
Bis zum Schluss der Ehe bleibt für Penelope die Frage offen: Hat Odysseus sie wirklich geliebt? Diese Antwort blieb ihr verwehrt. Dies könnte zwei Gründe haben, einerseits, da er sie wirklich nicht liebte, andererseits, weil er seine Liebe nicht in Worte fassen wollte, da es ihm zu allgemein geklungen hätte. Wie in einer ganz normale Ehe?
Außer der Diskussion um den Titel und die Rollenverteilung, gewehrt Inge Merkel dem Leser Einblick in die Geschehnisse, die Odysseus während seiner Abwesenheit von Ithaka wiederfahren sind, und dass aus Sicht des erzählenden Odysseus zu seiner Ehefrau selbst. Trotzdem der Leser durch die überwiegenden Erzählungen über Penelope und ihrem Schicksal von ihrer Rolle gefasst und mitgenommen wird, lässt die Autorin dem Leser doch noch eine Chance, die Figur Odysseus sympathisch zu finden oder wenigstens etwas Sympathie im Leser zu wecken.