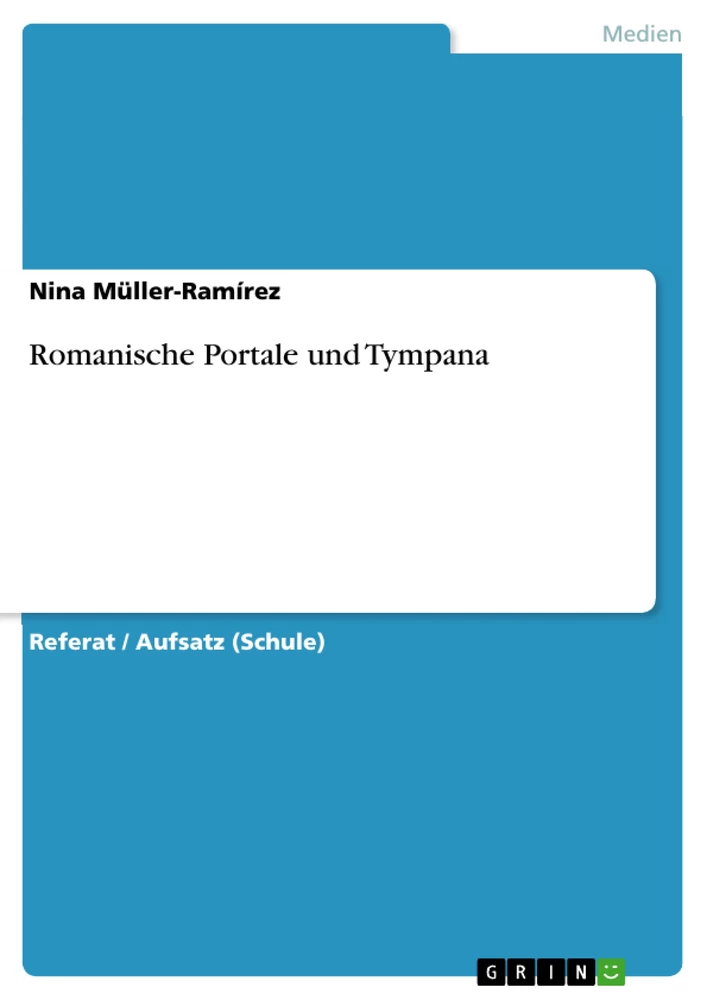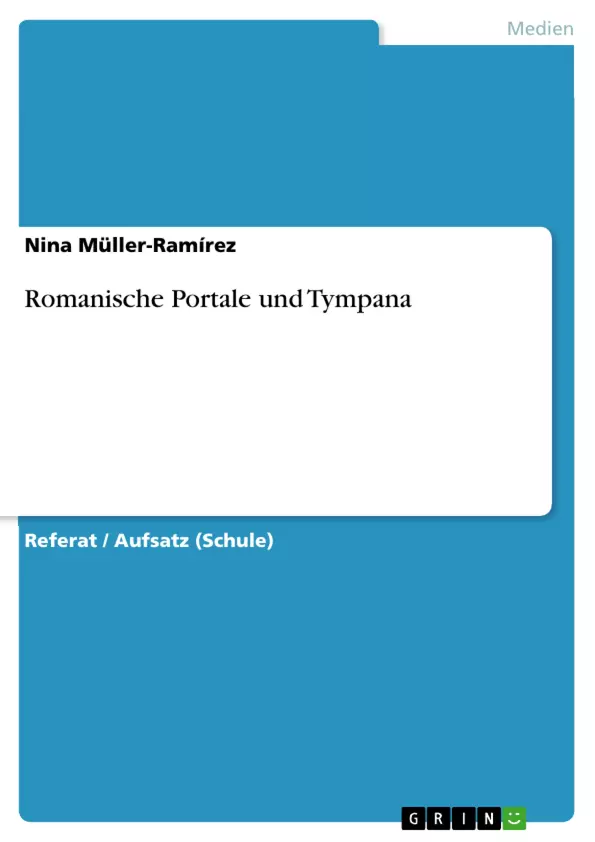Entdecken Sie die faszinierende Welt der romanischen Portale und Tympana, jener architektonischen Meisterwerke, die den Übergang vom Dunkel ins Licht symbolisieren und die spirituelle Essenz des Mittelalters verkörpern. Diese tiefgründige Analyse enthüllt, wie sich die Portale von bloßen Eingängen zu komplexen, dreidimensionalen Strukturen entwickelten, die die theologische und gesellschaftliche Botschaft ihrer Zeit widerspiegeln. Folgen Sie der spannenden Entwicklung von den schlichten Rahmen der Spätantike bis zu den reich verzierten Portalen des 12. Jahrhunderts, ein Wandel, der die Kirche nicht länger verschloss, sondern einlud und öffnete. Erforschen Sie den Einfluss römischer Triumphbögen und Stadttore auf die Gestaltung und bestaunen Sie die innovativen Archivolten und Tympana, die zu Leinwänden für biblische Szenen und moralische Lehren wurden. Tauchen Sie ein in die Ikonographie, die von Christusdarstellungen bis zu subtilen Hinweisen auf Kirchenpolitik reicht, und entdecken Sie, wie die romanischen Portale nicht nur den Eingang zum Gotteshaus schmückten, sondern auch als Verkündiger des Glaubens und Spiegelbild der städtischen Identität dienten. Analysiert wird die Verbreitung dieser architektonischen Innovation, von Südfrankreich, wo die Bogenfelder im Mittelpunkt standen, bis nach Westfrankreich, wo die Archivolten dominierten. Enthüllt werden die subtilen Unterschiede und die vielfältigen regionalen Ausprägungen, die die romanische Kunst so reichhaltig und faszinierend machen. Untersucht werden die Einflüsse und die Ablehnung byzantinischer Vorbilder. Lassen Sie sich entführen in eine Welt, in der Stein zum Leben erwacht und die Portale zu lebendigen Zeugnissen einer vergangenen Epoche werden, die bis heute unsere Wahrnehmung von Kunst, Architektur und Spiritualität prägt. Dieses Buch ist ein Muss für jeden, der sich für Kunstgeschichte, Architektur des Mittelalters und die tiefere Bedeutung sakraler Räume interessiert, ein Schlüssel zum Verständnis der romanischen Seele und ihrer unvergänglichen Schönheit, von St-Sernin in Toulouse bis zu den Gewänden des Hauptportals in Vézelay. Die romanischen Portale, ein Fenster in eine andere Welt, ein Spiegel der mittelalterlichen Gesellschaft und ein Denkmal für die menschliche Kreativität und den Glauben.
ROMANISCHE PORTALE UND TYMPANA
Nina Müller, 19.Mai 1999
Die Ausbreitung des romanischen Stils wurde stark von der durchgreifenden Veränderung der Portale bestimmt.
Schon in der Spätantike und in Byzanz war man bemüht, die beweglichen Flächen der Tür , das wesentliche Element, zu rahmen. Im Portalrahmen dominierte die Idee der Geschlossenheit während die Türflügel geschmückt waren. Dieses Prinzip galt auch noch für die Portale des 11. Jh. (St. Maria im Kapitol - Köln ; San Zeno -Verona)
In der Romanik ging man aber zu einem völlig anderen Konzept über: Das Portal sollte die Kirche nicht verschließen , sondern sie öffnen. Es dehnte sich räumlich aus und wurde zu einem Bauwerk innerhalb des Bauwerkes.
Um 1090, als in St-Sernin in Toulouse zwei identische Querhausportale entstanden , fand anscheinend der entscheidende Wandel statt. Vorbilder waren möglicherweise römische Triumphbögen und Stadttore. Neu waren die vielen, übereinander liegenden Archivolten (konzentrische Bögen), die den Tympanon (Bogenfeld) rahmten. Im Gewände entsprechen ihnen rechteckige Stufen und Säulchen. Auch Skulpturen eroberten die Portale, beschränkten sich jedoch auf Kapitelle und Reliefplatten der Fassaden.
Eine weitere Stufe der Entwicklung wurde mit dem Übergriff der figürlichen Plastik auf das Tympanon erreicht. Auf der Forschung nach den Ursprüngen des skulptierten Bogenfeldes bezogen sich einige Forscher auf den Kaukasus, dessen christlichen Gemeinden die Tympana ihrer Kirchen schon recht früh plastisch geschmückt zu haben scheinen. Ein Zusammenhang zwischen der ostchristlichen und der romanischen Kunst konnte aber nicht festgestellt werden. Auch Bezüge auf byzantinische Vorbilder waren nicht zu belegen , da man in Byzanz zwar die Tympana figürlich ausstattete, dies jedoch in Form von Mosaiken tat , einer Technik , die in Westeuropa seit karolingischer Zeit nicht mehr gebräuchlich war.
Die romanischen Tympana entstanden aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Idee, den Eingang zum Gotteshaus mit Christus selbst gleichzusetzen. Zur gleichen Zeit (1110/20) entstanden Darstellungen Gottes über den Portalen , um ihre Bedeutung zu unterstreichen. Selbst ein Zeichen, das Christus vertreten sollte zeigte das Göttliche darin. Über Jesus, den Sohn Gottes , der durch seine Inkarnation darstellbar war, bildete man den Ruhm und die Herrlichkeit Gottes, des Vaters ab. Vorbilder dafür waren die feierlichen Apsisfresken, die in der europäischen Malerei schon üblich waren. Auch die Rundbögen und Archivolten der romanischen Portale erinnern an dieApsiskalotten.
Die Inhalte der Darstellungen sind jedoch nicht völlig gleich. Durch die Nähe zum Altar sollte die Apsis zu liturgischen und eucharistischen Themen laden. Das Portal, das alle Gläubigen passieren mußten, bot Gelegenheit moralische und Glaubenslehren zu verkünden oder sogar Gedanken über die Kirchenpolitik einfließen zu lassen. Darauf wollte man natürlich nicht verzichten.
Das romanische Portal verbreitete sich auf Grund seiner Erfolge sehr rasch. Daraus folgte ein immer größer werdender Schmuckreichtum und eine immer komplexere Ikonographie. Das Bildprogramm dehnte sich auf den Türsturz aus und teilweise auch auf die Archivolten, die aber größtenteils den Bildhauern der Gotik überlassen wurden. In Südfrankreich schenkte man alle Aufmerksamkeit den Bogenfeldern und beachtete die Archivolten kaum, während man sich diesen in Westfrankreich mehr zuwandte und die Tympana meist leer ließ.
Letztendlich wurden , wie oben angedeutet, auch die Stufen und Säulen des Portals von der Plastik erfaßt. Man nahm damit die Gestaltung der Kreuzgangspfeiler wieder auf , schaffte jedoch auch originellere Lösungen: Figuren an den Kanten der Portalstufen. Diese Erfindung ist zwei Bildhauern aus Norditalien und Südwestfrankreich zuzuschreiben. Vertreter dieses Portaltyps sind z.B. die Portale von St-Bernard in Romans, die Galluspforte am Basler Münster und die Gewände des Hauptportals in Vézely.
Sehr bald nahm man sich auch der Säulen an , wie z.B. in Santiago de Compostela. Teilweise inspirierte man sich an römischen Vorbildern, teilweise verfuhr man ganz frei und vermischte die linearen und floralen Ornamente sogar mit kleinen Figuren. Die Säulenfigur, der Ersatz der Säule durch Figuren , entstand aber erst in der Frühgotik.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "ROMANISCHE PORTALE UND TYMPANA"?
"ROMANISCHE PORTALE UND TYMPANA" behandelt die Entwicklung und Bedeutung romanischer Portale und Tympana in der Architektur des 11. und 12. Jahrhunderts. Der Text beschreibt, wie sich die Portale von einfachen Rahmen zu komplexen Bauwerken innerhalb von Kirchen entwickelten, insbesondere durch die Integration von Skulpturen und ikonographischen Darstellungen.
Wie unterschieden sich romanische Portale von früheren Portalgestaltungen?
Im Gegensatz zu früheren Portalgestaltungen, die primär auf Geschlossenheit und Rahmung der Tür abzielten, sollten romanische Portale die Kirche öffnen. Sie dehnten sich räumlich aus und integrierten Archivolten, Gewände und schließlich auch Skulpturen, wodurch sie zu einem integralen Bestandteil der Fassade wurden.
Welche Rolle spielten die Tympana in der romanischen Portalgestaltung?
Die Tympana, die Bogenfelder über den Portalen, wurden zu wichtigen Flächen für figürliche Darstellungen. Diese Darstellungen, die oft Christus oder andere religiöse Motive zeigten, dienten dazu, die Bedeutung des Eingangs zum Gotteshaus zu unterstreichen und moralische sowie Glaubenslehren zu vermitteln.
Woher stammen die Ursprünge der skulptierten Tympana?
Die Ursprünge der skulptierten Tympana sind nicht eindeutig geklärt. Einige Forscher vermuteten Einflüsse aus dem Kaukasus, aber ein direkter Zusammenhang konnte nicht nachgewiesen werden. Auch byzantinische Vorbilder waren nicht belegbar, da dort Tympana eher mit Mosaiken geschmückt wurden.
Wie verbreitete sich das romanische Portal und welche Entwicklungen folgten daraus?
Das romanische Portal verbreitete sich aufgrund seines Erfolgs schnell, was zu einem immer größer werdenden Schmuckreichtum und einer komplexeren Ikonographie führte. Das Bildprogramm dehnte sich auf den Türsturz und teilweise auch auf die Archivolten aus. Regionale Unterschiede zeigten sich in der Betonung von Bogenfeldern oder Archivolten.
Welche Rolle spielten Säulen und andere architektonische Elemente in der romanischen Portalgestaltung?
Auch die Säulen und Stufen der Portale wurden zunehmend von der Plastik erfasst. Figuren wurden an den Kanten der Portalstufen platziert, und Säulen wurden mit linearen, floralen oder figürlichen Ornamenten geschmückt. Die Säulenfigur, der Ersatz der Säule durch Figuren, entstand jedoch erst in der Frühgotik.
Welche Bedeutung hatte die Westfassade mit dem Portal für den Kirchenbau?
Der Bau einer Kirche wurde meist mit der Westfront gegenüber dem Chor abgeschlossen, da das liturgische Zentrum der Kirche vorrangig behandelt wurde. In italienischen Kirchen begann man den Bau oft gleichzeitig an Chor und Westfassade, da dort die Kirchen in den städtischen Rahmen und dessen Dekor eingebunden wurden.
- Arbeit zitieren
- Nina Müller-Ramírez (Autor:in), 1998, Romanische Portale und Tympana, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102675