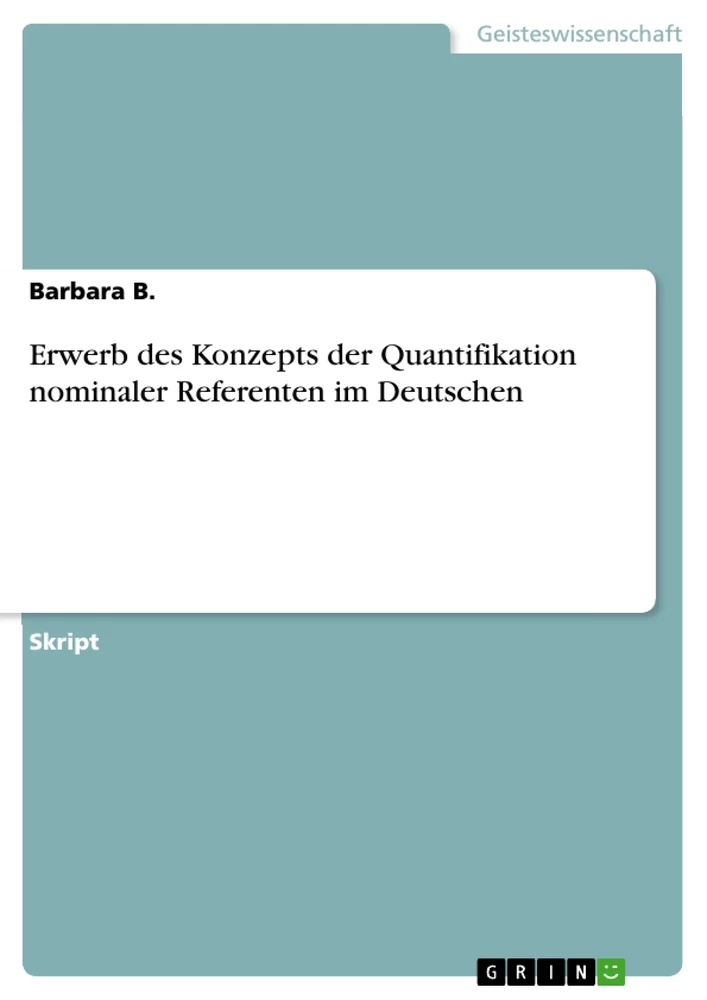Erwerb des Konzepts der Quantifikation nominaler Referenten im Deutschen
Zusammenfassung eines Artikels von Dagmar Bittner
Der Artikel behandelt den Erwerb des Konzepts der Quantifikation nominaler Referenten im Deutschen. Bei 9 Kindern wurde dieser Erwerb verfolgt. Man stellte fest, dass die Quantoren (ein, kein, mehr, viele, zwei, drei) in einer bestimmten Reihenfolge erworben werden. Dabei nimmt man an, dass sich nach und nach ein Konzept der Quantifikation nominaler Referenten in der kindlichen Grammatik entfaltet.
Quantoren weisen sowohl semantische als auch funktionale Aspekte auf, zwischen denen differenziert werden muss. Dies stellt eine kognitive Leistung dar, die den Erwerbsprozess beeinflusst und zudem universell ist. Alle Sprachen verfügen also über Mittel zum Ausdruck von Quantifikation.
Forschungsstand:
Bisherige Befunde zeigen, dass erste sprachliche Ausdrücke für Quantoren mit etwa 1;6 erworben sind. Diese ersten quantifizierenden Aktivitäten beschränken sich auf Zusammenfassung/Gruppierung von Objekten mit ähnlichen Eigenschaften und das Erkennen und Wiederholen von Eigenschaften. Später werden auch Wiederholungen von Handlungen, Vergrößerungen von Mengen und das Verschwinden von Objekten sprachlich ausgedrückt. Bei diesen ersten Aktivitäten fehlt jedoch die numerale Quantifikation von Gegenständen sowie ihre direkte sprachliche Manifestation in Form eines mit einem Quantor verbundenen Nomens (Bsp.: viele Hunde). Man nimmt an, dass dem Erwerb von grammatisch-funktionalen Einheiten der Erwerb sogenannter „grammaticizable notions“ (grammatikalisierbare Begriffe) vorausgeht, die auf universellen kognitiven Wahrnehmungskategorien beruhen (Lokalisation, Temporalität etc.). Erst wenn diese Wahrnehmungskategorien in „grammaticizable notions“ übergeführt wurden, können grammatisch-funktionale Einheiten erworben werden.
Der Erwerb dieser grammatisch-funktionalen Einheiten geschieht über mehrere Etappen hinweg, wobei die Fähigkeit zwischen Inhaltswörtern und Funktorenwörtern zu unterscheiden laut Slobin auf eine angeborene Eigenschaft zurückzuführen ist. Bevor ein Kind die „grammaticizable notions“ richtig in die Sprache umsetzt, muss es spezifische Strukturmuster erkennen. Im Deutschen erfolgt die Quantifikation nominaler Referenten durch die Verbindung des Nomens mit einem quantifizierenden Begleiter. Das Kind muss also das strukturelle Grundmuster der NP erkennen, damit es die Quantifikation von Objekten sprachlich eindeutig und richtig markieren kann.
Der Aufbau der Grammatik verläuft von weniger komplexen zu stärker komplexen Kategorien und Strukturen. Der erste Begleiter, der dem Nomen systematisch zugeordnet wird, ist der unbestimmte Artikel. Ihm folgen weitere Funktionswörter sowie Adjektive, bis schließlich der Übergang zur Verwendung dreigliedriger NP erfolgt. Es ist also eine geordnete Reihenfolge zu erkennen. Bsp.: ein Haus - rotes Haus - das Haus - das rote Haus. Bezüglich der Quantifikation wurde ein ähnlicher Prozess beobachtet. Man nimmt an, dass mit dem Erwerb des unbestimmten Artikels nicht nur die strukturelle Entfaltung der NP und der Erwerb weiterer referenzspezifizierender Einheiten eingeleitet wird, sondern zugleich auch die Einbettung von quantifizierenden Einheiten (Quantoren) in die NP. Die These ist also folgende: Der Erwerb des unbestimmten Artikels leitet die Entfaltung des Konzepts der Quantifikation in der kindlichen Grammatik ein. Die in einer geordneten Abfolge in der NP erscheinenden Quantoren, konstituieren dabei einen relativ eigenständigen semantisch und funktional strukturierten Bereich des Lexikons.
Methode:
9 Mädchen aus dem Raum Düsseldorf im Altersbereich von 1;11 bis 2;10 wurden in interaktiven Spielsituationen mit einem Erwachsenen (Interviewer) aufgenommen. Von jedem Kind liegen zwischen 6 und 15 Aufnahmen vor, die in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen vorgenommen wurden.
Analyse:
Neben der Entfaltung der Referenzfunktionen der NP werden im Anschluss an den Erwerb des unbestimmten Artikels auch die Possession und die Quantifikation nominaler Referenten entfaltet. In der Possession ist der Erwerbsverlauf bis 3;0 sehr klar: (ein + Nomen) > mein + Nomen > dein (+ Nomen) > unser (+ Nomen). Die Formen zur Quantifikation des nominalen Referenten sind zahlreicher, und es lässt sich auf den ersten Blick keine einheitliche Erwerbsreihenfolge feststellen. Ein wird als Auslöser für den Erwerb weiterer quantifizierender Einheiten in der NP angenommen. Die Form ein hat sowohl referenzspezifizierende (primär) als auch quantifizierende (sekundär) Eigenschaften. Dass die quantifizierende Eigenschaft von ein sekundär ist, wird z. B. dadurch sichtbar, dass wir zusätzliche Hinweise aus dem Kontext benötigen, wenn eine quantifizierende Lesart zugeordnet werden soll. Zudem ist die quantifizierende Verwendungsweise von ein in der NP weitaus seltener.
Bei den Sprachdaten ergeben sich zwar starke individuelle Variationen. Diese dürften aber hauptsächlich auf die unterschiedlichen Aufnahmerhythmen zurückzuführen sein. Die Datensituation zeigt, dass die Quantoren des Nomens in folgender Reihenfolge erworben werden: ein < kein < mehr und/oder viele < zwei < drei.
Daraus ergibt sich: 1. Kinder, die zwei noch nicht mit dem Nomen verbinden, tun dies auch noch nicht mit drei. 2. Kinder, die mehr und/oder viele noch nicht in der NP verwenden, verwenden auch zwei und drei noch nicht in der NP.
Schrittweise Differenzierung des Quantifikationskonzepts:
Der festgestellte geordnete Erwerbsverlauf lässt sich als schrittweise Differenzierung und Spezifizierung quantitativer Eigenschaften nominaler Referenten interpretieren. Dies kann wiederum als die Entfaltung eines Konzepts der Quantifikation betrachtet werden.
Der Erwerb von ein impliziert primär die Abgrenzung des Bereichs der begrenzten Referenten von den unbegrenzten Referenten und sekundär die Abgrenzung des Bereichs der einzahligen von den nichteinzahligen Referenten.
Die Markierung der Einzahligkeit nominaler Referenten, also des Merkmals [+einzahlig] („ eins “), wird durch die lexikalische Einheit ein geleistet. Der damit ausgegrenzte Bereich „nicht eins“ wird sprachlich nicht speziell markiert.
Wichtig dabei ist, dass der Erwerb einer sprachlichen Einheit, die die Symbolisierung von Einzahligkeit einschließt, die konzeptuelle Abgrenzung zu allen Bereichen einschließt, in denen keine Einzahligkeit vorliegt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Differenzierung des Quantifikationskonzepts durch den Erwerb von ein
Auf den Erwerb von ein erfolgt typischerweise der Erwerb von kein. Der Bereich „weniger als eins“ wird damit durch eine spezielle lexikalische Form markiert. Gleichzeitig macht dies die Alternative „mehr als eins“ explizit und führt zu einer weiteren Differenzierung des Quantifikationskonzepts.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Differenzierung des Quantifikationskonzepts durch den Erwerb von kein
Der semantische und funktionale Zusammenhang von ein und kein kommt durch ihren engen Erwerbszusammenhang und ihre formale Ähnlichkeit zum Ausdruck. Beide Formen schließen die Existenz eines unbegrenzten, unabgeschlossenen nominalen Referenten aus.
Zur sprachlichen Symbolisierung des Bereichs „mehr als eins“ werden typischerweise die Quantoren meh r und/oder viele erworben. Dabei bleibt unklar, welche Dimension die Gesamtmenge und damit das Referenzobjekt besitzt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Differenzierung des Quantifikationskonzepts durch den Erwerb von mehr/viele
Mit mehr + N wird das Hinzukommen von Objekten oder Teilmengen zu bereits vorhandenen, unbestimmt großen Mengen von Objekten symbolisiert. Viele hingegen dient zur speziellen und voraussetzungslosen Symbolisierung unbegrenzter Mengen des nominalen Referenten. Zunächst werden mehr und viele allerdings alternativ, mit individuellen Präferenzen, genutzt.
Mit der Einbettung der Numeralia zwei und anschließend drei in die NP wird der durch mehr/viele ausgegrenzte Bereich der begrenzten „mehr als eins“-Menge sprachlich spezifiziert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Differenzierung des Quantifikationskonzepts durch den Erwerb von zwei
Zunächst erfolgt typischerweise der Erwerb von zwei als Symbolisierung für „eins mehr als eins“. Darauf erscheint dann drei als sprachliche Spezifizierung eines Ausschnitts des durch den Erwerb von zwei ausgegrenzten Bereichs „x mehr als eins“.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Differenzierung des Quantifikationskonzepts durch den Erwerb von drei
Der Erwerb der Verbindung von zwei und drei mit dem Nomen liegt deutlich vor der Verbindung weiterer, höherer Numeralia mit dem Nomen.
Zusammenfassung:
Der Erwerb des unbestimmten Artikels ein bildet den Ausgangspunkt für die
Entfaltung des Konzepts der Quantifikation nominaler Referenten in der kindlichen Grammatik. Ein ist primär Determinierer, aber sekundär zugleich Quantor. Die Markierung der Einzahligkeit des Referenten bewirkt die Ausgrenzung des Bereichs der nichteinzahligen Referenten. Mit der Form kein wird zunächst die Nichtexistenz des nominalen Referenten sprachlich darstellbar. Darauf folgt der Erwerb von mehr und/oder viele. Damit wird der von kein ausgegrenzte Bereich des Vorhandenseins mehrerer Entitäten des nominalen Referenten sprachlich markiert. Anschließend werden die Numeralia zwei und drei erworben, die der Symbolisierung konkret begrenzter Mengen dienen.
Häufig gestellte Fragen zu: Erwerb des Konzepts der Quantifikation nominaler Referenten im Deutschen
Worum geht es in diesem Artikel?
Der Artikel von Dagmar Bittner untersucht, wie Kinder im Deutschen das Konzept der Quantifikation nominaler Referenten erwerben. Es wird beobachtet, in welcher Reihenfolge Kinder Quantoren wie ein, kein, mehr, viele, zwei, drei lernen und wie sich dadurch ein Verständnis für Quantifizierung entwickelt.
Welche Quantoren werden in welcher Reihenfolge erworben?
Die Analyse der Sprachdaten von Kindern zeigt, dass die Quantoren tendenziell in folgender Reihenfolge erworben werden: ein < kein < mehr und/oder viele < zwei < drei.
Was bedeutet der Erwerb von "ein" für das Quantifikationskonzept?
Der Erwerb des unbestimmten Artikels ein markiert primär die Abgrenzung begrenzter Referenten von unbegrenzten Referenten. Sekundär wird damit auch der Bereich der Einzahligkeit von nicht-einzahligen Referenten abgegrenzt.
Wie differenziert der Erwerb von "kein" das Quantifikationskonzept?
Nach ein wird typischerweise kein erworben. Dies markiert den Bereich "weniger als eins" und macht gleichzeitig die Alternative "mehr als eins" explizit. Dadurch wird das Quantifikationskonzept weiter differenziert.
Welche Rolle spielen "mehr" und "viele" beim Erwerb von Quantoren?
Mehr und/oder viele werden zur sprachlichen Symbolisierung des Bereichs "mehr als eins" verwendet. Sie kennzeichnen unbestimmte Mengen und Objekte. Zunächst werden mehr und viele oft alternativ verwendet, bis eine genauere Differenzierung erfolgt.
Wie tragen "zwei" und "drei" zum Quantifikationskonzept bei?
Mit der Einbettung der Numeralia zwei und anschließend drei in die Nominalphrase wird der durch mehr/viele ausgegrenzte Bereich der begrenzten "mehr als eins"-Menge sprachlich spezifiziert. Zwei wird meist zuerst erworben, dann drei.
Was ist die Hauptthese des Artikels?
Die These ist, dass der Erwerb des unbestimmten Artikels ein die Entfaltung des Konzepts der Quantifikation in der kindlichen Grammatik einleitet. Die in einer geordneten Abfolge in der Nominalphrase (NP) erscheinenden Quantoren konstituieren dabei einen relativ eigenständigen semantisch und funktional strukturierten Bereich des Lexikons.
Welche Methode wurde bei der Untersuchung verwendet?
Neun Mädchen im Alter von 1;11 bis 2;10 Jahren wurden in interaktiven Spielsituationen mit einem Erwachsenen (Interviewer) aufgenommen. Von jedem Kind wurden zwischen 6 und 15 Aufnahmen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen gemacht.
Was ist das Fazit des Artikels?
Der Erwerb des Quantifikationskonzepts im Deutschen ist ein schrittweiser Prozess, der mit dem Erwerb von ein beginnt und durch die nachfolgende Aneignung von kein, mehr/viele, zwei und drei zu einer immer feineren Differenzierung quantitativer Eigenschaften nominaler Referenten führt.
- Arbeit zitieren
- Barbara B. (Autor:in), 2001, Erwerb des Konzepts der Quantifikation nominaler Referenten im Deutschen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102697