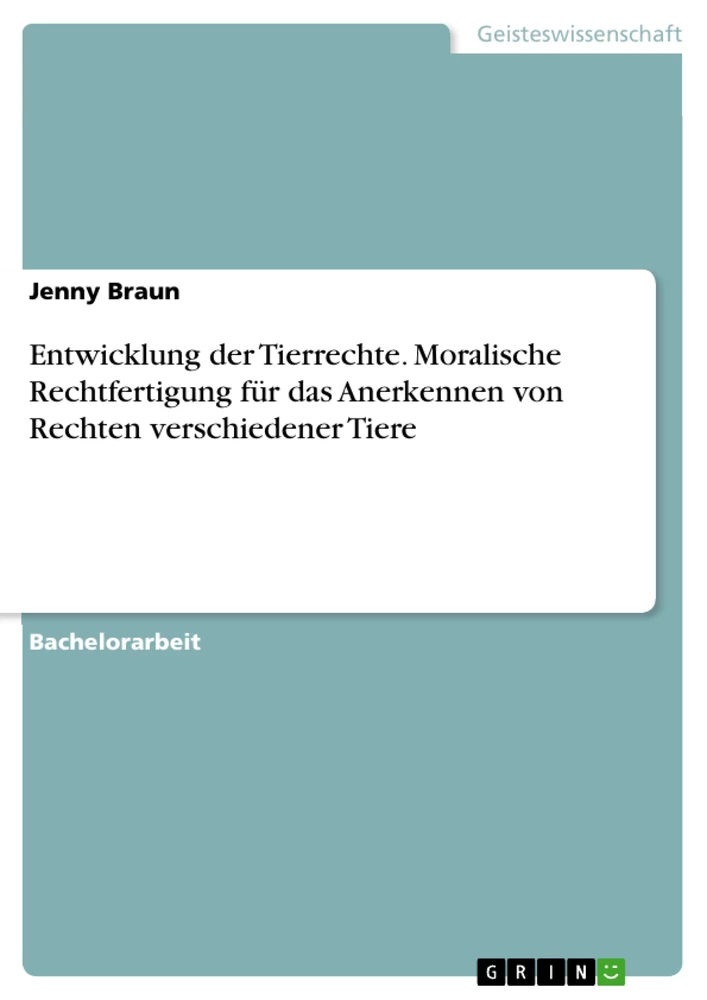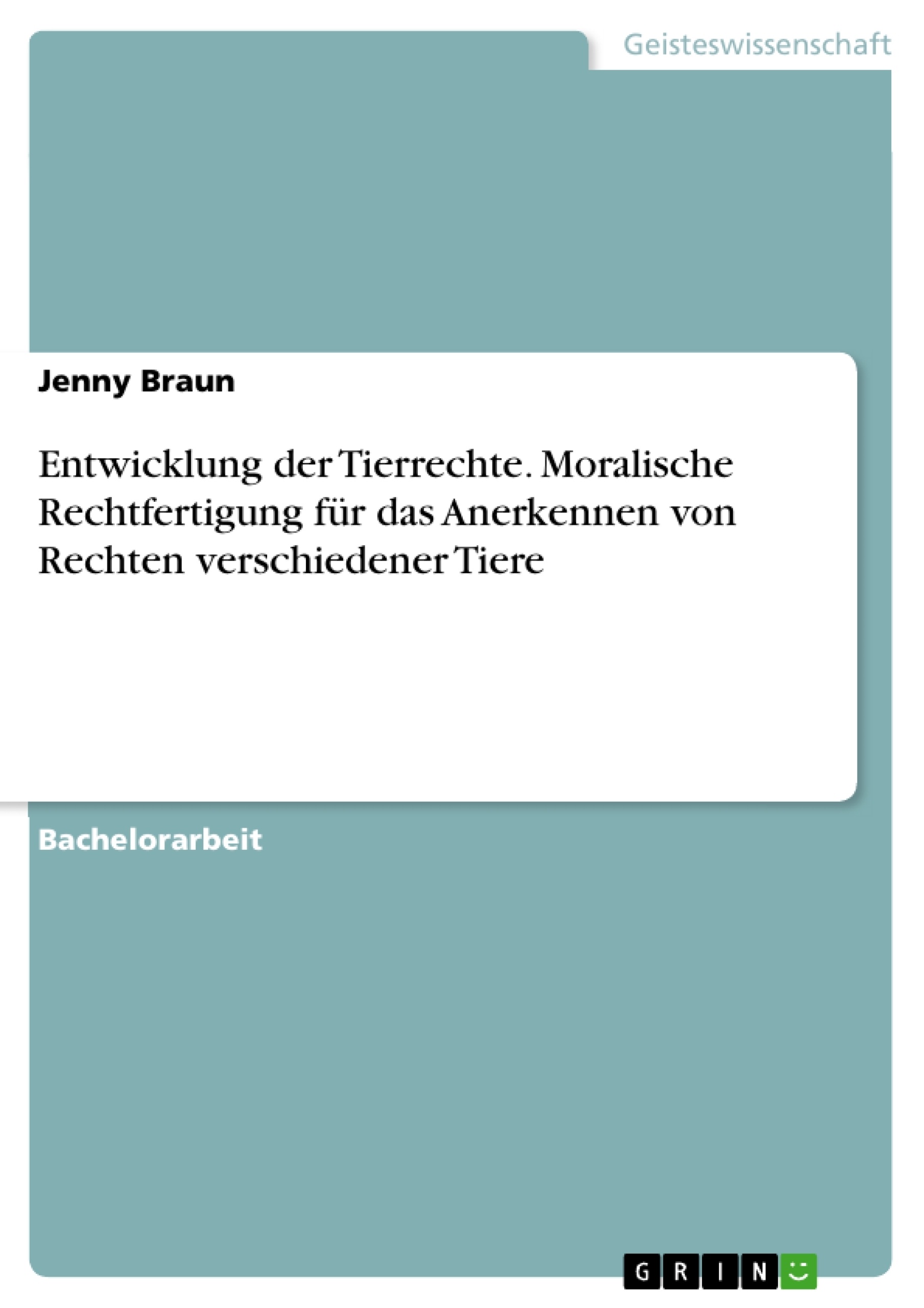Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, was eine Person von einer nichtmenschlichen Person beziehungsweise einem Tier unterscheidet. Warum werden Unterschiede zwischen Tieren gemacht? Und was macht eigentlich eine Person aus? Diese Arbeit befasst sich mit den Gründen für und gegen die Erlangung von Grundrechten für bestimmte Tiere. Die Fortschritte in der Tierrechts-Debatte werden anhand der Delfine, die in Indien als nichtmenschliche Personen ernannt wurden, aufgezeigt und letztlich die Problematik daran für den Rest der Welt erläutert.
Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist für das zu behandelnde Thema elementar und setzt eine entscheidende Annahme voraus – es besteht ein Unterschied zwischen beiden Spezies, sowohl hinsichtlich ihres Wertes, als auch ihrer Rechte. Hierbei ist es wohl keine Frage, dass der Mensch seine Spezies grundsätzlich als die wertvollere beziehungsweise unter allen als wertvollste einstuft und eine Sonderstellung unter den Lebewesen einnimmt.
Diese These mache ich an einem einfachen Beispiel deutlich: Wird ein Mensch von einem Hund gebissen und verletzt, wird dieser Hund vermutlich eingeschläfert, da er als gefährlich gelten würde. Schlägt jedoch ein Mensch einen Hund, sodass er für seine Verhältnisse ebenso schlimm verletzt wird, drohen dem Menschen keine weiteren Konsequenzen. Es ist also offensichtlich, dass der Mensch sein eigenes Wohl stärker schützt, als das anderer Tiere und somit auch sein Leben, das mit seinem Wohl einhergeht, als wertvoller einstuft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Menschliche vs. Nichtmenschliche Person
- Zur Entwicklung von Grundrechten für Tiere
- Fortschritte am Beispiel der Delfine
- Moralische vs. Juristische Rechte
- Voraussetzungen für das Erlangen von Grundrechten
- Freiheit
- Körperliche Unversehrtheit
- Leben
- Zur Problematik der Anerkennung von Grundrechten verschiedener Tiere
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der moralischen Rechtfertigung für das Anerkennen von Rechten verschiedener Tiere auseinander. Dabei wird die Problematik des menschlichen Verhältnisses zu anderen Lebewesen und die Frage nach einer möglichen Sonderstellung des Menschen beleuchtet. Die Arbeit untersucht, welche Kriterien für die Anerkennung von Rechten bei Tieren entscheidend sind und welche Folgen sich aus der Einordnung von Tieren als "nichtmenschliche Personen" ergeben.
- Mensch-Tier-Verhältnis und die Frage der Sonderstellung des Menschen
- Anerkennung von Rechten für verschiedene Tierarten
- Moralische und juristische Aspekte von Tierrechten
- Kriterien für die Zuschreibung von Rechten an Tiere
- Entwicklung von Tierrechten am Beispiel der Delfine
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die eigene Erfahrung der Autorin mit der Tierhaltung im Loro Parque auf Teneriffa. Die Beobachtung verschiedener Tierarten und deren Haltung im Zoologischen Garten werfen Fragen nach dem moralischen Umgang mit Tieren auf. Es wird die Skepsis gegenüber dem vermeintlichen Tierschutzgedanken im Loro Parque beschrieben und die Problematik des kommerziellen Nutzens von Tierhaltung thematisiert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Tier und der Frage, ob es einen grundlegenden Unterschied zwischen beiden Spezies gibt. Es wird die These aufgestellt, dass der Mensch seine Spezies als die wertvollere einstuft und eine Sonderstellung unter den Lebewesen einnimmt. Diese These wird anhand von Beispielen illustriert, die den unterschiedlichen Umgang mit Menschen und Tieren in Bezug auf Leid und Rechtsschutz verdeutlichen.
Im dritten Kapitel wird die Entwicklung von Grundrechten für Tiere diskutiert. Am Beispiel der Delfine wird gezeigt, dass es bereits Fortschritte in der Anerkennung von Rechten für bestimmte Tierarten gibt. Die Unterscheidung zwischen moralischen und juristischen Rechten wird erörtert und die Notwendigkeit einer internationalen Anerkennung von Tierrechten wird hervorgehoben.
Das vierte Kapitel analysiert die Voraussetzungen für das Erlangen von Grundrechten für Tiere. Dabei werden die drei zentralen Aspekte Freiheit, körperliche Unversehrtheit und Leben näher betrachtet. Es werden Argumente für die Einhaltung dieser Rechte für verschiedene Tierarten angeführt und die Bedeutung dieser Aspekte für das moralische und rechtliche Verhältnis zwischen Mensch und Tier hervorgehoben.
Im fünften Kapitel wird die Problematik der Anerkennung von Grundrechten verschiedener Tiere diskutiert. Es werden verschiedene Tierarten betrachtet und die Frage nach der moralischen Rechtfertigung für die Zuschreibung von Rechten an diese Tiere gestellt. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Anerkennung von Rechten für Tiere verbunden sind, und die Notwendigkeit eines differenzierten und verantwortungsvollen Umgangs mit allen Lebewesen.
Schlüsselwörter
Tierrechte, nichtmenschliche Person, Delfine, Menschenaffen, Moral, Recht, Evolution, Tierhaltung, Tierschutz, Ethik, Anthropozentrismus, Speziesismus, Freiheit, Körperliche Unversehrtheit, Leben, Gleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet eine "menschliche Person" von einer "nichtmenschlichen Person"?
Der Begriff "nichtmenschliche Person" wird verwendet, um Tieren mit hoher Intelligenz und komplexem Sozialverhalten (wie Delfinen oder Menschenaffen) bestimmte Grundrechte zuzusprechen, die über den bloßen Tierschutz hinausgehen.
Warum erhielten Delfine in Indien den Status als nichtmenschliche Personen?
Indien erkannte an, dass Delfine über eine außergewöhnliche Intelligenz und Selbstbewusstsein verfügen, was es moralisch unvertretbar macht, sie zu Unterhaltungszwecken gefangen zu halten.
Was ist der Unterschied zwischen moralischen und juristischen Rechten für Tiere?
Moralische Rechte basieren auf ethischen Überlegungen, wie wir Tiere behandeln SOLLTEN. Juristische Rechte sind einklagbare Gesetze, die Tieren einen eigenen Rechtsstatus (weg von der bloßen "Sache") verleihen.
Welche Grundrechte werden für Tiere diskutiert?
Im Zentrum der Debatte stehen meist das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit (keine Gefangenschaft) und das Recht auf körperliche Unversehrtheit.
Was versteht man unter Speziesismus?
Speziesismus bezeichnet die Diskriminierung von Lebewesen allein aufgrund ihrer Artzugehörigkeit, ähnlich wie Rassismus oder Sexismus, und wird in der Tierrechtsdebatte scharf kritisiert.
- Quote paper
- Jenny Braun (Author), 2017, Entwicklung der Tierrechte. Moralische Rechtfertigung für das Anerkennen von Rechten verschiedener Tiere, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1027020