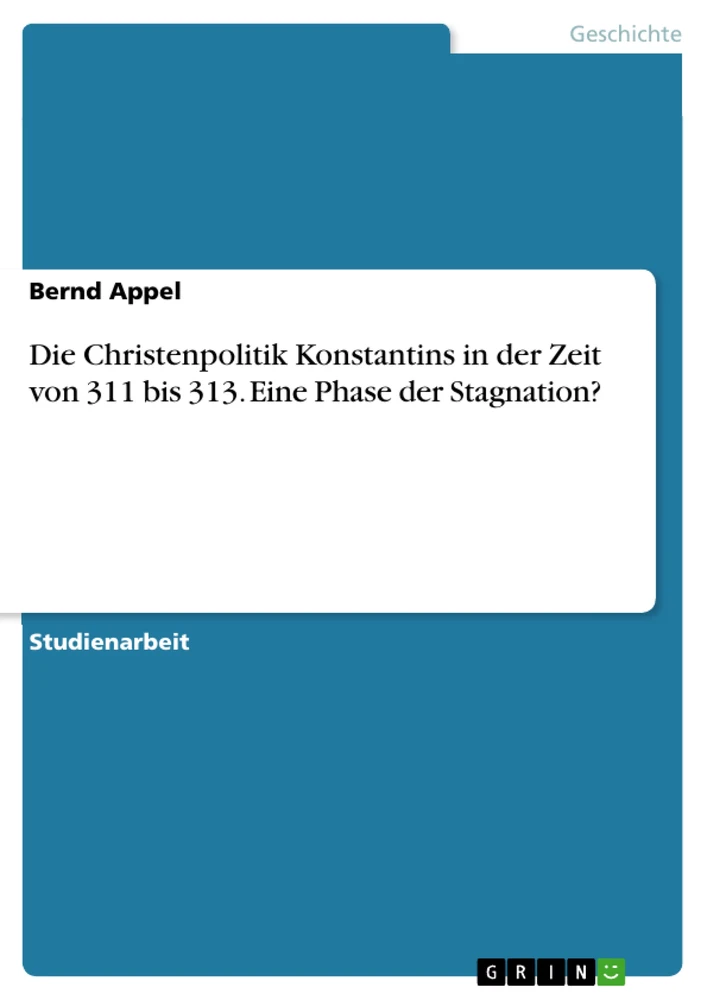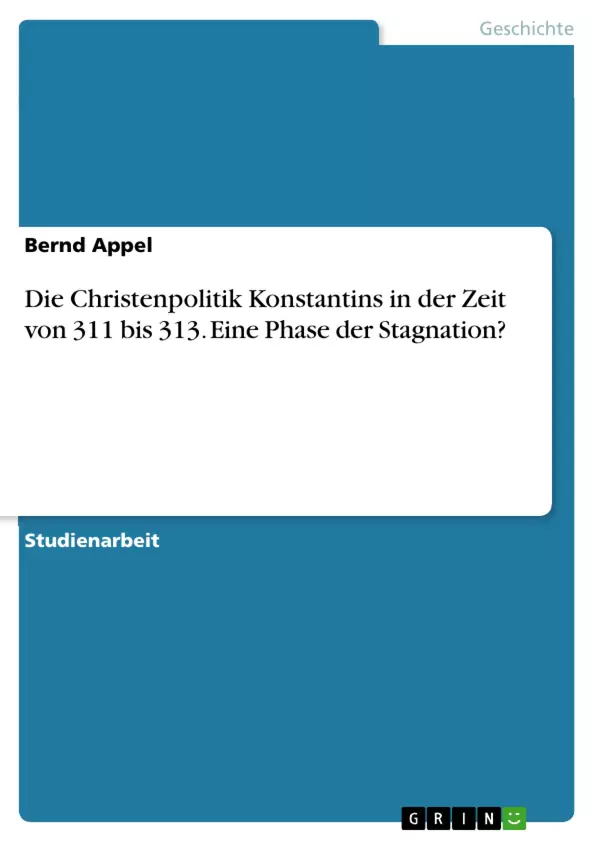Die Frage, ob Kaiser Konstantin der erste christliche Kaiser des römischen Imperiums war, ist bis heute eine der Kernfragen der geschichtlichen Forschung zur Spätantike. Noch immer streitet die Wissenschaft über die Einstellung Konstantins zum Christentum und über seine Motivationen, die ihn am Ende seines Lebens dazu führten, die einst staatsfeindliche Religion zur neuen Staatsreligion zu erheben. In dieser Arbeit soll daher die Frage geklärt werden, ob sich die Position Konstantins zum Christentum im Verlauf der Jahre vor und nach der Schlacht an der Milvischen Brücke gewandelt hat und inwieweit in den Jahren 311-313 von einer Hinwendung Konstantins zum Christentum gesprochen werden kann
Als wegweisendes Ereignis wird auch in der heutigen Forschung noch die Schlacht an der Milvischen Brücke im Jahre 312 verstanden, bei der der spätere Kaiser im Kampf gegen den Usurpator Maxentius den Quellen zufolge ein göttliches Zeichen empfing und so Rom mit Gottes Hilfe aus den Fängen eines später als Tyrannen gebrandmarkten Herrschers befreite.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Quellenlage
- Die Forschungslage
- Entwicklung von Konstantins Christenpolitik in den Jahren 311-313
- Das Galeriusedikt 311
- Die Schreiben nach Afrika
- Die Mailänder Vereinbarung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung von Kaiser Konstantins Christenpolitik in den Jahren 311-313. Ziel ist es zu klären, ob in diesem Zeitraum eine signifikante Hinwendung Konstantins zum Christentum erkennbar ist und ob von einer kontinuierlichen Entwicklung oder einer Phase der Stagnation gesprochen werden kann. Die Arbeit analysiert hierfür relevante Quellen und diskutiert die bestehenden Forschungsmeinungen.
- Analyse der Quellenlage zum Galerius-Edikt, den Briefen nach Afrika und der Mailänder Vereinbarung.
- Bewertung der unterschiedlichen Interpretationen in der Forschung zur Bekehrung Konstantins.
- Untersuchung der religiösen Motivationen Konstantins in den Jahren 311-313.
- Rekonstruktion einer möglichen Entwicklung von Konstantins Christenpolitik.
- Bewertung des Einflusses des Donatistenstreits auf Konstantins Vorgehen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Forschungsfrage ein: Wandelt sich Konstantins Position zum Christentum in den Jahren 311-313? Sie betont die Bedeutung der Schlacht an der Milvischen Brücke und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit der Quellenlage, der Forschungslage und der Analyse dreier Schlüsselquellen (Galerius-Edikt, Schreiben nach Afrika, Mailänder Vereinbarung) beschäftigt. Die Arbeit strebt nach einer Klärung, ob von einer Hinwendung Konstantins zum Christentum in diesem Zeitraum gesprochen werden kann.
Die Quellenlage: Dieses Kapitel bewertet die Quellenlage für die Jahre 311-313 als umfassend. Es analysiert die Quellen zum Galerius-Edikt (Laktanz und Eusebius), zu den Briefen Konstantins nach Afrika (ausschliesslich Eusebius) und zur Mailänder Vereinbarung (wiederum Laktanz und Eusebius). Die inhaltliche Übereinstimmung der Berichte von Laktanz und Eusebius wird hervorgehoben, ebenso wie die kritische Betrachtung der Briefe nach Afrika im Kontext des Donatistenstreits. Die Unterschiede in den Berichten, wie z.B. die unterschiedliche Einleitung in den Berichten über die Mailänder Vereinbarung werden ebenfalls thematisiert und deren Bedeutung für die Interpretation erläutert.
Die Forschungslage: Dieses Kapitel beleuchtet die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage nach Konstantins Bekehrung. Es verweist auf die seit Beginn des 20. Jahrhunderts andauernde Kontroverse um die Interpretation der Schlacht an der Milvischen Brücke als Wendepunkt. Die umfangreiche Forschung zum Galerius-Edikt wird erwähnt, insbesondere die Analyse der Beweggründe hinter Galerius' neuer Toleranzpolitik gegenüber Christen. Der Forschungsstand wird als umfassend dargestellt, besonders hinsichtlich der drei in dieser Arbeit analysierten Ereignisse.
Entwicklung von Konstantins Christenpolitik in den Jahren 311-313: Dieses Kapitel untersucht Konstantins Christenpolitik anhand des Galerius-Edikts, der Briefe nach Afrika und der Mailänder Vereinbarung. Die Analyse dieser drei Quellen soll die religiöse Entwicklung Konstantins in den Jahren 311-313 skizzieren. Es wird eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Inhalt und der Bedeutung jeder einzelnen Quelle erfolgen. Die Untersuchung beinhaltet die jeweilige historische Einordnung, die Interpretation der Motive dahinter und den Zusammenhang zwischen den einzelnen Ereignissen.
Schlüsselwörter
Konstantin der Große, Christenpolitik, Galerius-Edikt, Mailänder Vereinbarung, Religionsfreiheit, Donatistenstreit, Spätantike, Quellenkritik, Religionsentwicklung, Römisches Reich.
FAQ: Entwicklung von Konstantins Christenpolitik in den Jahren 311-313
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung von Kaiser Konstantins Christenpolitik in den Jahren 311-313. Das zentrale Ziel ist es zu klären, ob in diesem Zeitraum eine signifikante Hinwendung Konstantins zum Christentum erkennbar ist und ob von einer kontinuierlichen Entwicklung oder einer Phase der Stagnation gesprochen werden kann.
Welche Quellen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert das Galerius-Edikt, die Briefe Konstantins nach Afrika und die Mailänder Vereinbarung. Die Quellenlage wird als umfassend bewertet, wobei die Berichte von Laktanz und Eusebius im Mittelpunkt stehen. Die Arbeit berücksichtigt auch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Berichten der verschiedenen Autoren und deren Bedeutung für die Interpretation.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Bewertung der unterschiedlichen Interpretationen in der Forschung zur Bekehrung Konstantins. Sie untersucht die religiösen Motivationen Konstantins in den Jahren 311-313 und rekonstruiert eine mögliche Entwicklung seiner Christenpolitik. Der Einfluss des Donatistenstreits auf Konstantins Vorgehen wird ebenfalls untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Quellenlage und Forschungslage, ein Kapitel zur Analyse von Konstantins Christenpolitik (inkl. Galerius-Edikt, Briefe nach Afrika und Mailänder Vereinbarung) und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Forschungsfrage ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Themen.
Welche Schlüsselereignisse werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei Schlüsselereignisse: Das Galerius-Edikt von 311, die Briefe Konstantins nach Afrika und die Mailänder Vereinbarung. Diese Ereignisse werden im Detail analysiert, um die Entwicklung von Konstantins Christenpolitik zu rekonstruieren.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, zu klären, ob in den Jahren 311-313 eine signifikante Hinwendung Konstantins zum Christentum stattfand. Ob es sich um eine kontinuierliche Entwicklung oder eine Phase der Stagnation handelte, soll durch die Analyse der Quellen und der bestehenden Forschung geklärt werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Konstantin der Große, Christenpolitik, Galerius-Edikt, Mailänder Vereinbarung, Religionsfreiheit, Donatistenstreit, Spätantike, Quellenkritik, Religionsentwicklung, Römisches Reich.
Wie wird die Quellenlage bewertet?
Die Quellenlage für die Jahre 311-313 wird als umfassend betrachtet. Die Arbeit analysiert die vorhandenen Quellen kritisch und hebt sowohl Übereinstimmungen als auch Unterschiede in den Berichten von Laktanz und Eusebius hervor. Der Kontext des Donatistenstreits wird bei der Interpretation der Briefe nach Afrika berücksichtigt.
Welche Rolle spielt der Donatistenstreit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Donatistenstreits auf Konstantins Vorgehen und dessen Rolle in der Entwicklung seiner Christenpolitik in den Jahren 311-313. Die Briefe nach Afrika werden in diesem Kontext besonders analysiert.
Wie wird die Forschungslage dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage nach Konstantins Bekehrung und verweist auf die seit Beginn des 20. Jahrhunderts andauernde Kontroverse um die Interpretation der Schlacht an der Milvischen Brücke. Der Forschungsstand wird als umfassend, insbesondere hinsichtlich der drei analysierten Ereignisse, dargestellt.
- Quote paper
- Bernd Appel (Author), 2011, Die Christenpolitik Konstantins in der Zeit von 311 bis 313. Eine Phase der Stagnation?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1027095