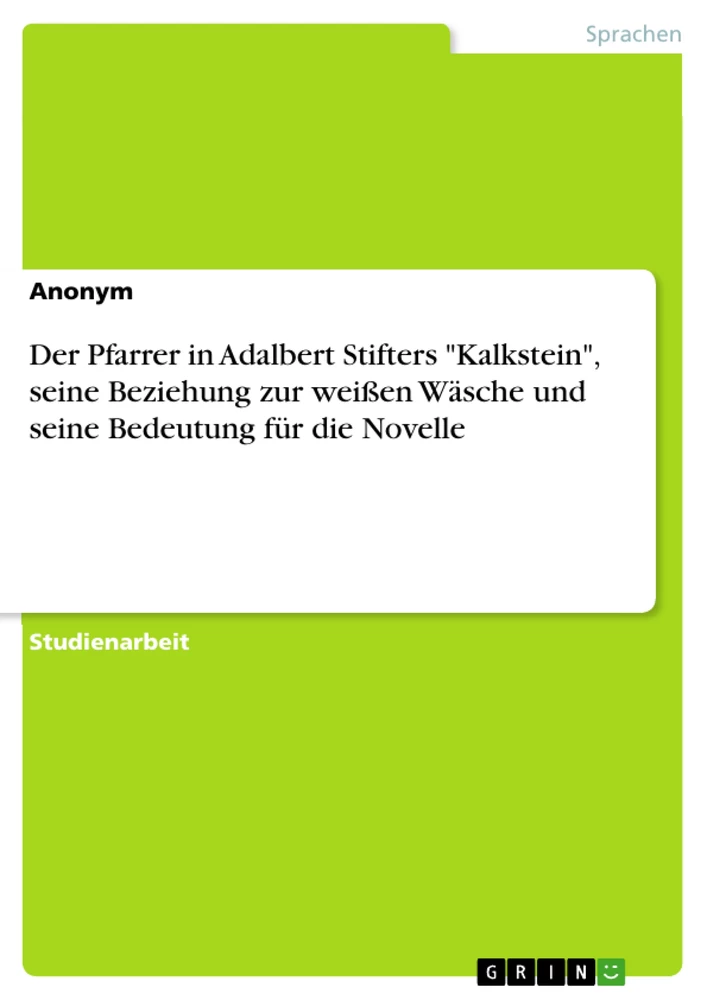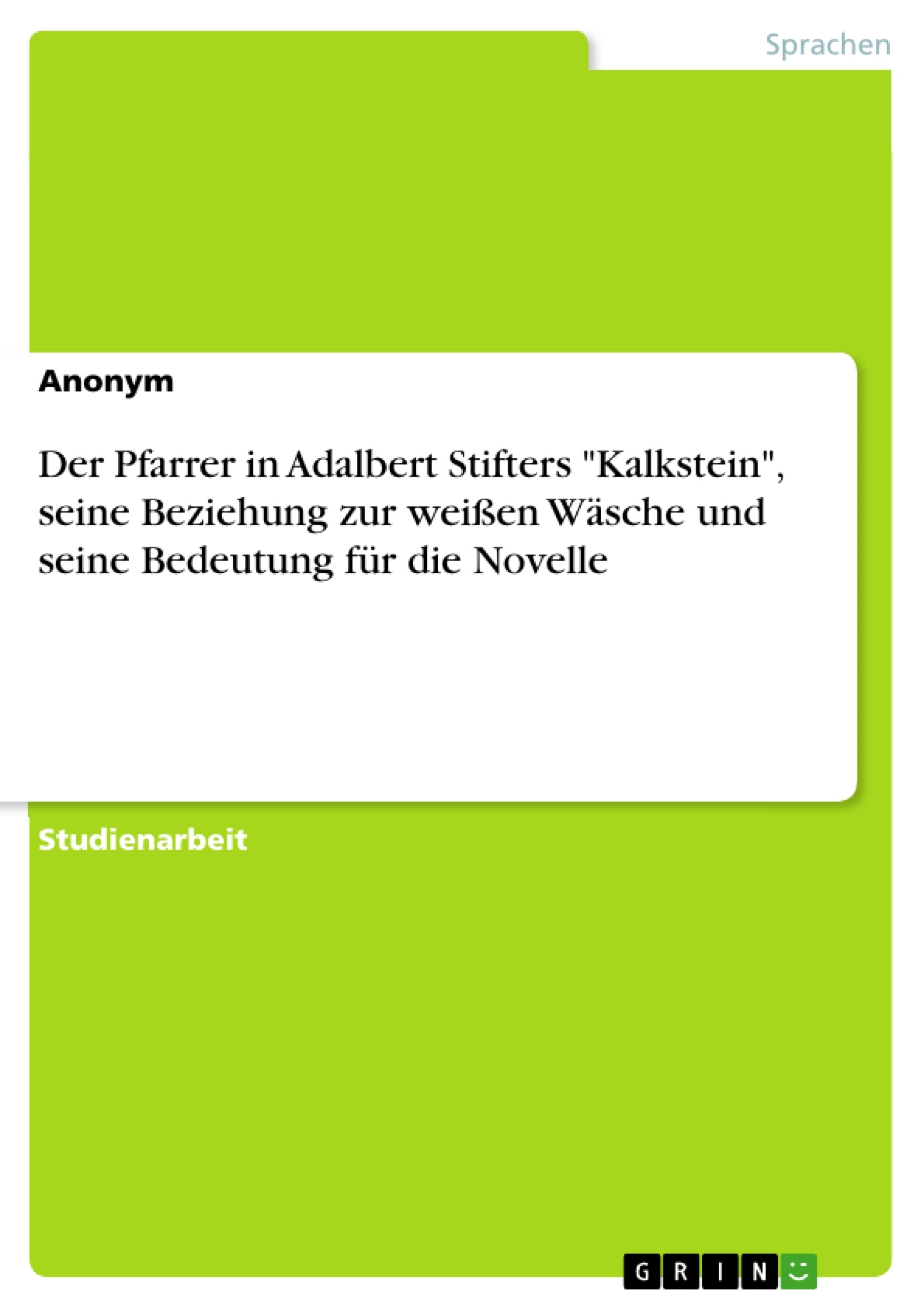Annäherung an die Figur des Pfarrers in Adalbert Stifters "Kalkstein" aus dem Jahr 1853 und geschichtliche Einordnung. In dieser Arbeit soll die scheinbar durchsichtige und uninteressante Figur des Pfarrers in Hinblick auf seine Beziehung zur weißen Wäsche, welche ein durchgängig auftretendes Motiv ist, analysiert werden.
Dabei wird zunächst der erste Eindruck vom Pfarrer in Bezug auf die Farbwahlen analysiert. Weiterhin werden verschiedene Definitionen des Fetischismus folgen, um später die unterschiedlichen Bedeutungen der weißen Wäsche für den Pfarrer analysieren zu können.
Dies wird unter Einbindung verschiedener Sekundärliteratur erfolgen. Abschließend folgt die allgemeine Bedeutung des Pfarrers für die Novelle.
Es sei erwähnt, dass die Journalfassung („Der arme Wohlthäter“) der Erzählung „Kalkstein“ in einigen Aspekten von jener abweicht. Auf diese wird der Vollständigkeit halber kurz Bezug genommen.
Inhaltsverzeichnis
- Annäherung an die Figur des Pfarrers und geschichtliche Einordnung
- Analyse und Bedeutung des Pfarrers
- Erster Eindruck vom Pfarrer in Bezug auf die Farbwahlen
- Definitionen von Fetischismus
- Auftreten der weißen Wäsche
- Bedeutungen der weißen Wäsche für den Pfarrer
- Bedeutung des Pfarrers für den Text
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die scheinbar unauffällige Figur des Pfarrers in Adalbert Stifters Novelle „Kalkstein“. Der Fokus liegt dabei auf der Beziehung des Pfarrers zur weißen Wäsche, einem durchgängigen Motiv in der Geschichte. Ziel ist es, die unterschiedlichen Bedeutungen der weißen Wäsche für den Pfarrer zu entschlüsseln und dessen Bedeutung für den Gesamttext herauszuarbeiten.
- Analyse des ersten Eindrucks vom Pfarrer im Hinblick auf die Farbwahl
- Untersuchung des Fetischismus-Begriffs und dessen Relevanz für die Interpretation der weißen Wäsche
- Interpretation der verschiedenen Bedeutungen der weißen Wäsche für den Pfarrer
- Erörterung der Rolle des Pfarrers im Kontext der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Figur des Pfarrers und dessen geschichtliche Einordnung ein. Es beleuchtet die äußere Erscheinung des Pfarrers und identifiziert dabei wichtige Farb-Kontraste, die den Leser auf die spätere Analyse der weißen Wäsche vorbereiten. Im zweiten Kapitel wird der Fetischismus-Begriff analysiert und seine Bedeutung für die Interpretation der weißen Wäsche erläutert. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die unterschiedlichen Bedeutungen der weißen Wäsche für den Pfarrer und zeigt deren Rolle im Kontext seiner Persönlichkeit und Handlungsweise.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Adalbert Stifter, Kalkstein, Pfarrer, weiße Wäsche, Fetischismus, Farb-Symbolismus, Novelle, Analyse, Bedeutung, Motiv, Textinterpretation.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die weiße Wäsche in Stifters Novelle „Kalkstein“?
Die weiße Wäsche fungiert als zentrales Motiv, das eng mit der Persönlichkeit des Pfarrers und seiner inneren Haltung verknüpft ist.
Warum wird der Pfarrer in der Novelle oft mit Fetischismus in Verbindung gebracht?
Die obsessive Beziehung des Pfarrers zu seiner weißen Wäsche bietet Anlass für Interpretationen, die psychologische Konzepte wie den Fetischismus heranziehen.
Welche Bedeutung hat die Farbwahl in der Charakterisierung des Pfarrers?
Die Farben Weiß und Schwarz erzeugen Kontraste, die sowohl die moralische Reinheit als auch die soziale Isolation der Figur unterstreichen.
Wie unterscheidet sich die Journalfassung „Der arme Wohlthäter“ von der Novelle „Kalkstein“?
Die Journalfassung weist in einigen Aspekten Abweichungen in der Charakterzeichnung und Handlungsmotivation auf, die für eine vollständige Analyse relevant sind.
Was ist die allgemeine Bedeutung des Pfarrers für die Novelle?
Trotz seiner scheinbaren Unscheinbarkeit ist der Pfarrer die moralische und strukturelle Schlüsselfigur, durch die Stifter Themen wie Genügsamkeit und Menschlichkeit verhandelt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Der Pfarrer in Adalbert Stifters "Kalkstein", seine Beziehung zur weißen Wäsche und seine Bedeutung für die Novelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1027240