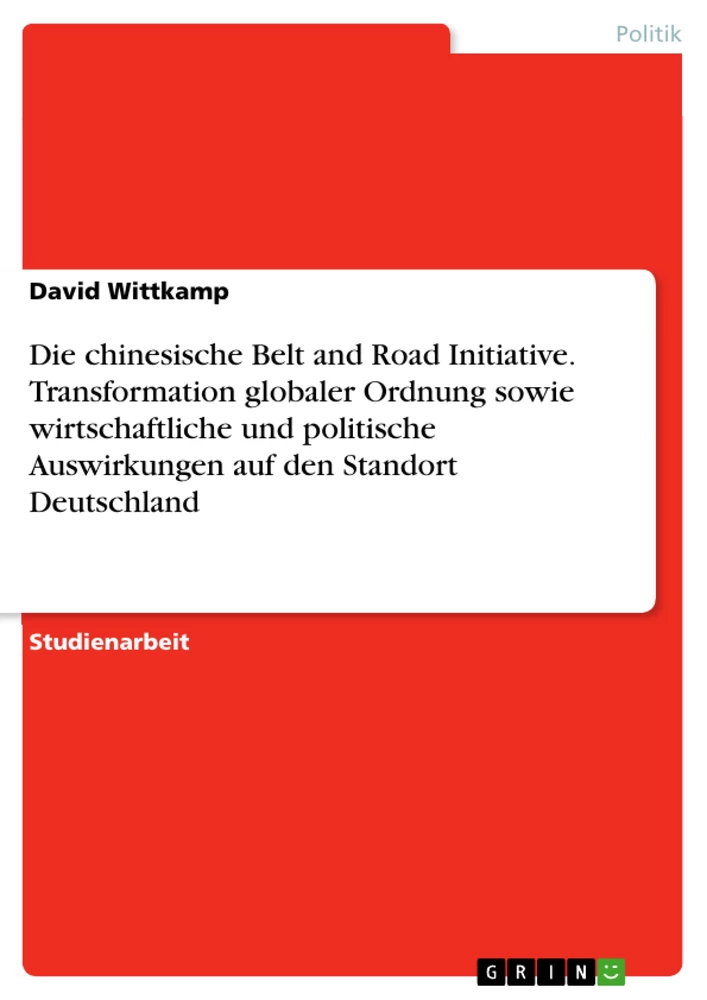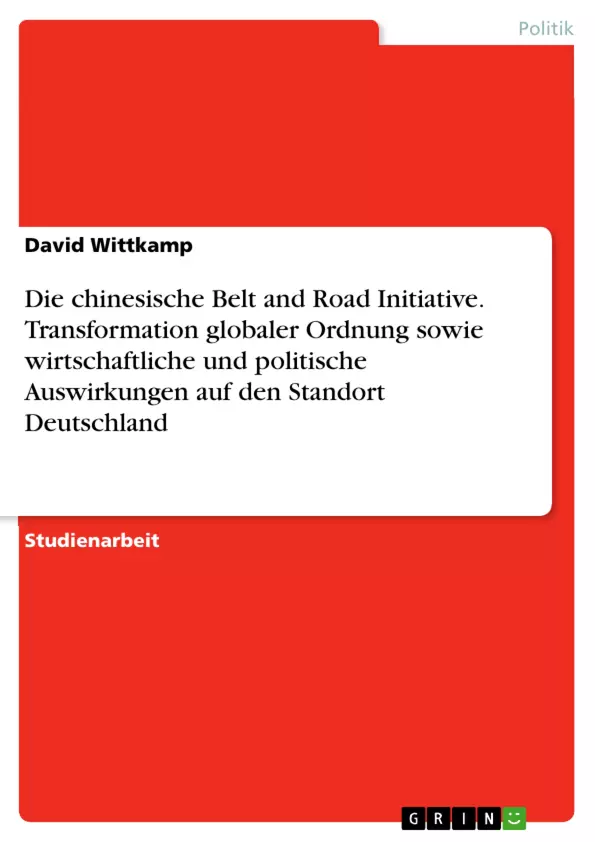Ziel dieser Arbeit ist ein grundlegendes Verständnis für die gerade stattfindende Umgestaltung der globalen Ordnung, ausgelöst durch Chinas Versuch der Transformation der globalen Wirtschaftsordnung zu einer sino-zentrischen und ihrer Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland zu schaffen. Der wirtschaftliche Aufstieg Chinas verändert die globalen Machtverhältnisse sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer Hinsicht dauerhaft.
Mit ihrem neuen interkontinentalen Infrastrukturprojekt One Belt one Road, auch Belt and Road Initiative genannt, strebt China die Position des Hegemon einer "neuen Weltordnung" an. Die Belt and Road Initiative hat das Potential, durch verbesserte politische Zusammenarbeit, infrastrukturelle Verbindungen und freierem Warenverkehr neue wirtschaftliche Wachstumsimpulse für ganze Regionen auszulösen. Jedoch wird mit wachsendem wirtschaftlichem Einfluss vermutlich auch der politische Einfluss Chinas und der kommunistischen Partei zunehmen.
Welche politischen und wirtschaftlichen Risiken und Chancen sich aus dem Projekt für den Standort Deutschland ergeben, soll im Laufe dieser Arbeit ergründet werden. Dazu soll zunächst ihr historisches Gegenstück, die antike Seidenstraße, definiert, in ihrem Verlauf dargestellt und anschließend in ihre Bedeutung für den aktuellen Kontext eingeordnet werden. Im darauffolgenden Kapitel wird die Belt and Road Initiative in ihren Grundzügen dargestellt. Dafür wird auf den Wandel der außenpolitischen Strategien Chinas seit Gründung der Volksrepublik eingegangen, um aufzuzeigen, inwiefern sich die Initiative als Teil einer langfristigen Strategie Chinas zur Rückkehr an die Spitze der globalen Ordnung präsentiert.
Anschließend sollen die Konzeption und der geographische Verlauf der Initiative dargestellt werden, um im letzten Teil des Kapitels auf mögliche Motivationen der chinesischen Regierung für die Durchführung des Projektes einzugehen. Im letzten Kapitel werden die Risiken und Chancen, die die diversen wirtschaftlichen und politischen Implikationen für Deutschland mit sich bringen, beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Zielsetzung
- 2. Historischer Hintergrund
- 2.1 Eine Definition der Seidenstraße
- 2.2 Geographischer Verlauf und Hindernisse auf der antiken Seidenstraße
- 2.3 Bedeutung der historischen Seidenstraße im gegenwärtigen Kontext
- 3. Die Belt and Road Initiative, das Projekt der neuen Seidenstraße
- 3.1 Wandel in der chinesischen Außenpolitik
- 3.2 Konzeption der neuen Seidenstraße
- 3.3 Geographischer Verlauf der neuen Seidenstraßen
- 3.4 Mögliche Motivation der chinesischen Regierung für die Durchführung des Projektes
- 4. Chancen und Risiken für den Standort Deutschland
- 4.1 Wirtschaftliche Chancen und Risiken
- 4.2 Politische Risiken und Chancen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Implikationen der Belt and Road Initiative (BRI) für Deutschland. Sie analysiert die historische Seidenstraße als Kontext für die BRI und beleuchtet die wirtschaftlichen und politischen Chancen sowie Risiken, die sich für Deutschland aus diesem chinesischen Infrastrukturprojekt ergeben. Das Hauptziel besteht darin, ein grundlegendes Verständnis für die durch die BRI ausgelöste Umgestaltung der globalen Ordnung und deren Auswirkungen auf den deutschen Wirtschaftsstandort zu schaffen.
- Die historische Seidenstraße und ihre Bedeutung im aktuellen Kontext
- Die Belt and Road Initiative: Konzeption und geographischer Verlauf
- Wandel der chinesischen Außenpolitik und die Motivation hinter der BRI
- Wirtschaftliche Chancen und Risiken der BRI für Deutschland
- Politische Implikationen der BRI für Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Zielsetzung: Die Einleitung erläutert den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas und dessen Einfluss auf die globalen Machtverhältnisse. Die Belt and Road Initiative wird als chinesischer Versuch vorgestellt, eine neue Weltordnung zu etablieren. Die Arbeit untersucht die daraus resultierenden wirtschaftlichen und politischen Chancen und Risiken für Deutschland. Die historische Seidenstraße wird als Vergleichspunkt eingeführt, um die BRI besser zu verstehen. Das Ziel der Arbeit ist es, ein grundlegendes Verständnis für die Umgestaltung der globalen Ordnung durch die BRI und deren Auswirkungen auf Deutschland zu schaffen.
2. Historischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert einen historischen Kontext für die Belt and Road Initiative. Es betont die Bedeutung der antiken Seidenstraße, nicht nur als Handelsroute, sondern auch als Austausch von Ideen und Kulturen. Die chinesische Regierung nutzt die historische Seidenstraße als Bezugspunkt, um die BRI zu rechtfertigen und imperialistische Vorwürfe abzuwehren. Die wirtschaftlichen Interessen Chinas werden als nicht alleiniger Beweggrund dargestellt; auch politische Stabilisierung durch gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeit spielt eine Rolle.
3. Die Belt and Road Initiative, das Projekt der neuen Seidenstraße: Dieses Kapitel beschreibt die Belt and Road Initiative detailliert. Es analysiert den Wandel der chinesischen Außenpolitik seit der Gründung der Volksrepublik und präsentiert die BRI als Teil einer langfristigen Strategie Chinas zur Rückkehr an die Spitze der globalen Ordnung. Die Konzeption und der geographische Verlauf der Initiative werden erläutert, ebenso wie mögliche Motivationen der chinesischen Regierung für das Projekt. Die BRI wird als potenziell weltverbindendes Infrastrukturprojekt dargestellt, das auch bisher marginalisierte Länder in die globale Wertschöpfungskette einbinden könnte.
4. Chancen und Risiken für den Standort Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die wirtschaftlichen und politischen Chancen und Risiken der BRI für Deutschland. Wirtschaftlich bietet die Initiative neue Märkte und die Konsolidierung bestehender Marktanteile. Allerdings besteht auch das Risiko eines starken Konkurrenzdrucks durch die Transformation Chinas von einer „verlängerten Werkbank“ zu einer innovativeren Wirtschaft. Die politischen Implikationen der BRI und deren Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen China und Deutschland werden ebenfalls untersucht.
Schlüsselwörter
Belt and Road Initiative, Neue Seidenstraße, China, Außenpolitik, Globalisierung, Wirtschaftswachstum, Deutschland, Chancen, Risiken, historische Seidenstraße, geopolitische Beziehungen, Infrastruktur, wirtschaftliche Abhängigkeit, politische Stabilisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Belt and Road Initiative und Deutschland
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Belt and Road Initiative (BRI), auch bekannt als Neue Seidenstraße, und ihre Implikationen für Deutschland. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Analyse der wirtschaftlichen und politischen Chancen sowie Risiken, die sich aus diesem chinesischen Infrastrukturprojekt für Deutschland ergeben.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende zentrale Themen: den historischen Hintergrund der Seidenstraße und ihre Bedeutung im heutigen Kontext; die Konzeption und den geographischen Verlauf der Belt and Road Initiative; den Wandel der chinesischen Außenpolitik und die Motivationen hinter der BRI; die wirtschaftlichen Chancen und Risiken der BRI für Deutschland; und die politischen Implikationen der BRI für Deutschland.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Das Hauptziel des Dokuments ist es, ein grundlegendes Verständnis für die durch die BRI ausgelöste Umgestaltung der globalen Ordnung und deren Auswirkungen auf den deutschen Wirtschaftsstandort zu schaffen. Es analysiert die BRI im Kontext der historischen Seidenstraße und beleuchtet die daraus resultierenden Chancen und Risiken für Deutschland.
Welche Kapitel umfasst das Dokument und worum geht es in jedem Kapitel?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung und Zielsetzung) legt den Fokus auf den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas und die BRI als Versuch, eine neue Weltordnung zu etablieren. Kapitel 2 (Historischer Hintergrund) beleuchtet die Bedeutung der antiken Seidenstraße. Kapitel 3 (Die Belt and Road Initiative) beschreibt die Initiative detailliert, analysiert den Wandel der chinesischen Außenpolitik und die Motivationen dahinter. Kapitel 4 (Chancen und Risiken für den Standort Deutschland) untersucht die wirtschaftlichen und politischen Implikationen für Deutschland. Kapitel 5 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Deutschland durch die BRI?
Die BRI bietet Deutschland wirtschaftlich neue Märkte und die Möglichkeit, bestehende Marktanteile zu konsolidieren. Allerdings besteht auch das Risiko eines starken Konkurrenzdrucks durch das wirtschaftliche Aufsteigen Chinas. Politisch ergeben sich sowohl Chancen als auch Risiken für die deutsch-chinesischen Beziehungen, die im Dokument detaillierter untersucht werden.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Zusammenhang mit der BRI und Deutschland relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Belt and Road Initiative, Neue Seidenstraße, China, Außenpolitik, Globalisierung, Wirtschaftswachstum, Deutschland, Chancen, Risiken, historische Seidenstraße, geopolitische Beziehungen, Infrastruktur, wirtschaftliche Abhängigkeit, politische Stabilisierung.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Wissenschaftler, Studierende, Wirtschaftsakteure und alle, die sich für die chinesische Außenpolitik, die Globalisierung und die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen China und Deutschland interessieren.
- Quote paper
- David Wittkamp (Author), 2021, Die chinesische Belt and Road Initiative. Transformation globaler Ordnung sowie wirtschaftliche und politische Auswirkungen auf den Standort Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1027262