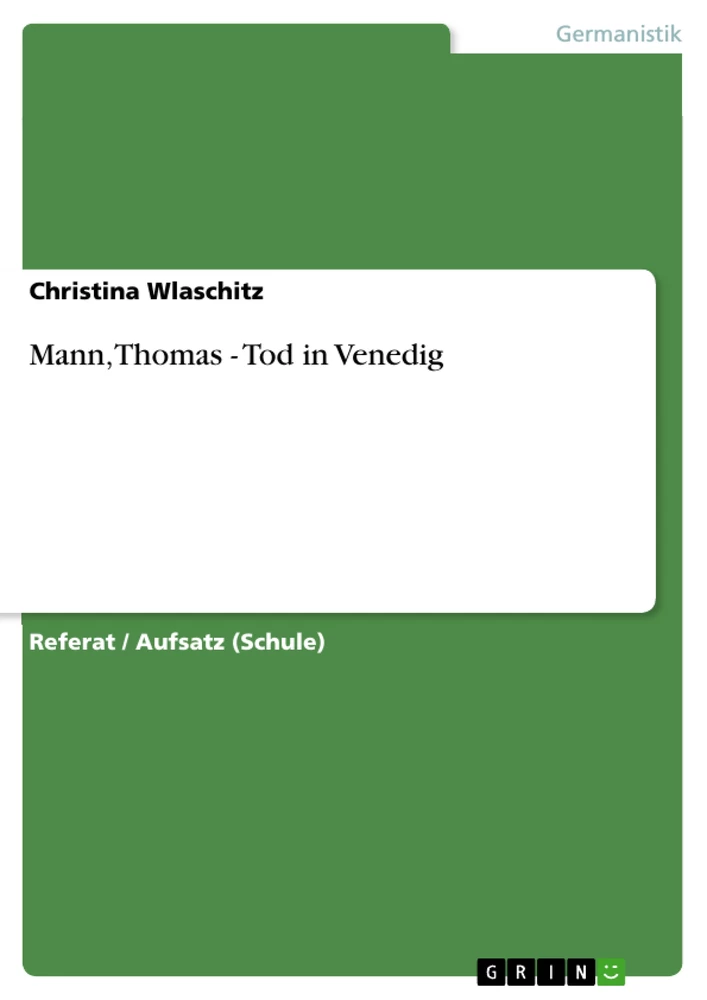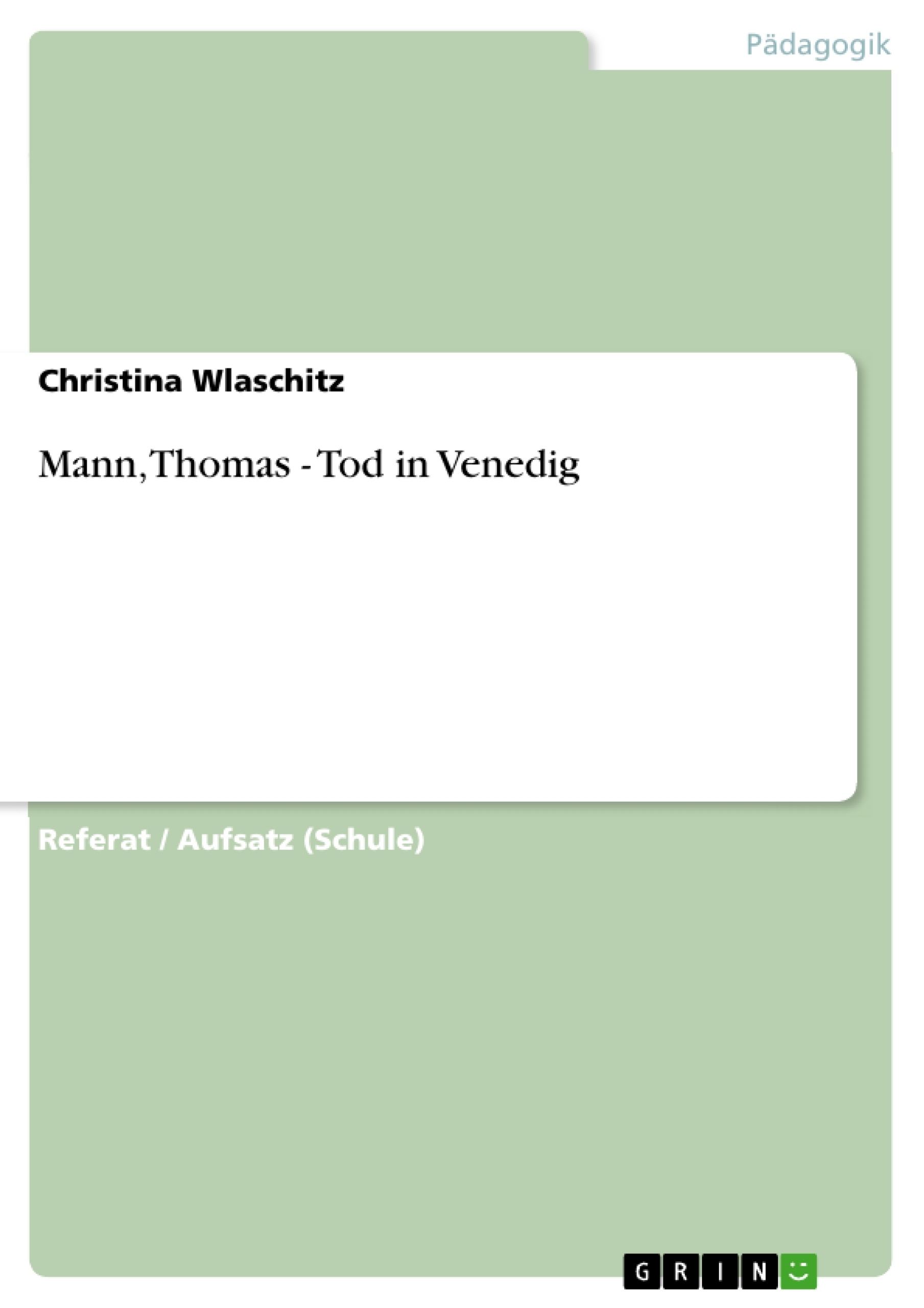In einer Stadt, die im Dunst der Lagune zu existieren scheint, wo morbide Schönheit und subtile Gefahr sich vermischen, entfaltet sich eine Geschichte von obsessiver Begierde und dem unausweichlichen Verfall. Gustav Aschenbach, ein gefeierter Schriftsteller von asketischer Disziplin und klassischer Strenge, sucht in Venedig Erholung von der Last seines Ruhms und der Leere seines geordneten Lebens. Doch die Serenissima, erfüllt von einer schwülen, fast betäubenden Atmosphäre, weckt in ihm eine unerwartete und verstörende Leidenschaft. Die Begegnung mit dem jungen, engelhaften Tadzio, einem polnischen Knaben von vollendeter Schönheit, stürzt Aschenbach in einen Strudel aus verdrängten Sehnsüchten und einer obsessiven Liebe, die seine bürgerliche Fassade und seine künstlerischen Ideale untergräbt. Gefangen in der labyrinthischen Stadt, die von einer unsichtbaren, aber allgegenwärtigen Gefahr heimgesucht wird, ringt Aschenbach mit seiner verbotenen Leidenschaft und dem drohenden Untergang. Die Cholera, die sich unaufhaltsam in Venedig ausbreitet, wird zur Metapher für den moralischen und körperlichen Zerfall, der Aschenbachs Existenz durchdringt. Thomas Manns Novelle "Der Tod in Venedig" ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Themen Kunst, Schönheit, Verfall, Homosexualität und der zerstörerischen Kraft der Obsession. Sie erkundet die Grenzen der menschlichen Vernunft und die dunklen Abgründe der Begierde, die unter der Oberfläche der Zivilisation lauern. Die präzise Sprache, die detaillierten Beschreibungen der venezianischen Szenerie und die vielschichtigen Charaktere machen diese Novelle zu einem zeitlosen Meisterwerk der deutschen Literatur. Eine faszinierende Reise in die Tiefen der menschlichen Seele, die den Leser mit unbehaglichen Fragen über das Wesen der Schönheit und die Konsequenzen unkontrollierter Leidenschaft zurücklässt. Ein Klassiker der Moderne, der die Abgründe der menschlichen Existenz in einer Atmosphäre von Schönheit und Verfall auslotet. Die Auseinandersetzung mit der Künstlerproblematik, der homoerotischen Neigung und der Vergänglichkeit des Seins verleihen der Erzählung eine zeitlose Relevanz, die auch heute noch Leser in ihren Bann zieht. Aschenbachs Reise wird so zu einer Allegorie des menschlichen Strebens nach Vollkommenheit und der tragischen Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit.
Der Tod in Venedig - Thomas Mann
Autor
- wurde am 06. Juni 1875 als 2. Sohn des Senators Thomas Johann Heinrich Mann geboren
- nach dem Tod des Vaters ging er vom Gymnasium ab - folgte der Familie nach München - war kurze Zeit in einer Feuerversicherungsanstalt
- 1894 veröffentlichte er seine 1. Novelle „Gefallen“
- von 1895-1898 studierte er an der Technischen Hochschule in München
- Aufenthalt mit seinem Bruder in Italien
- 1905 heiratete er Katja Pringsheim - hat 3 Töchter und 3 Söhne geboren
- 1912 „Der Tod in Venedig“
- emigrierte in die Schweiz - siedelte dann in die USA (lehrte in Princeton) - zog dann nach Kalifornien
- im Exil „Doktor Faustus“
- 1944 - amerikanischer Staatsbürger - zog 5 Jahre danach nach Zürich
- starb am 12. August 1955 im Alter von 80 Jahren im Kantonsspital Zürich
Literaturgeschichtliche Einordnung
naturalistische Einflüsse
- Seuche - Tod - Cholera - präzise Beschreibung der Stadt Venedig, der Figur, des Lebens am Strand
Dekadenz-Dichtung
- dekadent = eine Überfeinerung der Lebensverhältnisse (versnobt) - Anzeichen der Verwöhntheit - feine Leute - eine Gesellschaft, die nichts produktives machen - nur Geld ausgeben
Neuromantik (=Wiederlebung der Romantik)
- Liebestod - Verknüpfung von Tod, Schönheit, Krankheit - Schauplatz
- Venedig
Neuklassik (= Wiederbelebung der Klassik)
- strenger klassischer Aufbau - anspruchsvolle, kompensierte Sprache - Würde und Strenge in Aschenbachs Charakter
Expressionismus
- Expressionismus lehnen den Tod in Venedig ab - kritisieren die Komposition als langweilig und tadeln Thomas Mann zu seinem Hang zur Repräsentanz
Gattung
- Novelle (=Neu) - kurzer Text, der einen besonderen Ausschnitt im Leben eines Menschen zeigt
Thematik
- Der alternde Künstler (Schriftsteller) Gustav Aschenbach verliebt sich in Venedig in den 14-jährigen Tadzio - wirft seine Lebensgrundsätze über Bord - gibt sich der Leidenschaft hin und stirbt schließlich an der Cholera in Venedig
Ort
- München
- Venedig - Lido
Zeit
- 2 Monate (vor 1900 - um die Jahrhundertwende)
Erzählperspektive
- auktoriales Erzählen
Sujets
- Homosexualität (Leidenschaft) - Künstlerproblematik - Tod und Krankheit (Seuche) - Stadt Venedig - Schönheit - Narzissmus
Aufbau
- 5 Kapitel - 5-Akt-Schema beim Drama
- Novelle = Schwester des Dramas
Entstehungszeit
- Juli 1911 / 12
Entstehungsgeschichte
- Italienreise von Thomas Mann mit seiner Frau und seinem Bruder - haben am Lido im Grandhotel „Bains“ gewohnt (genau das Hotel in dem Gustav Aschenbach gewohnt hat)
- In dieser Reise erfährt er den Tod von Gustav Mahler - Komponist - zu diesem hat sich Thomas Mann hingezogen gefühlt - deshalb hat er das Buch geschrieben
Verfilmung
- 1970 von Visconti - man hört von Gustav Mahler die 3. und 5. Symphonie
- arbeitet mit sehr schönen Bildern - dramatische Musik (Zeitweise schnulzig) - Film nimmt wenig Rücksicht auf Wort und Text
- Im Film nicht möglich - der Wechsel von auktorialem und personalem Erzählen
- Träume werden nicht dargestellt - Leitmotive (Todesboten) werden nur teilweise umgesetzt
- sehr intensive Gestaltung der Atmosphäre - Auszeichnung in Cannes für den Film
- Hotel wurde schön gezeigt, traumhafte, Kameraführung
Buch
- 1912 herausgekommen „Neue Rundschau“ - Berlin
Sprache
- komplizierter Satzbau - wahnsinnig kompliziertes Satzgefüge - Parataxe - Hypotaxe - viele Fremdwörter - Zitate aus der Literatur - Schachtelsätze - Sätze sind immer wieder eingeleitet mit der Gestalt: „Sei es, dass,...“ - viele antike Wörter - substantivierte Adjektiva
Inhalt
1.Kapitel
- Münchner Friedhof - Aschenbach trifft Fremden - löst Denkprozess in Aschenbach aus - Reiselust
2.Kapitel
- es wird die Exposition (Einleitung) nachgeholt - wir erfahren von Aschenbach den Werdegang des Künstlers, vom Werk, vom Schaffensprozess und von seiner Karriere - Entwicklung zur Meisterlichkeit
3.Kapitel
- Die Reise nach Venedig (Überfahrt - falscher Jüngling - Gondoliere) - Gondel ist schwarz - Sarg - Begegnung mit Tadzio - Missglückte Abreise
4.Kapitel
- Liebe zu Tadzio - glückliche Tage am Lido (Hotel) - Aschenbach gesteht sich seine Liebe ein - Esperipedie = Hinauszögerung der Katastrophe
5.Kapitel
- er stirbt an der Cholera - Aschenbachs Tod wird durch Lebensmittel übertragen - Erdbeeren
Charakteristik:
Gustav Aschenbach
- beschwört antike Bilder um sich selber zu rechtfertigen - will sich seine Lust zu dem Jungen nicht eingestehen
- Schriftsteller, arbeitet täglich - ist 50 Jahre alt - kommt aus der Provinz Schlesien - Sohn eines höheren Justizbeamten - Vorfahren waren Offiziere, Verwaltungsfunktionäre im Dienst des Königs, Richter
- straffes, anständiges, karges Leben
- Mutter:
Tochter eines böhmischen Kapellmeisters - Merkmale fremder Rasse im Äußeren - Temperament - frühreif - geschickt - Leistung - keine arglose Jugend - zur ständigen Anspannung und robuster Verfassung berufen aber nicht dazu geboten - häuslicher Unterricht - Einzelkind - keine Freunde
- Vater:
Zucht - Ordnung - Pflichterfüllung - Willensdauer - zierliche Gestalt - hohe zerklüftete narbige Stirn - Brillenträger - großer Mund - magere zerfurchtete Wangen - war Justizbeamter
- Motto: Aschenbach muss durchhalten - ist viel zu streng zu sich
- Arbeitsweise: lebt asthenisch - verordnet sich jeden Tag sein Schreiben - es ist nicht die eines Künstlers, sondern eines Beamten - seine dichterischen Werke sind Erzeugnis harter Arbeit - spießig
- Werke: „Friedrich der Große“, „Maja“,
- der 1. Weg des Schreibens ist der über Schönheit (Tadzio) - Rausch, Begierde, Abgrund der 2. Weg über die Erkenntnis - Aschenbach geht über den Weg der Schönheit
Tadzio
- 14-jähriger polnischer Knabe - vollkommen schön - wird mit einer antiken Büste verglichen - Aschenbach glaubt, er schaut aus wie ein Dornauszieher = gottähnliche Schönheit - Aschenbach glaubt in Tadzio selbst das Schöne begreifen zu können
- zwischen Aschenbach und Tadzio kein Gespräch - ein Lächeln von Tadzio - Tadzio gefällt es, dass er bewundert wird
- Aschenbach hofft, dass die Cholera vertuscht wird - dass Tadzio nicht abreist
- man nimmt ihn nur aus der Sicht des Schriftstellers wahr
Todesboten
Wanderer am Friedhof
- außergewöhnliche Erscheinung - mäßig hochgewachsen - mager - lautlos - auffallend stumpfnasig - rothaarig - milchige- und sommersprossige Haut - Basthut verleiht ihm etwas Fremdländisches - Rucksack - gelblicher Gurtanzug aus Lodenstoff - grüner Wetterkragen - Stock - Sporthemd - farblose Augen - bloßliegende Zähne - hagerer Hals - nicht bayrisch
Gondoliere
- seemännisch blau gekleidet - gelbe Schärpe - formloser Strohhut - blonder lockiger Schnurrbart - schmächtig - weiße Zähne - rötliche Brauen - führt Selbstgespräche - unheimlich - entschlossen - nicht italienisch
Straßenmusikant
- mimisch begabt - bemerkenswerte Energie - Gitarrespieler - plastisch- dramatische Art - schmächtig - mager - ausgemergelt - rotes Haar - neapolitanischer Komiker - verwegen - unterhaltend - Sporthemd - städtische Kleidung - hagerer Hals - großer Adamsapfel - bleiches und stumpfnasiges Gesicht - lautlos - rötliche Brauen - nicht venezianischer Schlag
Träume
1.Traum
- Aschenbach träumte von einer Landschaft - einem tropischen Sumpfgebiet aus Inseln, Morästen, Schlamm, Flüsse, Palmen, Bäume und Blumen
- sah fremdartige Vögel und einen Tiger - fühlte ein eigenartiges Verlangen und sein Herz pochte vor Entsetzen
- Vorahnung auf Zusammentreffen mit Tadzio (Reiselust - Cholera)
2.Traum
- Im Traum befand sich Aschenbach in einem Bergland in einem Wald umgeben von Menschen und Tieren - tanzten und machten Musik -
- besonders auffallend ein beharrliches Flötenspiel - Männer und Frauen waren eigenartig gekleidet - ungewöhnliche Rufe, Lärm, Geheul, Geruch nach Wunden und Krankheit
- Aschenbach fühlte Angst und Neugier - Vorahnung auf Tod - Vernichtung von Aschenbach - Meeresmotiv - Aschenbach liebt es, zeigt auch Liebe zum Verbotenen, Verführerischen - mit Meer endet die Handlung
Dialog zwischen Sokrates und Phaidros
- Dialog über die Liebe, es geht um Schönheit, Sehnsucht und Tugend - Aschenbach versucht seine Gefühle durch antike Vergleiche zu rechtfertigen (Griechen - Homosexualität)
Das Künstlerproblem bei Thomas Mann
- Der Schriftsteller Aschenbach kommt zur Erkenntnis, dass der Künstler gar nicht würdig sein kann und auch nicht zum Erzieher taugt, sondern ein Abenteurer des Gefühls bleiben muss
- Thomas Mann vertritt den Repräsentationskünstler (Nationalschriftsteller)
- Aschenbach ist in einer Schaffenskrise - deshalb geht er nach Venedig
Leitmotiv
- kommt aus der Musik - in der Literatur ist das ein wiederkehrendes Motiv von Charakteristik von Personen und Situationen
- wirkt durch Wiederholung - stiftet Verbindungen zwischen Handlungen und einzelnen Figuren
Funktionen der Todesmotive
- Aufhebung der Zeit - Vergangenheit und Zukunft vermischen sich
Themenkreis Tod
- Cholera - Seuche - wird von Lebensmittel übertragen § Gondel - ähnlich dem Sarg, schwarz
- Gondoliere - Charon - Styx (= Fluss der das Totenreich von der Welt des Lebens trennt) Mythologie
- Musiker - Karbolgeruch § Friedhof - Gräberfeld
- Granatapfelsaft - ist ein antikes Todessymbol - den trinkt er, bevor er stirbt
- Sanduhr - Leben geht zu Ende (Haus der Eltern)
- Wetter - spielt verrückt, als er in Venedig ankommt - es gewittert, ist feucht, schwül - Kapitel IV - Wetter ist schön - Kapitel V - er stirbt, Wetter ist schlecht
Häufig gestellte Fragen zu "Der Tod in Venedig" - Thomas Mann
Wer war Thomas Mann?
Thomas Mann wurde am 6. Juni 1875 geboren. Er war Schriftsteller und verbrachte Zeit in München, Italien und den USA. Er schrieb "Der Tod in Venedig" im Jahr 1912 und starb am 12. August 1955.
Welche literaturgeschichtlichen Einflüsse finden sich in "Der Tod in Venedig"?
Die Novelle weist Einflüsse des Naturalismus (Seuche, detaillierte Beschreibungen), der Dekadenz-Dichtung (Überfeinerung der Lebensverhältnisse), der Neuromantik (Liebestod, Venedig als Schauplatz) und der Neuklassik (strenger Aufbau, anspruchsvolle Sprache) auf. Der Expressionismus lehnte das Werk jedoch ab.
Um was geht es in "Der Tod in Venedig"?
Die Novelle handelt von dem alternden Schriftsteller Gustav Aschenbach, der sich in Venedig in den jungen Tadzio verliebt. Er verwirft seine Prinzipien und stirbt schließlich an der Cholera.
Wo und wann spielt die Handlung?
Die Handlung spielt in München und Venedig (Lido) über einen Zeitraum von etwa zwei Monaten um die Jahrhundertwende (vor 1900).
Welche Themen werden in der Novelle behandelt?
Zu den Sujets gehören Homosexualität (Leidenschaft), Künstlerproblematik, Tod und Krankheit (Seuche), die Stadt Venedig, Schönheit und Narzissmus.
Wie ist die Novelle aufgebaut?
Die Novelle ist in fünf Kapitel unterteilt, was einem 5-Akt-Schema im Drama entspricht.
Was ist die Entstehungsgeschichte von "Der Tod in Venedig"?
Thomas Mann wurde während einer Italienreise mit seiner Frau und seinem Bruder, bei der sie im Grandhotel "Bains" wohnten, inspiriert. Zudem erfuhr er vom Tod Gustav Mahlers, zu dem er sich hingezogen fühlte.
Gibt es eine Verfilmung des Buches?
Ja, 1970 wurde "Der Tod in Venedig" von Visconti verfilmt. Die Musik von Gustav Mahler wird verwendet. Der Film weicht jedoch teilweise vom Buch ab.
Wie ist die Sprache in "Der Tod in Venedig"?
Die Sprache ist komplex mit komplizierten Satzbau, Parataxe, Hypotaxe, Fremdwörtern, Zitaten aus der Literatur und Schachtelsätzen.
Was passiert in den einzelnen Kapiteln?
Kapitel 1: Aschenbach trifft auf dem Münchner Friedhof einen Fremden und verspürt Reiselust. Kapitel 2: Aschenbachs Werdegang als Künstler wird beschrieben. Kapitel 3: Die Reise nach Venedig und die erste Begegnung mit Tadzio. Kapitel 4: Aschenbach verliebt sich in Tadzio. Kapitel 5: Aschenbach stirbt an der Cholera.
Wie ist Gustav Aschenbach charakterisiert?
Gustav Aschenbach ist ein 50-jähriger Schriftsteller aus Schlesien, der aus einer Familie von Beamten stammt. Er führt ein straffes, anständiges Leben und ist sehr streng mit sich selbst. Sein Schreiben ist eher das Ergebnis harter Arbeit als künstlerischer Inspiration.
Wer ist Tadzio?
Tadzio ist ein 14-jähriger polnischer Junge von vollkommener Schönheit, der von Aschenbach idealisiert wird. Er kommuniziert kaum mit Aschenbach, genießt aber dessen Bewunderung.
Wer sind die Todesboten in der Novelle?
Die Todesboten sind der Wanderer am Friedhof, der Gondoliere und der Straßenmusikant. Sie sind alle von ungewöhnlicher Erscheinung und kündigen Aschenbachs Tod an.
Welche Rolle spielen Träume in der Novelle?
Aschenbach hat zwei Träume, die Vorahnungen auf sein Zusammentreffen mit Tadzio (Reiselust - Cholera) und seinen Tod sind.
Was ist das Künstlerproblem bei Thomas Mann?
Aschenbach erkennt, dass der Künstler kein Erzieher sein kann, sondern ein Abenteurer des Gefühls bleiben muss. Thomas Mann vertritt den Repräsentationskünstler. Aschenbach befindet sich in einer Schaffenskrise und reist deshalb nach Venedig.
Was ist ein Leitmotiv?
Ein Leitmotiv ist ein wiederkehrendes Motiv, das in der Literatur zur Charakterisierung von Personen und Situationen verwendet wird. Es wirkt durch Wiederholung und stiftet Verbindungen.
Welche Themenkreise stehen mit dem Tod im Zusammenhang?
Cholera, Gondel (Sarg), Gondoliere (Charon), Musiker, Friedhof, Granatapfelsaft (Todessymbol) und das Wetter spielen eine Rolle.
- Arbeit zitieren
- Christina Wlaschitz (Autor:in), 2001, Mann, Thomas - Tod in Venedig, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102781