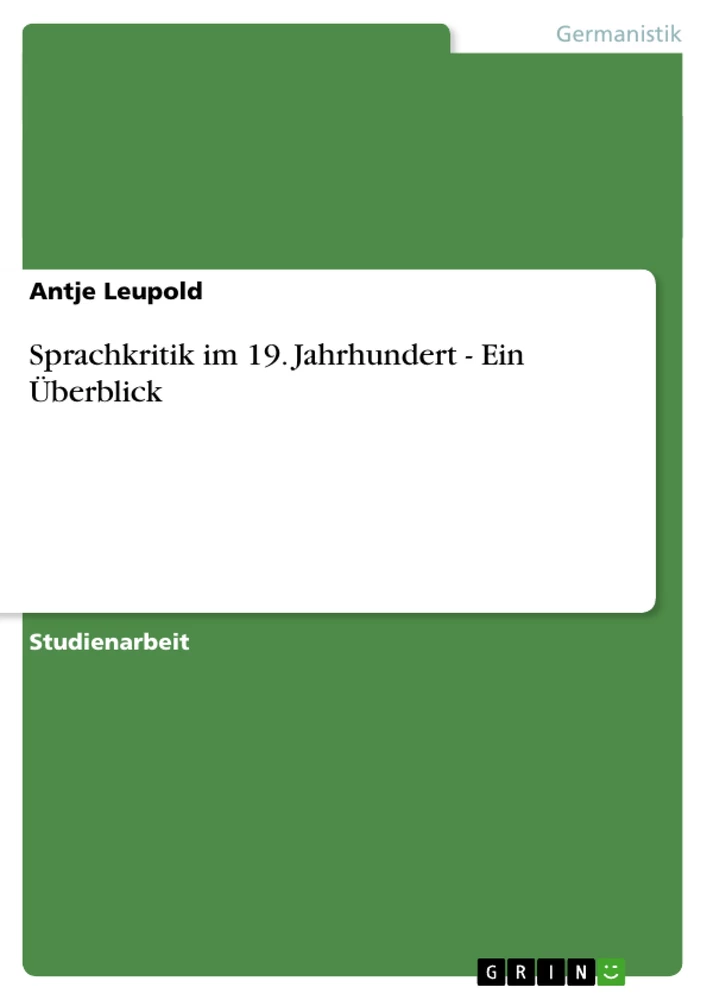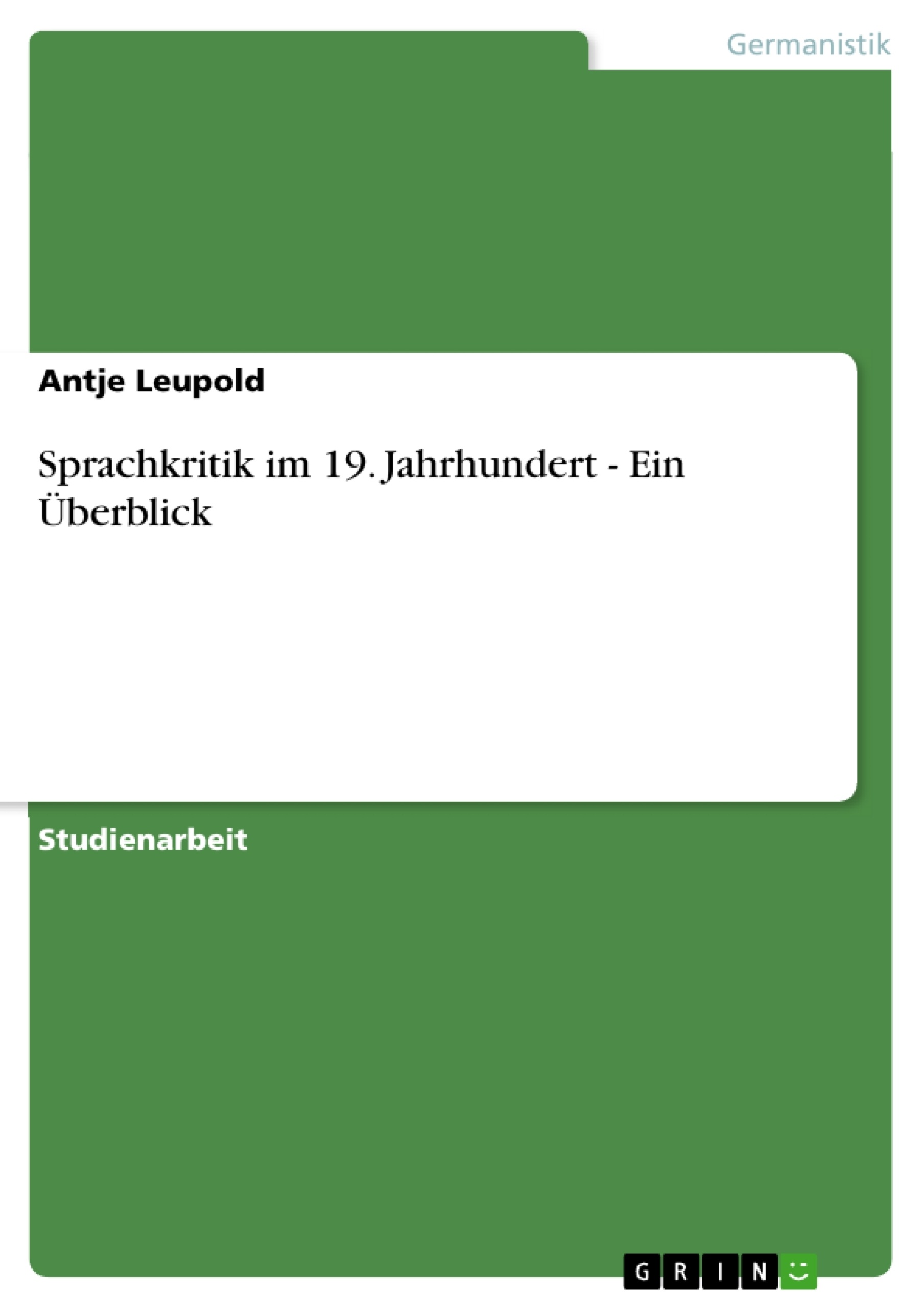Eine grundlegende Feststellung gleich an aller erster Stelle: Die Sprachkritik existiert nicht. Wichtig aber auch problematisch ist, dass man unter dem Begriff ´Sprachkritik` verschiedene Vorstellungen einer wie auch immer gearteten Kritik an Sprache subsumieren kann. Es existieren also nur verschiedene Formen der Sprachkritik. Bei Schwinn findet sich eine minimale Definition von ´Sprachkritik`, die die Gemeinsamkeit aller Arten von Sprachkritik vereint; diese kann nur lauten:
Sprachkritik ist Kritik an Sprache mit Sprache.
Gemeinsam ist jeder Kritik an Sprache also, dass sie sich der Sprache bedient, um eben dieselbe zu kritisieren. Trotz dieses offensichtlichen Zirkelschlusses kann man nicht umhin, festzustellen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als von einer Metaebene herab mit Sprache auf Sprache zu schauen. Eine sprachkritische Äußerung macht folglich von der metasprachlichen Funktion dadurch Gebrauch, dass etwas mit Sprache über Sprache ausgesagt wird, und sie gibt zusätzlich noch eine Bewertung desjenigen sprachlichen Gegenstands ab, über den die Aussage gemacht wird. Schiewe formuliert es in etwas anderen Worten: "Sprachkritik hat es mit dem Sollen von Sprache zu tun. Sie macht Aussagen darüber, wie Sprache ´aussehen` oder wie sie benutzt werden soll." Im Vergleich zur Sprachwissenschaft allgemein besteht der Unterschied darin, dass die Sprachkritik Bestehendes wertet, während die Sprachwissenschaft dies lediglich beschreibt.
Wie bereits erwähnt, ist Sprachkritik nicht gleich Sprachkritik. An dieser Stelle wird es notwendig, einen Überblick zu geben über all das was man unter Sprachkritik verstehen kann. Hierzu sollen zwei Autoren herangezogen werden, die sich bereits ausführlich mit dem Bereich ´Sprachkritik` befasst haben und dementsprechend die verschiedenen Arten differenziert und dargelegt haben. Heringers Versuch einer Systematisierung der Facetten der Sprachkritik soll den Anfang dieses einführenden, theoretischen Teils der Ausführungen zum Thema ´Sprachkritik` bilden, gefolgt vom Gliederungsvorschlag von Peter von Polenz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenstandsbestimmung - Formen der Sprachkritik
- Formen der Sprachkritik nach Heringer
- Formen der Sprachkritik nach von Polenz
- Allgemeine Bemerkungen zur vorliegenden Arbeit
- Der sprachkritische Weg ins 19. Jahrhundert
- Joachim Heinrich Campe - Der französische Traum in Deutschland
- Campes Sprachprogramm
- Sprachkritik des 19. Jahrhunderts
- Die erste Jahrhunderthälfte - Sprachkritik im Spiegel der Aufklärung
- Die Situation des Bürgertums zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- Klassengesellschaft als Ursache für Sprachkritik
- Die politische Öffentlichkeit in Deutschland
- Carl Gustav Jochmann - Sprache und Öffentlichkeit
- Die zweite Jahrhunderthälfte - Sprachkritik im Dienst sozialer Abgrenzung
- Jacob Grimm und der Sprachverfallsmythos
- Grundlegende Veränderungen im Gesellschaftssystem
- Kommunikative Folgen des gesellschaftlichen Wandels
- Die Verteidigung bildungsbürgerlichen Sprachkapitals
- Entkonturierung des Bildungsbürgertums und Verbürgerlichung von Adel und Arbeiterschaft
- Arthur Schopenhauer – Sprachskepsis und Sprachpessimismus
- Friedrich Nietzsche - Sprachkritik als Begriffskritik
- Friedrich 'Fritz Mauthner – Erkenntniskritik und Ideologiekritik
- Hugo von Hofmannsthal - (Ver-) Zweifeln an der Sprache
- Pressekritik - Zeitungsdeutsch im und unter Druck
- Ferdinand Kürnberger – Zeitungskritik im Zeitalter der Massenmedien
- Karl Kraus – Der Nörgler
- Anstelle eines Schlusswortes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über die Sprachkritik im 19. Jahrhundert. Ziel ist es, verschiedene Formen der Sprachkritik zu identifizieren und deren Entwicklung im Kontext gesellschaftlicher und politischer Veränderungen zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Darstellung unterschiedlicher Perspektiven und Ansätze innerhalb der Sprachkritik dieser Epoche.
- Entwicklung der Sprachkritik im 19. Jahrhundert
- Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Sprachkritik
- Unterschiede in den Formen und Ansätzen der Sprachkritik
- Bedeutende Persönlichkeiten der Sprachkritik im 19. Jahrhundert
- Sprachkritik und die Rolle der Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt fest, dass der Begriff „Sprachkritik“ vielschichtig ist und verschiedene Formen umfasst. Sie definiert Sprachkritik als Kritik an Sprache mittels Sprache und hebt den Unterschied zur deskriptiven Sprachwissenschaft hervor. Die Einleitung kündigt die Analyse der Sprachkritik anhand der Systematisierungen von Heringer und von Polenz an.
Gegenstandsbestimmung - Formen der Sprachkritik: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Systematisierungen von Sprachkritik. Heringers Ansatz differenziert zwischen philosophischer Sprachkritik, Kritik an einer Einzelsprache und Kritik an individuellen Äußerungen. Die Arbeit analysiert Heringers Kategorisierung, einschließlich seiner Betrachtung aus verschiedenen Bedeutungstheorien und der Zuordnung von Beschreibungsebenen. Die Komplexität und teilweise Überschneidungen von Heringers System werden diskutiert.
Der sprachkritische Weg ins 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Kontext der Sprachkritik im 19. Jahrhundert, beginnend mit der Arbeit von Joachim Heinrich Campe, dessen Sprachprogramm und dessen Bezug zum französischen Einfluss auf die deutsche Sprache analysiert wird.
Sprachkritik des 19. Jahrhunderts: Dieses Kapitel behandelt die Sprachkritik der ersten und zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die erste Hälfte wird im Kontext der Aufklärung betrachtet. Die zweite Hälfte zeigt Sprachkritik als Mittel der sozialen Abgrenzung auf, mit Fokus auf Persönlichkeiten wie Jacob Grimm, und den gesellschaftlichen Wandel und seine Auswirkungen auf Sprache und Kommunikation. Es werden die Verteidigung des bildungsbürgerlichen Sprachkapitals sowie die „Verbürgerlichung“ von Adel und Arbeiterschaft analysiert.
Schlüsselwörter
Sprachkritik, 19. Jahrhundert, Aufklärung, Sprachverfall, Sprachgeschichte, Bildungsbürgertum, Gesellschaftlicher Wandel, Medien, Pressekritik, Philosophische Sprachkritik, Einzelsprachkritik, Sprachsystem, Sprachverwendung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text "Sprachkritik im 19. Jahrhundert"
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Sprachkritik im 19. Jahrhundert. Er untersucht verschiedene Formen der Sprachkritik, deren Entwicklung im Kontext gesellschaftlicher und politischer Veränderungen und die Perspektiven und Ansätze innerhalb dieser Epoche.
Welche Formen der Sprachkritik werden behandelt?
Der Text analysiert verschiedene Systematisierungen von Sprachkritik, insbesondere die Ansätze von Heringer (philosophische Sprachkritik, Kritik an einer Einzelsprache, Kritik an individuellen Äußerungen) und von Polenz. Es werden unterschiedliche Perspektiven, von Sprachskepsis und -pessimismus bis hin zur Sprachkritik als Begriffskritik und Ideologiekritik, beleuchtet.
Welche historischen Figuren werden im Text behandelt?
Der Text behandelt bedeutende Persönlichkeiten der Sprachkritik im 19. Jahrhundert, darunter Joachim Heinrich Campe, Carl Gustav Jochmann, Jacob Grimm, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Friedrich Mauthner, Hugo von Hofmannsthal, Ferdinand Kürnberger und Karl Kraus. Ihre Ansätze und Beiträge zur Sprachkritik werden im Kontext ihrer Zeit analysiert.
Welchen Einfluss hatten gesellschaftliche Veränderungen auf die Sprachkritik?
Der Text betont den starken Einfluss gesellschaftlicher und politischer Veränderungen auf die Sprachkritik des 19. Jahrhunderts. Der Aufstieg des Bürgertums, die Entwicklung der Massenmedien (insbesondere der Zeitungen) und der gesellschaftliche Wandel (z.B. die Entkonturierung des Bildungsbürgertums und die Verbürgerlichung von Adel und Arbeiterschaft) werden als wichtige Faktoren für die Entwicklung verschiedener Formen der Sprachkritik betrachtet. Die Sprachkritik wird teilweise als Mittel der sozialen Abgrenzung dargestellt.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Gegenstandsbestimmung (Formen der Sprachkritik), Der sprachkritische Weg ins 19. Jahrhundert, Sprachkritik des 19. Jahrhunderts (unterteilt in die erste und zweite Jahrhunderthälfte) und Anstelle eines Schlusswortes. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der behandelten Themen und wichtigen Persönlichkeiten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Sprachkritik, 19. Jahrhundert, Aufklärung, Sprachverfall, Sprachgeschichte, Bildungsbürgertum, Gesellschaftlicher Wandel, Medien, Pressekritik, Philosophische Sprachkritik, Einzelsprachkritik, Sprachsystem, Sprachverwendung.
Welche Ziele verfolgt der Text?
Der Text verfolgt das Ziel, einen Überblick über die vielschichtigen Formen der Sprachkritik im 19. Jahrhundert zu geben und deren Entwicklung im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen zu untersuchen. Er will unterschiedliche Perspektiven und Ansätze innerhalb der Sprachkritik dieser Epoche darstellen.
- Citation du texte
- Antje Leupold (Auteur), 2002, Sprachkritik im 19. Jahrhundert - Ein Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10283