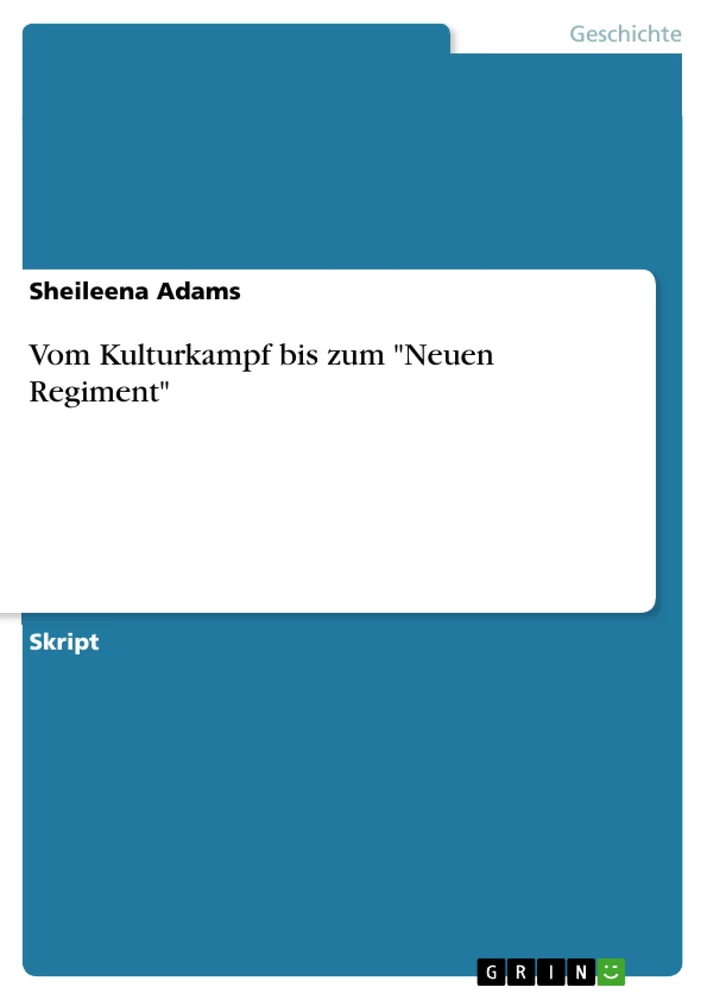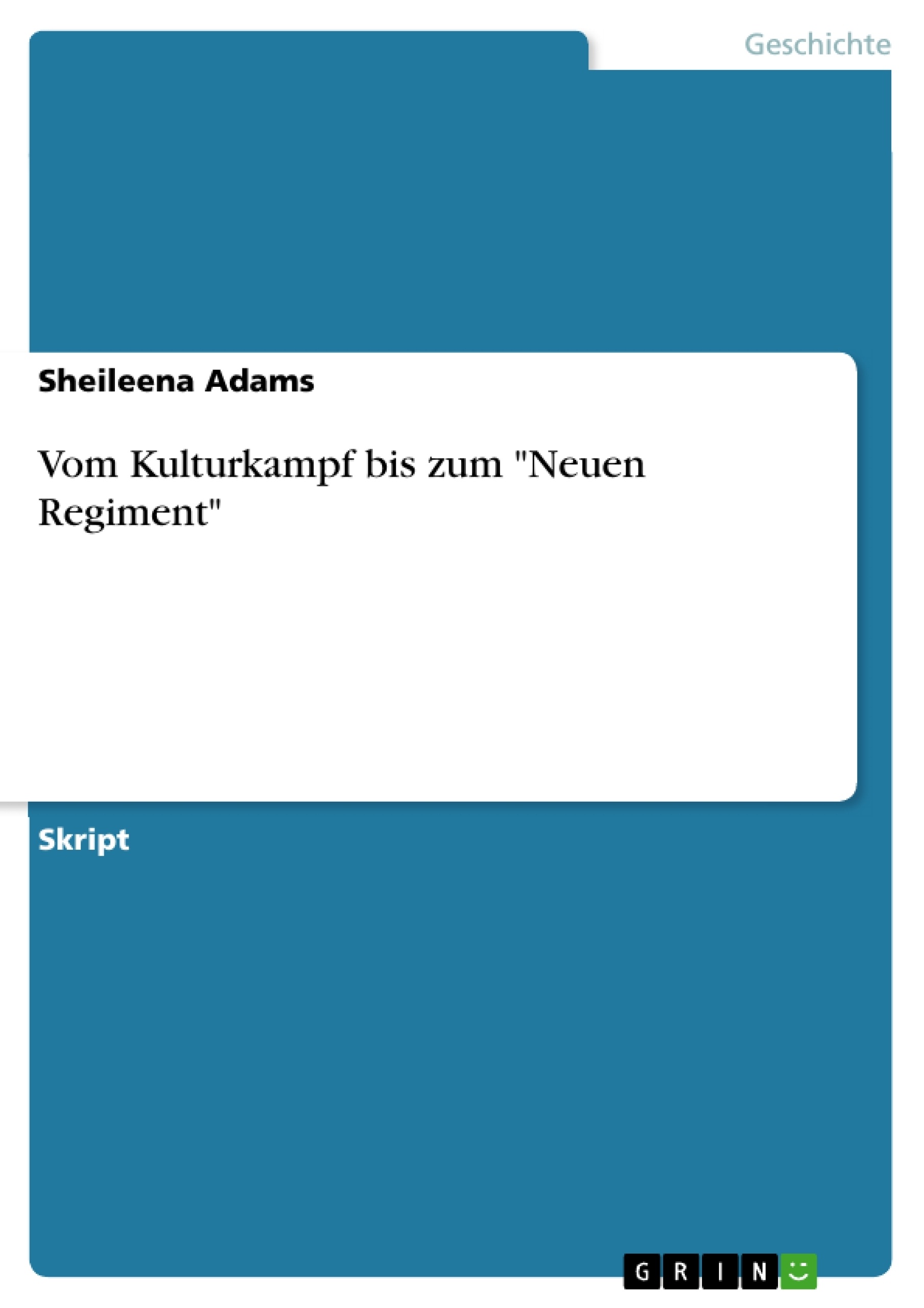Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Zentrumspartei und Kulturkampf (1871 bis 1878)
⇒ Deutsche Katholiken waren eine Minderheit versuchten aber schon vor 1848 ihre konfessionellen Interessen in der Politik geltend zu machen. Aus Misstrauen gegenüber dem protestantischen Preußentum und der liberalen Kirchenferne entstand seit 1866/1867 mit Hilfe des Klerus eine katholische Volksbewegung.
⇒ 1870 wurde die Zentrumspartei im preußischen Abgeordnetenhaus gegründet. Die Deutsche Zentrumspartei von 1871 war sozial die einzige Volkspartei im heutigen Sinn. Sie repräsentierte alle katholischen Schichten vom Hochadel bis zu den Kleinbauern und Handwerkern.
⇒ Die römische Kirche widersetzte sich aber der materialistischen oder evolutionistischen Weltanschauung und den Wirkungen der Ideen von 1789. Das auf dem I. Vatikanischen Konzil 1870 verkündete Unfehlbarkeitsdogma galt zwar nur für päpstliche Dogmenentscheidungen in Glaubens- und Sittenfragen, aber es verstärkte die Absage an die moderne politische Entwicklung vom Liberalismus zum Sozialismus.
⇒ Die rechtliche Liberalisierung der Gesellschaft im Deutschen Reich traf die Kirche im Eherecht und im Bildungswesen, da sie noch immer an der Rechtsgültigkeit von kirchlich geschlossenen Ehen, am Scheidungsverbot und am kirchlichen Einfluss auf Schulen und Universitäten fest hielt.
⇒ Im Reichstag propagierte die Zentrumspartei als zweitstärkste Fraktion weitere spezifische katholische Programmpunkte wie die Unabhängigkeit kirchlicher Institutionen, staatliche Sozialpolitik und Föderalismus. Insgesamt sollten die bundesstaatlichen Rechte gegenüber dem Reich gefestigt werden, wovon sich eher katholische Staaten wie Bayern Vorteile versprachen.
⇒ 1871 führten erste Spannungen zwischen Liberalen und Katholiken in der preußischen Kulturgesetzgebung zum „Kanzelparagraphen“ im Reich. Dieser stellte die Erörterung politischer Angelegenheiten durch Geistliche in ihrer Amtsausübung unter Gefängnisstrafe.
⇒ 1872 entzog das preußische Schulaufsichtsgesetz den Kirchen ihren bisherigen Einfluss auf die Volksschulen und das gegen den Willen der protestantischen Kirche. Zudem wurde der Jesuitenorden verboten.
⇒ 1873 kam es zum Höhepunkt des Kulturkampfes durch das Inkrafttreten der Maigesetze. Geistliche mussten nun vor dem Staat ein Kulturexamen ablegen und ein Studium an einer deutschen Universität nachweisen. Ab 1875 wurden standesamtlich geschlossene Zivilehen Pflicht. Es wurden auch alle geistlichen Orden außer den rein karitativen verboten.
⇒ Viele Priester und Bischöfe verstießen gegen die Gesetze und kamen ins Gefängnis oder gingen ins Exil. Trotzdem stand das katholische Kirchenvolk hinter den Geistlichen und die Stimmenanzahl der Zentrumspartei stieg in allen Wahlen, so dass sie zur stärksten Reichstagsfraktion wurde.
⇒ Die Motive Bismarcks für den Kulturkampf lagen im Misstrauen vor einem katholischen, reichsfeindlichen Sonderinteresse mit unberechenbaren Bindungen zum Ausland, da sich die Zentrumspartei auch für die katholischen Polen im Osten Preußens einsetzte. Ohne die Zentrumspartei schien ihm ein Parlament leichter zu lenken, aber der Misserfolg des Kulturkampfes war nicht zu übersehen.
⇒ Bismarck lenkte erst zum Papstwechsel 1878 (Leo XIII. wird nach Pius IX. Papst) ein. Dennoch blieb die Trennung von Staat und Kirche trotz der Aufgabe der Kampfgesetze bis heute bestehen.
- Sozialdemokratie, Sozialistengesetz und Bismarcks Sozialgesetzgebung
⇒ Nachdem Lassalles 1863 die Arbeiterpartei ADAV gründete gewannen August Bebel und Wilhelm Liebknecht über die SDAP von 1869 Einfluss auf die deutsche Arbeiterbewegung. Seit 1871 vertrat Bebel auch seinen sächsischen Wahlkreis im Reichstag.
⇒ Im Gegensatz zu den Anhängern Lassalles lehnten die Eisenacher die Kriegs- und Annexionspolitik Bismarcks zur deutschen Einheit ab. Zudem verurteilten sie die Reichsgründung als fürstliche Versicherungsanstalt gegen die Demokratie. Für das Eintreten für den Klassenkampf und die Pariser Kommune erhielten Bebel und Liebknecht je zwei Jahre Festungshaft wegen Hochverrat und obwohl sie nur eine kleine Partei vertraten galten sie als gemeingefährliche Reichsfeinde.
⇒ Doch die Wirtschaftskrise, die Lohnsenkungen und Wohnungsprobleme in den Industriezonen brachten ihnen einige Wählerstimmen ein (1871: 3,2%, 1874:6,8%). 1875 schlossen sich die Eisenacher und die Lasseaner in Gotha zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) zusammen und organisierten im Laufe der Zeit immer mehr Streiks zum Schutz der Arbeiterinterssen. Jedoch sahen viele einflussreiche Unternehmer ihre Betriebe als gefährdet an und forderten ein staatliches Eingreifen gegen diese Umsturzpartei. Auch die Schuld der Absatzkrise wurde der wachsenden Arbeiterbewegung zugeschrieben.
⇒ 1878 begann Bismarck die Gegenoffensive mit einem konstruierten Zusammenhang zwischen der SAP und zwei missglückten Attentaten auf den Kaiser. Nach zwei Anläufen erwirkte er so im Reichstag ein Gesetz, dass die Partei und ihre nahestehenden Gewerkschaften sowie Veranstaltungen und jegliche Öffentlichkeitsarbeit in Literatur und Presse verbot. Dies geschah aber aus verfassungsrechtlichen Gründen und damit war ihre Beteiligung an Wahlen weiterhin erlaubt. Die Parteiarbeit erfolgte nun aus dem Untergrund und aus dem Exil heraus, aber auch in der Reichstagsfraktion.
⇒ Doch auch christlich-konservative und liberale Stimmen kritisierten, dass sich mit der politischen Unterdrückung keine sozialen Probleme der Arbeiter lösen lassen. Um einer weiteren Entfremdung des Arbeiterstandes gegenüber dem Staat entgegen zu wirken begann Bismarck mit der zur damaligen Zeit hochmodernen Sozialgesetzgebung.
⇒ 1883 beschloss der Reichstag die Krankenversicherung, 1884 die Unfallversicherung und 1889 die Alters- sowie Invalidenversicherung.
Dadurch das der Staat sich für die Arbeiter einsetzte hoffte Bismarck auf die Rückgewinnung ihrer Loyalität. Doch die Leistungen fielen anfangs nur gering aus.
⇒ Das schützende Eingreifen des Staates in den Arbeitsmarkt und die Zwangsfinanzierung der Sozialleistungen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer widersprachen den liberalen Vorstellungen einer möglichst staatsfreien Wirtschaft. Der Interventionsstaat regulierte zunehmend das freie Spiel der Kräfte durch die Wirtschafts- und Sozialgesetzgebung.
⇒ Jedoch wählten immer mehr Arbeiter sozialistisch und die Stimmenanzahl der SAP wuchs von 437000 (Reichstagswahl 1878) auf fast 1½ Millionen (1890). Die Ursachen für das Scheitern der Bismarckschen Doppelstrategie „Zuckerbrot und Peitsche“ gegen die Sozialdemokratie lagen im steigenden Misstrauen der Arbeiterschaft. Sie meinten noch zu wenig am wachsenden Wohlstand der Gesellschaft teilzuhaben und zu wenig politisches Mitspracherecht in den Parlamenten zu besitzen.
⇒ Dennoch dämpfte die Einbindung der Arbeiter in den Sozialstaat durch spürbare Reformen ihren politische Radikalismus und eröffnete die Möglichkeit einer Reform an Stelle einer Revolution. Für die sozialdemokratischen Funktionäre und Gewerkschaftler wurde ein klassenkämpferisches Auftreten und eine pragmatische Zusammenarbeit bei Reformen in Betrieben und Staat typisch. 1891 wurde die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) wieder zugelassen.
- Das Reich im europäischen System - Bismarcks Kontinentalpolitik
⇒ Bismarck war sich über die gefährdete Stellung des Deutschen Reichs im Klaren und wollte einen europäischen Krieg mit deutscher Beteiligung verhindern. 1871 erklärte er Deutschland als saturiert (= zufriedengestellt) und setzte keine weiteren expansiven Ziele auf Kosten anderer um die Zusammenarbeit mit allen Mächten zu eröffnen.
⇒ Bismarck suchte seine Partner im befreundeten Russland, das als Vielvölkerstaat Interesse an stabilen Verhältnissen in Mitteleuropa hatte. Trotz russisch-österreichischer Rivalitäten schlossen der Zar, sowie der Berliner und der Wiener Kaiser 1873 auf dem Balkan das Drei-Kaiser- Abkommen um den Status quo in Europa zu garantieren.
⇒ 1875 führte Frankreich eine Heeresreform durch und begann aufzurüsten, was deutsche Ängste schürte. Während dieser Krieg-in-Sicht- Krise verlangte Bismarck das Wiederabrüsten, gelangte aber schnell an die Grenzen des deutschen Spielraums im Europäischen System. Russland und England würden einen Präventivkrieg Deutschlands gegen Frankreich nicht zulassen. 1877 fasste Bismarck seine Ansichten über die außenpolitische Situation des Reiches im Kissinger Diktat zusammen.
⇒ Der Balkan brachte chronische Unruhe in das europäische System und besonders die Auflösung des Osmanischen Reiches erschütterte ganz Europa. Aufstände in Bosnien und Herzegowina sowie Niederlagen Serbiens und Montenegros, die zu Hilfe geeilt waren (1875 und 1876), riefen Russland auf den Plan. Im nunmehr achten russisch-türkischen Krieg (1877 und 1878) siegte das Zarenreich mit rumänischer und bulgarischer Unterstützung und russische Soldaten kamen bis nach Konstantinopel. Im Vorfrieden von San Stefano musste die Türkei demzufolge fast den gesamten Balkan zu Gunsten Serbiens und dem neu geschaffenen Großbulgarien räumen.
⇒ Nur England war gegen diesen Ausgang, da es hinter der Expansion auf dem Balkan das russische Ziel erkannte: die Beherrschung der Meerengen um der Schwarzmeerflotte Zugang zum Mittelmeer zu verschaffen. Bismarck stellte sich 1878 in diesem Konflikt auf dem Großmächtekongress in Berlin als „ehrlichen Makler“ dar. Serbien, Montenegro und Rumänien wurden in diesem Zuge unabhängig, Bulgarien aber erheblich beschnitten. Österreich- Ungarn erhielt zudem die Erlaubnis Bosnien-Herzegowina zu besetzen, was besonders die öffentliche Meinung Russlands von Bismarck enttäuschte.
⇒ Russland spekulierte schon seit den deutschen Getreideschutzzöllen und der Sperrung der Berliner Börse für russische Staatsanleihen 1879 (Lombardverbot) über eine Annäherung an Frankreich. Zu einem Bündnis mit einer westlichen Republik entschloss man sich doch nicht und 1881 wurde das Drei-Kaiser-Bündnis, das gegenseitige Neutralität bei Verwicklungen mit einer vierten Macht zusagte, von Zar Alexander II. erneuert.
⇒ 1879 sicherten sich Deutschland und Österreich-Ungarn im Zweibund als Defensivallianz gegen Russland mit wohlwollender Neutralität. Zum Schutz vor Frankreich trat Italien 1882 diesem Bündnis bei, wodurch es zum Dreibund erweitert wurde.
⇒ 1885 wurde das Drei-Kaiser-Abkommen durch erneute Spannungen auf dem Balkan über Bulgarien entwertet und Bismarck sicherte sich 1887 mit einem geheimen Rückversicherungsvertrag mit Russland vor einem nun möglichen Zweifrontenkrieg. Der Vertrag legte die gegenseitige Neutralität im Krieg mit Drittmächten fest, duldete aber einen deutschen Angriff auf Frankreich oder einen russischen auf Österreich-Ungarn. In einem geheimen Zusatzprotokoll unterstützte Deutschland eine russische Expansion auf die türkischen Meerengen, obwohl im gleichen Jahr mit Bismarcks Billigung der Orientdreibund (Mittelmeerallianz) zwischen Österreich-Ungarn, Italien und England entsteht, der die türkische Hoheit auf diesem Gebiet garantiert.
⇒ Bismarck hoffte durch diese Außenpolitik alle Spannungen auf die Randgebiete Europas lenken zu können, obwohl Deutschland im Falle eines Krieges durch beide Allianzen in starke Bedrängnis gekommen wäre. Er verfolgte das Ziel keine Gefahren in der Mitte Europas heraufzubeschwören um Deutschland nicht durch Provokation zu isolieren. Bismarck wurde 1890 entlassen, der Rückversicherungsvertrag nicht erneuert.
- Kaiser Wilhelm II. und das „persönliche Regiment“
⇒ 1888 waren drei deutsche Kaiser an der Macht. Nach dem Tod Wilhelms I. folgte ihm sein Sohn Friedrich III. auf den Thron. Auf Grund seiner Vorliebe für England war er die Hoffnung für reformwillige Liberale, doch er starb schon nach 99 Tagen an Krebs. Wilhelms I. zweiter Sohn Wilhelm II. verkörperte mit seinen 29 Jahren das junge dynamische Deutschland, das mit Stolz auf die Leistungen der Nation schaute und große Erwartungen an die Zukunft hegte. Doch er trat auch gerne großspurig auf um das Gefühl deutscher Stärke in der Welt auszudrücken.
⇒ Der bisherige Lenker der Reichspolitik unter dem Vertrauen Wilhelms I. Bismarck stand aber den Ideen des neuen, selbstbewussten Kaisers im Weg. Dieser wollte vor allem und entgegen der Reichsverfassung selbst reagieren um so eine Art kaiserlichen Neoabsolutismus durchsetzen. Durch das Entgegenkommen nach dem großen Streik mit 90000 Ruhrbergarbeitern 1889 bemühte er sich um das Vertrauen der Arbeiterschaft. Über Bismarck hinweg regte Wilhelm II. eine große sozialreformerische Offensive an und wandte sich so gegen dessen Vorhaben die Sozialistengesetze zu erneuern. Zusätzliche Differenzen über den außenpolitischen Kurs Deutschlands verschärften die Spannungen. Während sich Bismarcks Kontinentalpolitik auf Mitteleuropa und die Wahrung des Erreichten beschränkte, wollte der Kaiser Deutschland durch seine Weltpolitik zu einer tonangebenden Weltmacht erheben und so England überholen.
⇒ Am 20. März 1890 wurde Bismarck entlassen und bis 1894 übernahm General Leo von Caprivi sein Amt. Ihm fehlte allerdings die Autorität des Reichsgründers um seinen Modernisierungsplan durchzusetzen. Wilhelm II. wollte ohnehin dem Kanzler nur eine zweitrangige Rolle zuweisen. Der Kaiser griff ständig mit impulsiven Anweisungen oder öffentlichen Meinungsäußerungen in die Politik ein. Er nahm dabei aber keine Rücksicht auf innen- oder außenpolitische Realitäten, was seinen persönlichen Stil besonders ausmachte. Zudem besaß er eine Vorliebe für militärische Formen und Sprache sowie starkes Imponiergehabe und spontane Begeisterung für moderne Technik.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Hauptgründe für den Kulturkampf im Deutschen Reich?
Der Kulturkampf wurde durch das Misstrauen gegenüber dem Katholizismus seitens des protestantischen Preußentums und liberaler Kräfte ausgelöst. Die Zentrumspartei, die die katholischen Interessen vertrat, widersetzte sich den materialistischen und evolutionistischen Weltanschauungen sowie den liberalen Tendenzen der Zeit. Konflikte entstanden besonders im Eherecht, im Bildungswesen und in der Frage der staatlichen Kontrolle über kirchliche Institutionen.
Welche Gesetze wurden während des Kulturkampfes erlassen?
Zu den wichtigsten Gesetzen des Kulturkampfes gehörten der "Kanzelparagraph" (1871), das preußische Schulaufsichtsgesetz (1872), die Maigesetze (1873) und die Einführung der Zivilehe (1875). Diese Gesetze schränkten den Einfluss der Kirche im Bildungsbereich ein, unterstellten Geistliche staatlicher Kontrolle und verboten religiöse Orden.
Was war Bismarcks Motivation für den Kulturkampf?
Bismarck misstraute der Zentrumspartei und befürchtete, dass sie eine reichsfeindliche Sonderrolle einnehmen könnte, insbesondere aufgrund ihrer Unterstützung für die katholischen Polen in Preußen. Er hoffte auch, das Parlament ohne die Zentrumspartei leichter lenken zu können. Der Kulturkampf erwies sich jedoch als Misserfolg.
Wie reagierte die katholische Bevölkerung auf den Kulturkampf?
Trotz Repressionen und Verfolgungen unterstützte die katholische Bevölkerung ihre Geistlichen und die Zentrumspartei, was zu einem Anstieg der Stimmenanzahl der Zentrumspartei bei den Reichstagswahlen führte.
Welche Ziele verfolgte die Sozialdemokratie im Deutschen Reich?
Die Sozialdemokratie, insbesondere die SAP (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands), setzte sich für die Interessen der Arbeiterklasse ein, forderte soziale Gerechtigkeit und kritisierte die bestehenden gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Sie organisierte Streiks und forderte staatliche Maßnahmen zum Schutz der Arbeiter.
Wie reagierte Bismarck auf die wachsende Sozialdemokratie?
Bismarck reagierte zunächst mit Repressionen, indem er 1878 das Sozialistengesetz erließ, das die Partei und ihre Aktivitäten verbot. Gleichzeitig führte er eine Sozialgesetzgebung ein, die Kranken-, Unfall- und Altersversicherungen umfasste, um die Loyalität der Arbeiter zum Staat zurückzugewinnen.
Was umfasste Bismarcks Sozialgesetzgebung?
Die Sozialgesetzgebung umfasste die Krankenversicherung (1883), die Unfallversicherung (1884) und die Alters- sowie Invalidenversicherung (1889). Diese Maßnahmen waren zu ihrer Zeit hochmodern und sollten die soziale Lage der Arbeiter verbessern.
Warum scheiterte Bismarcks Strategie gegen die Sozialdemokratie?
Obwohl die Sozialgesetzgebung einige Verbesserungen brachte, wuchs das Misstrauen der Arbeiter gegenüber dem Staat, da sie sich nicht ausreichend am wachsenden Wohlstand beteiligt fühlten und mehr politisches Mitspracherecht forderten. Trotz der Sozialgesetze wuchs die Anhängerschaft der Sozialdemokratie stetig.
Was waren die Grundzüge von Bismarcks Außenpolitik nach 1871?
Bismarcks Außenpolitik zielte darauf ab, das Deutsche Reich im europäischen Mächtesystem zu stabilisieren und einen Krieg zu verhindern. Er erklärte Deutschland als "saturiert" und setzte auf Zusammenarbeit mit anderen Mächten, insbesondere Russland und Österreich-Ungarn. Er versuchte, Spannungen auf die Randgebiete Europas zu lenken und eine Isolierung Deutschlands zu vermeiden.
Welche Bündnisse schloss Bismarck, um das Reich zu sichern?
Bismarck schloss das Drei-Kaiser-Abkommen (1873 und 1881), den Zweibund mit Österreich-Ungarn (1879), den Dreibund mit Italien und Österreich-Ungarn (1882) und den Rückversicherungsvertrag mit Russland (1887). Diese Bündnisse sollten Deutschland vor Angriffen schützen und das europäische Gleichgewicht wahren.
Was versteht man unter dem „persönlichen Regiment“ Kaiser Wilhelms II.?
Das „persönliche Regiment“ Kaiser Wilhelms II. bezeichnet seine Tendenz, die Politik des Reiches selbstständig zu lenken, oft entgegen den Ansichten seiner Berater und Minister. Er mischte sich impulsiv in die Innen- und Außenpolitik ein und verfolgte eine Weltpolitik, die auf die Stärkung des deutschen Einflusses und Prestiges in der Welt abzielte.
Wie unterschied sich Wilhelms II. Außenpolitik von der Bismarcks?
Während Bismarcks Kontinentalpolitik auf die Stabilisierung Mitteleuropas ausgerichtet war, verfolgte Wilhelm II. eine aggressive Weltpolitik, die darauf abzielte, Deutschland zu einer führenden Weltmacht zu machen und England zu überholen. Dies führte zu Spannungen und einer veränderten Bündnispolitik.
Was waren die Merkmale des Wilhelminismus?
Der Wilhelminismus war geprägt von technischer Perfektion, äußerlichem Glanz, Fortschrittsbewusstsein und Dynamik, aber auch von einem Mangel an Verständnis für demokratische Ansprüche auf politische Mitbestimmung. Er war auch gekennzeichnet durch militärische Formen und Sprache sowie Imponiergehabe.
- Quote paper
- Sheileena Adams (Author), 2001, Vom Kulturkampf bis zum "Neuen Regiment", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102900