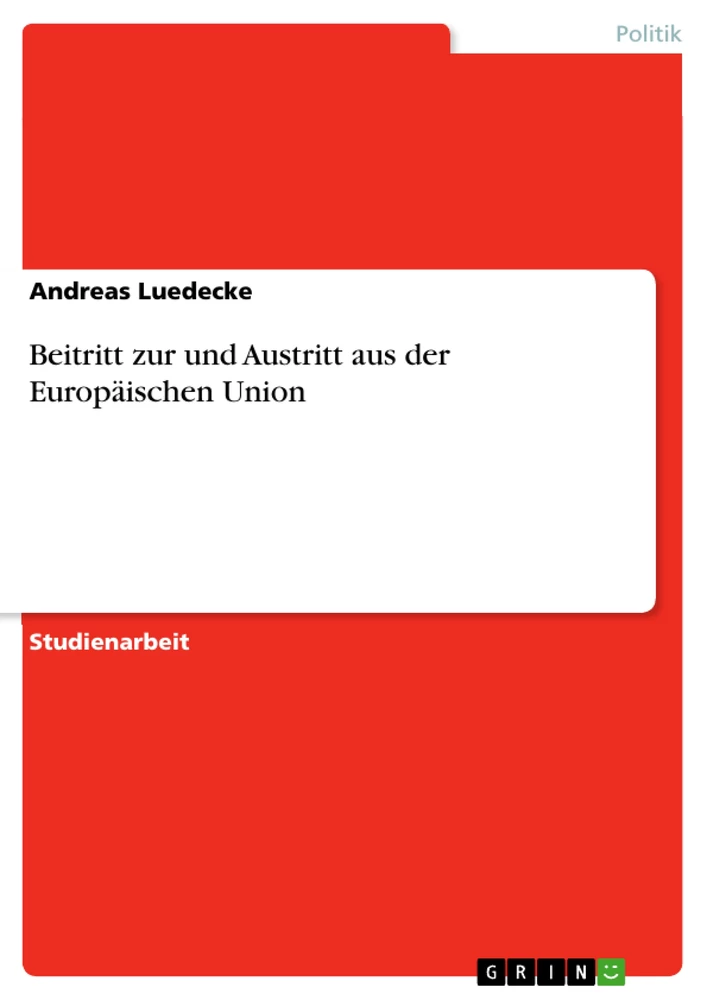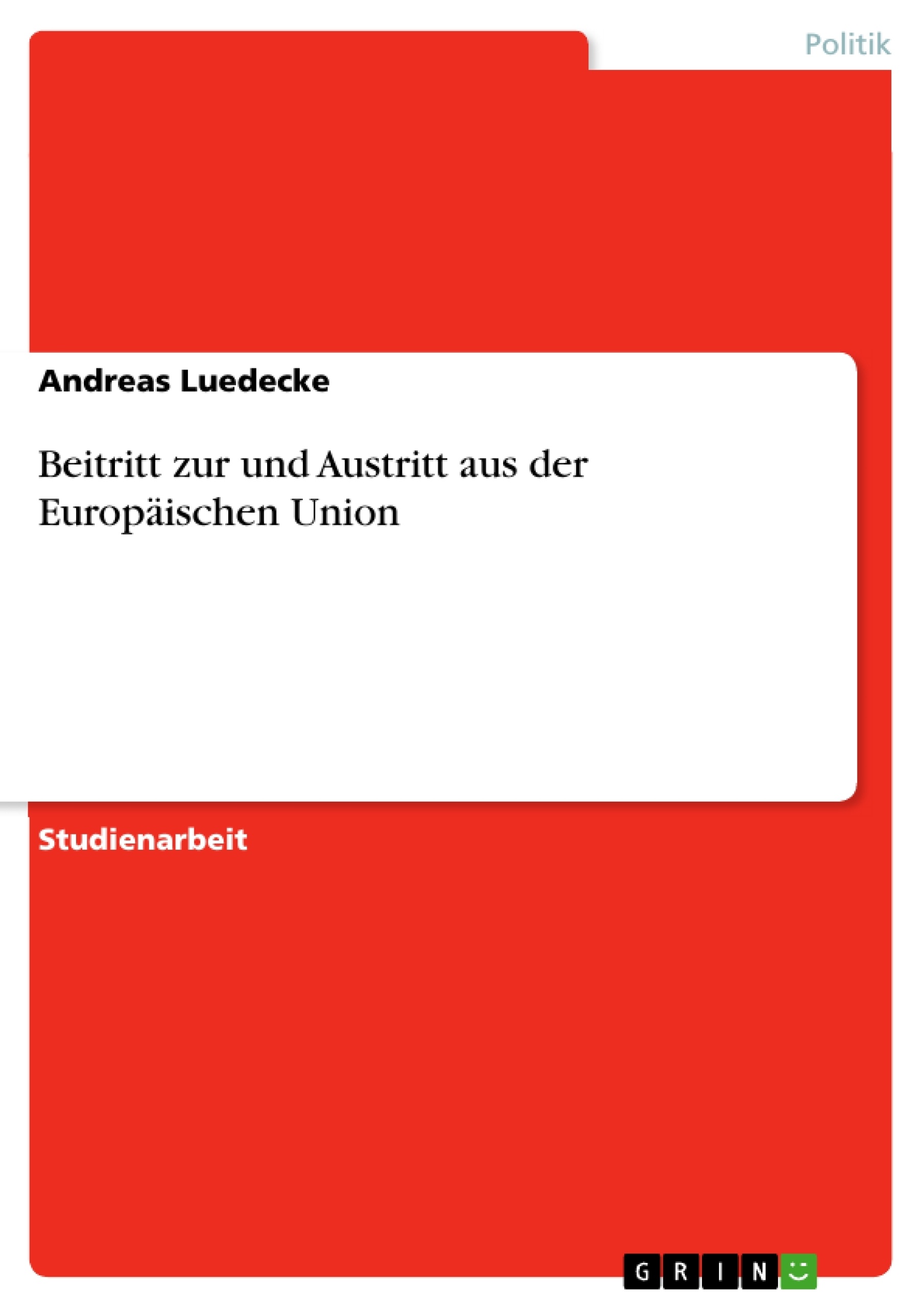Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Beitritt zur Europäischen Union
2.1 Aufnahmebedingungen
2.2 Durchführung des Beitritts
2.3 Vorbeitrittshilfen
3. Austritt, Ausschluss und Suspendierung aus der Europäischen Union
3.1 Austritt aus der Europäischen Union
3.2 Ausschluss aus der Europäischen Union
3.3 Suspendierung von Mitglieds chaftsrechten
4. Fazit
1. Einführung
Einleitend zu diesem Thema möchte ich das Hauptaugenmerk auf den Beitritt zur Europäischen Union lenken.
Seit der Gründung der Europäischen Union wurden immer wieder neue Kriterien festgesetzt, die sich an den sozial- politischen Hintergründen sowie den wirtschaftlichen und finanziellen Strukturen der Mitgliedsländer und des Marktes orientieren. Dieser langjährige Prozess der Annäherung und institutioneller Zusammenarbeit liegt in der Beschließung von den drei verschiedenen Verträgen „Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ (EGKS, 1952), „Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft“ (EWG, 1957) und der „Europäischen Atomgemeinschaft“ (EAG, 1957) begründet. Die institutionellen Verbindungen der drei Gemeinschaften gab es von Anfang an in Form des gemeinsamen Gerichtshofes, Europäischer Gerichtshof (EuGH), und einer „beratenden Versammlung“, welche heute das Europäische Parlament darstellt.
Durch den Unionsvertrag von Maastricht (1992/93) kamen zu den zuvor genannten drei „Säulen“ zwei weitere hinzu, welche zum Einen die „Außen- und Sicherheitspolitik“ und zum Anderen die „Innen- und Justizpolitik“ umfassen.
Als gemeinsames „Dach“ dieser fünf „Säulen“ ist der Vertrag über die Europäische Union (EUV) und der Vertrag zur Gründung der Europäischen Union (EGV) maßgeblich.
In mehreren Beitrittsrunden (1973: Dänemark, Irland und Vereinigtes Königreich; 1981: Griechenland; 1986: Spanien und Portugal; 1995: Österreich, Finnland und Schweden) hat sich die EU von 6 auf 15 Mitglieder vergrößert.
Mit dem Fall der „Berliner Mauer“ öffnete sich die Europäische Union den mittel- und osteuropäischen Staaten.
Die Osterweiterung der Europäischen Union ist ein wichtiger Schritt zur Integration in ein friedliches und stabiles Europa für das 21. Jahrhundert. Vor dem Hintergrund der deutschen Wiedervereinigung wurden die absehbaren volks- wirtschaftlichen Herausforderungen der Osterweiterung sichtbar. Nicht eine quantitative Erweiterung sollte der qualitativen Vertiefung der Integration zum „Opfer“ fallen. Zur Verwirklichung dieser Ziele, wurden in erster Instanz Assoziationsabkommen1zwischen den beitretenden Ländern und der Europäischen Union verfasst, welche eine Verstärkung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, sowie Aufbau und Ausbau der Wirtschaft und Anhebung des Beschäftigungsstandes und der Lebensbedingungen der Beitrittsländer festschreibt.
Im weiteren werde ich die Thematik des Austritts, Ausschluss und der Suspendierung aus der Europäischen Union darlegen. Jedoch kann ich vorweg nehmen, dass es aufgrund der heutigen Rechtslage keinen Austritt gab und gibt.
Es besteht jedoch die Möglichkeit der Suspendierung von natürlichen und juristischen Personen der Mitgliedstaaten in Mitgliedschaftsrechten.
2. Beitritt zur Europäischen Union
2.1 Aufnahmebedingungen
Nach Artikel 49 EUV2, kann jeder europäische Staat beantragen Mitglied der Union zu werden, sofern er die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Grundsätze achtet.
Da es sich bei der Europäischen Union um keine rechtsfähige internationale Organisation handelt, kann ihr im rechtlichen Sinne gar nicht beigetreten werden. Als „Mitglied der Union“ definiert man daher den Beitritt zu den drei Kernsäulen, den Gründungsverträgen der Europäischen Gemeinschaft (EG, EAG und EGKS) unter gleichzeitiger intergouvernementalen Beteiligung an GASP und PJZS.
Die grundlegenden Voraussetzungen sind im Artikel 6 EUV3verankert. Im Zuge der Mittel- und Osterweiterung hat der Europäische Rat von Kopenhagen am 21./22. Juni 1993 die folgenden „Kopenhagener Kriterien“ zusammengefasst.
I. Geographisches Kriterium
Europäischer Staat
II. Politische Kriterien
a) Rechtsstaatliche Ordnung
b) Demokratische Ordnung
c) Schutz der Grund- und Menschenrechte
d) Schutz der Minderheiten
III. Wirtschaftliche Kriterien
a) Funktionsfähige Marktwirtschaft
b) Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten
IV. Sonstige aus der Mitgliedschaft erwachsende Verpflichtungen
a) Übernahme der Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion
b) Übernahme des »gemeinsamen Besitzstandes«4 der EU
c) Kapazität von Verwaltung und Justiz zur Anwendung des gemeinsamen Besitzstandes
2.2 Durchführung des Beitritts
Das Beitrittsland richtet seinen Antrag an den Europäischen Rat, welcher nach Anhörung der Kommission sowie der Zustimmung der Mehrheit des Europäischen Parlaments dem Aufnahmeantrag zustimmt. Sodann können die erforderlichen Anpassungen der Verträge durchgeführt werden.
Die Beitrittsländer müssen den Rechtsbestand der EU komplett übernehmen. In diesem Rahmen werden Übergangsregelungen getroffen, um entstehende Konflikte beim Beitritt abzufedern.
Der gesamte Gemeinschaftsbestand wird untergliedert in 31 Kapitel5, welche die EU-Standards klar definieren. Angefangen beim „Freien Warenverkehr“ definieren sie über „Sozial- und Beschäftigungspolitik“, „Kultur / Audiovisuelles“, nur um einige Kapitel zu nennen, den festgesteckten Rahmen des Beitritts. Die Kapitel „30 Institutionen“ und „31 Sonstiges“ wird erst nach Abschluss der vorherigen 29 Kapiteln geöffnet, und mit Maßgaben gefüllt.
Die Kommission führt anhand der Kapitel für jedes Land ein „Screening“ durch, in dem die analytische Prüfung über die Beitrittsreife des Beitrittslandes vorgenommen wird. Anhand der zugrunde gelegten „Screenings“ werden dann mit den Beitrittsländern gemeinsame Positionen6verhandelt und ausgearbeitet. Die Ergebnisse aus diesen Verhandlungen werden kapitelweise auf Beitrittskonferenzen auf AM-Ebene verabschiedet. Sofern nicht weiterer Handlungsbedarf besteht werden diese Kapitel vorläufig geschlossen. Andernfalls wird beschlossen, auf diese Kapitel später zurückzukommen, wenn
-Anträge auf Übergangsregelungen vorliegen die erst zu einer späteren Verhandlungsphase, in Kenntnis aller beitrittsrelevanten Informationen und Positionen angemessen bewertet werden können.
-Zusätzlicher Informationsbedarf der EU besteht
2.3 Vorbeitrittshilfen
Im Rahmen der Übergangsregelungen können den Beitrittsländer durch die EU sogenannte Heranführungshilfen gewährt werden. Da der Übergang der MEOL7in ein demokratisches und rechtsstaatliches System, sowie in eine funktionierende Marktwirtschaft eine außergewöhnliche Belastung darstellte, musste der entstehende Angleichungsbedarf an die hohen EU-Standards, z. B. in den Bereichen Umweltschutz und dem Transportsektor durch finanzielle Mittel unterstützt werden.
Diese Unterstützungen gliedern sich in drei Programme auf, die wie folgt definiert und gewichtet werden:
-PHARE Gesamtanteil - 50% an den Vorbeitrittshilfen Bereich Verwaltungsaufbau (30%) Unterstützung bei der Übernahme des EU-Besitzstandes (70%)
-ISPA - Gesamtanteil - 35% an den Vorbeitrittshilfen Bereich Infrastrukturprojekte
-SAPARD - 15 % an den Vorbeitrittshilfen Bereich Landwirtschaft Beratende Unterstützung
Neben der finanziellen Unterstützung, ist auch die beratende Funktion der EU ein wichtiger Bestandteil des Verwaltungsaufbaus. Im Rahmen dieser Beratungshilfe werden Verwaltungspartnerschaften8zwischen den Behörden der EU- Mitgliedstaaten und der Beitrittsländer gebildet. Ziel dieser Initiative ist es, die Beitrittsländer durch Experten der Bereiche Justiz und Inneres, Finanzen, Umwelt und Landwirtschaft zu beraten.
3. Austritt, Ausschluss und Suspendierung aus der Europäischen Union
3.1 Austritt aus der Europäischen Union
Wie schon in der Einleitung erläutert, können Unionsstaaten den geschlossenen Unionsvertrag9»auf unbegrenzte Zeit«, indem sie den Willen zur langfristigen Mitgliedschaft begründet haben, nicht einseitig wieder aufheben. Letztlich kann die Zugehörigkeit nur durch einen »gegenläufigen Akt«, verfasst im Vertrag von Maastricht10, aufgehoben oder eine Vertragsveränderung herbeigeführt werden. Dies jedoch nur nach einstimmiger Entscheidung aller Unionsstaaten. Dies hat zur Folge, dass ein oder mehrere Staaten aus der Union entlassen werden.
Ausnahme: Im Falle manifester Unzumutbarkeiten eines weiteren Verbleibs des Mitgliedstaates in der Union, kann das einseitige Beendigungsrecht nach der Wiener Vertragsrechtskonvention geltend gemacht werden, obwohl die Gründungsverträge der drei Europäischen Gemeinschaften, sowie der Unionsvertrag völkerrechtlicher Natur sind. Hauptstandpunkt des Artikels 62 WVK ist dabei, die grund legende Veränderung der beim Vertragsschluss gegebenen Umstände und somit der „Wegfall der Geschäftsgrundlage“.
3.2 Ausschluss aus der Europäischen Union
Die Gemeinschaftsverträge enthalten Schutz- und Notstandsklauseln11für den Fall, dass vitale Interessen eines Mitgliedstaats berührt sind oder ihm die Erfüllung der vertraglichen Pflichten aus wirtschaftlichen Gründen unmöglich wird. Es besteht die Möglichkeit zur begrenzten Kündigung der Teilnahme des Mitgliedsstaats an der Währungsunion, sofern dieser nicht in der Lage ist, die geforderten Konvergenzkriterien12zu erfüllen. Da dies sonst eine Schwächung der Stabilitätsgemeinschaft zur Folge hätte und somit eine Vertragsverletzung darstellt.
Den Mitgliedsstaaten steht Rechtsschutz13vor dem EuGH zur Verfügung, sofern Vertragsverletzungen durch andere Mitgliedsstaaten herbei geführt werden. In diesem Fall befasst sich zunächst die Kommission mit der Vertragsverletzung. Falls diese innerhalb von drei Monaten keine Stellungnahme dazu abgegeben hat, ist der Mitgliedsstaat berechtigt vor dem Gerichtshof zu klagen.
Die Urteile des EuGH können jedoch nur eine Zwangsgeldverhängung gegen den Verletzerstaat durchsetzen. Bis zum Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages konnte bei beharrlichem vertragswidrigen Verhalten des Mitgliedsstaats ein Ausschluss nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts gemäß Art. 60 Abs. 2 WVK angewendet werden. Jedoch kann diese Vertragsverletzung fortan nur durch eine Suspendierung des Mitgliedstaats von Mitgliedschaftsrechten geahndet werden.
3.3 Suspendierung von Mitgliedschaftsrechten
Eine Suspendierung kann erwägt werden, sofern schwerwiegende und anhaltende Verletzungen der in Artikel 6 Abs. 1 genannten Grundsätze durch einen Mitgliedsstaat vorliegen. Der Staat muss vor der ersten einstimmigen Beschlussfassung die Regierung zu einer Stellungnahme über die Verletzungsfeststellung auffordern und anhören. Sodann kann der Rat nach Artikel 714mit qualifizierter Mehrheit, die Aussetzung der Rechte und Pflichten natürlicher und juris tischer Personen einschließlich des Stimmrechts des betroffenen Mitgliedstaat beschließen. Bei Beschlüssen nach Abs. 2 und 3 des Artikels 7 bzw. 309 handelt der Rat ohne Berücksichtigung der Stimmen15des Vertreters der Regierung des betroffenen Mitgliedstaats.
4. Fazit
Abschließend zu diesem Thema möchte ich auf die zukünftige Mittel- und Osterweiterung der Europäischen Union zu sprechen kommen.
Aus der AGENDA 2000 ist zu schlussfolgern, dass die Erweiterung erhebliche politische und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen wird. Dabei wird auf wirtschaftlicher Ebene von einem Wirtschaftswachstum der beitretenden Länder von 4% jährlich gesprochen. Dennoch wird aufgrund des jetzigen Standes ein hoher Anteil der Fördermittel für die neuen Beitrittsländer aufgewendet werden müssen, langfristig sollen diese Unterstützungen dazu dienen die ökonomischen Kriterien im vollen Umfang zu erfüllen.
Kurzfristig sind die Vorteile der Erweiterung noch nicht zu erkennen, jedoch denke ich das der Wirtschafts- und Lebensraum „Europa“ sich langfristig auf die entstehende Globalisierung im richtigem Maße vorbereitet. Die Entwicklung und Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sollte in allen Europäischen Staaten den sozialen Fortschritt garantieren.
Auf wirtschaftlicher Seite sollte anhand der festgelegten Kriterien eine angemessene Bewertung der eintretenden Länder vorgenommen werden können und somit die Stabilität der Gemeinschaft gewährleistet sein. Sofern sich die einzelnen Kommissionen ihrer Verantwortung dem „Unionsbürger“ gegenüber klar sind.
Anlage 1
Die Grundlagen der Beitrittsvoraussetzungen verfasst in
31 Kapiteln
1 Freier Warenverkehr
2 Freier Personenverkehr
3 Freier Dienstleistungsverkehr
4 Freier Kapitalverkehr
5 Gesellschaftsverkehr
6 Wettbewerbspolitik
7 Landwirtschaft
8 Fischerei
9 Verkehr
10 Steuern
11 WWU
12 Statistik
13 Sozial- und Beschäftigungspolitik
14 Energie
15 Industriepolitik
16 Kleine & mittlere Unternehmen
17 Wissenschaft und Forschung
18 Bildung und Ausbildung
19 Telekommunikation
20 Kultur / Audiovisuelles
21 Regionalpolitik
22 Umwelt
23 Verbraucher- und Gesundheitsschutz
24 Justiz / Inneres
25 Zollunion
26 Außenbeziehungen
27 GASP
28 Finanzkontrolle
29 Haushalt
30 Institutionen
31 Sonstiges
Literaturverzeichnis
Europarecht - 3. Auflage Autoren: König / Haratsch Verlag Mohr Siebeck
Europa-Recht - 16. Auflage Beck-Texte im dtv
Informationen aus dem Internet
www.auswaertiges-amt.de
www.europa.eu.int
[...]
1Sog. Europa-Abkommen
2[Beitritt zur Union] ersetzt die Beitrittsklauseln der drei Gemeinschaftsverträge (Art. 237 EWGV, Art. 205 EAGV, Art. 98 EGKSV)
3[Grundlagen der Union, nationale Identität, Menschenrechte, Mittelausstattung]
4»acquis communautaire«
5Auflistung siehe Anlage 1
6„Common positions“
7mittel- und osteuropäische Länder
8sog. Twinning-Projekte
9(Art. 51 EUV)
10(BVerfGE 89, 155, 190)
11(z. B. Art. 59 EGV, Art. 95 Abs. 10 EGV, Art. 134 Abs. 1 Satz 2 EGV)
12(Art. 104 EGV [Vermeidung übermäßiger Defizite; Haushaltsdisziplin]
13(Art. 227 EGV [Anrufung durch einen Mitgliedsstaat])
14[Verletzung fundamentaler Grundsätze durch einen Mitgliedstaat]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der thematische Schwerpunkt dieses Textes?
Der Text behandelt hauptsächlich den Beitritt zur Europäischen Union, geht aber auch auf Austritt, Ausschluss und Suspendierung aus der EU ein.
Welche Verträge werden im Zusammenhang mit der EU-Gründung erwähnt?
Genannt werden die Verträge über die "Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl" (EGKS, 1952), die "Europäische Wirtschaftsgemeinschaft" (EWG, 1957) und die "Europäische Atomgemeinschaft" (EAG, 1957).
Welche Erweiterungsrunden der EU werden im Text explizit erwähnt?
Erwähnt werden die Beitritte von Dänemark, Irland und dem Vereinigten Königreich (1973), Griechenland (1981), Spanien und Portugal (1986), sowie Österreich, Finnland und Schweden (1995).
Was sind die "Kopenhagener Kriterien"?
Die "Kopenhagener Kriterien" sind die grundlegenden Voraussetzungen für einen EU-Beitritt, die vom Europäischen Rat in Kopenhagen am 21./22. Juni 1993 zusammengefasst wurden. Sie umfassen ein geographisches, politische, wirtschaftliche und sonstige Kriterien.
Welche politischen Kriterien sind für einen EU-Beitritt relevant?
Die politischen Kriterien umfassen eine rechtsstaatliche Ordnung, eine demokratische Ordnung, den Schutz der Grund- und Menschenrechte sowie den Schutz der Minderheiten.
Welche wirtschaftlichen Kriterien sind für einen EU-Beitritt relevant?
Die wirtschaftlichen Kriterien umfassen eine funktionsfähige Marktwirtschaft und die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten.
Was sind Vorbeitrittshilfen und welche Programme umfasst dies?
Vorbeitrittshilfen sind finanzielle Unterstützungen der EU für Beitrittsländer, um den Übergang zu einer demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung sowie zu einer funktionierenden Marktwirtschaft zu erleichtern. Die Programme umfassen PHARE, ISPA und SAPARD.
Was ist das Ziel von Verwaltungspartnerschaften (Twinning-Projekte) im Rahmen der Vorbeitrittshilfen?
Ziel dieser Initiative ist es, die Beitrittsländer durch Experten der Bereiche Justiz und Inneres, Finanzen, Umwelt und Landwirtschaft zu beraten und so den Verwaltungsaufbau zu unterstützen.
Kann ein Mitgliedstaat aus der Europäischen Union austreten?
Der Text argumentiert, dass Unionsstaaten den Unionsvertrag nicht einseitig aufheben können, da er "auf unbegrenzte Zeit" geschlossen wurde. Es wird aber auf die Möglichkeit verwiesen, das einseitige Beendigungsrecht nach der Wiener Vertragsrechtskonvention geltend zu machen im Fall manifester Unzumutbarkeiten.
Unter welchen Umständen kann ein Mitgliedstaat von Mitgliedschaftsrechten suspendiert werden?
Eine Suspendierung kann erwogen werden, sofern schwerwiegende und anhaltende Verletzungen der in Artikel 6 Abs. 1 genannten Grundsätze durch einen Mitgliedsstaat vorliegen.
Was sind die 31 Kapitel der Beitrittsvoraussetzungen?
Die 31 Kapitel umfassen u.a. Freier Warenverkehr, Freier Personenverkehr, Freier Dienstleistungsverkehr, Freier Kapitalverkehr, Gesellschaftsverkehr, Wettbewerbspolitik, Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr, Steuern, WWU, Statistik, Sozial- und Beschäftigungspolitik, Energie, Industriepolitik, Kleine & mittlere Unternehmen, Wissenschaft und Forschung, Bildung und Ausbildung, Telekommunikation, Kultur / Audiovisuelles, Regionalpolitik, Umwelt, Verbraucher- und Gesundheitsschutz, Justiz / Inneres, Zollunion, Außenbeziehungen, GASP, Finanzkontrolle, Haushalt, Institutionen, Sonstiges.
- Quote paper
- Andreas Luedecke (Author), 2000, Beitritt zur und Austritt aus der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102976