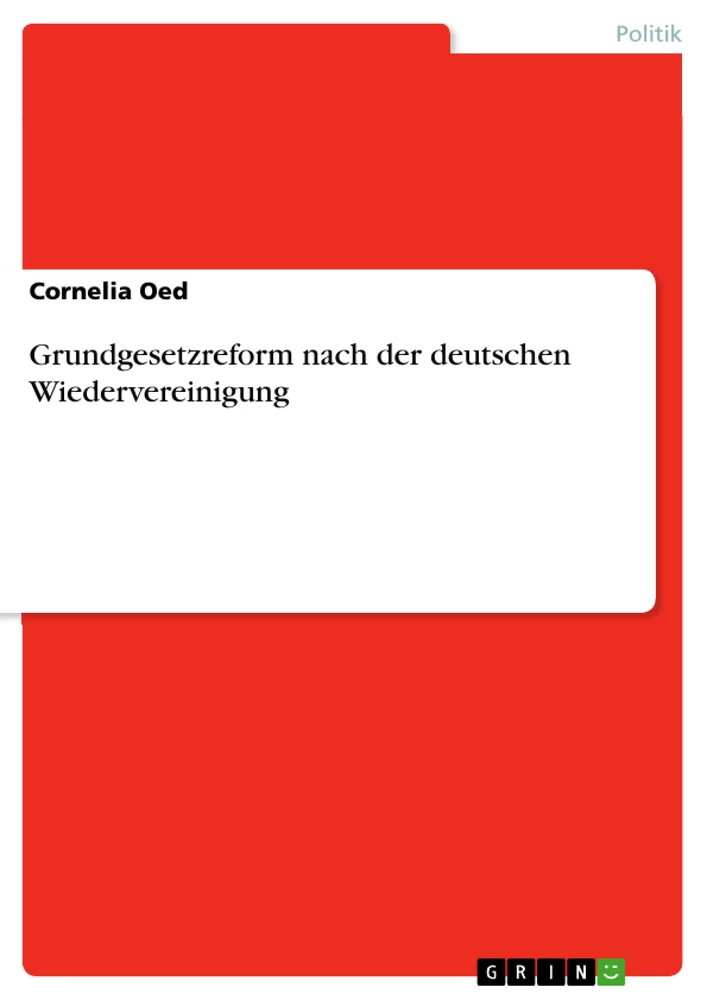Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grundgesetzreform nach der Wiedervereinigung
1. Bedeutung einer Verfassung
- Definition: Verfassung wird als die Summe der Regeln, Normen und Prinzipien verstanden, die die Einrichtung, Organisation und Ausübung der Staatsgewalt bestimmen und die Grundsätze des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft sowie der Stellung des Einzelnen im Staat anleiten (vgl. Batt 1996: 9)
- Funktionen einer Verfassung:
1. Staatsorganisation
2. Integration der Bürger in ihren Staat
3. Dokumentation rechtlicher Maßstäbe des Zusammenlebens der Bürger in einem Staat fi Mittel: Zusammenführung von Wertvorstellungen in der Gesellschaft und inhaltliche Basis politischen und gesellschaftlichen Ha ndelns
2. Politische Situation zur Zeit der Wiedervereinigung und Positionen der einzelnen Parteien in Bezug auf die Verfassung
- Koalitionsregierung von CDU/CSU und FDP mit knapper absoluter Mehrheit
- Einigkeit über Wiedervereinigung, verschiedene Konzepte der Durchführung:
- Regierung: Schneller Beitritt der neuen Bundesländer zur BRD
- Opposition: Langsames Zusammenwachsen der beiden Teilstaaten
- Grundgesetz hält grundsätzlich beide Möglichkeiten offen
- Art. 23: Beitritt der neuen Bundesländer zum Geltungsgebiet des GG
- Art. 146: Wiedervereinigung mit einer neuen, durch Volksabstimmung legitimierten Verfassung
- Regierung für schnellen Beitritt nach Art. 23;Opposition für Beitritt nach Art. 146
- Regierung ist angewiesen auf Opposition, da man für alle Verfassungsänderungen 2/3 Mehrheit in Bundesrat und Bundestag braucht
- Kompromiss: Beitritt nach Art. 23, aber Beibehaltung des Art. 146 als Option auf Verfassungsneugebung nach Überprüfungsfrist
- Annahme des Einigungsvertrages mit 80% im Osten und 90% im Westen
3. Regelungen des Einigungsvertrages zum Thema Verfassung
- Vom 6. September 1990
- Grundgesetz ab 3. Oktober 1990 als gesamtdeutsche Verfassung
- Regelt verfassungsrechtliche und einfachgesetzliche Folgen des Beitritts
- Unterteilt in beitrittsbedingte Verfassungsänderungen (Art. 4) und künftige Ver fassungsänderungen (Art. 5)
- Artikel 5 empfiehlt den gesetzgebenden Organen, sich innerhalb von zwei
Jahren mit Folgendem zu beschäftigen:
1. Fragen des Verhältnisses von Bund und Ländern
2. einer Länderneugliederung im Raum Berlin / Brandenburg
3. der Aufnahme von Staatszielen in das GG
4. der Anwendung des Art. 146 GG mit einer möglichen Volksabstimmung über das GG
- Lässt Streit offen und findet einen verfahrentechnischen Kompromiss in zwei Stufen
- nicht allgemein konsensfähige und nicht unmittelbar mit der deutschen
Einheit verbundene Verfassungsänderungen aus dem Vertrag ausgeklammert (verschoben)
- zwei Jahres Frist für die Gesetzgeber
4. Auswirkungen des Föderalismus
- 5 Arten der Gesetzgebung in Deutschland, die im GG festgelegt sind
- Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes
- Ausschließliche Gesetzgebung der Länder
- Drei Mischformen
- Bereich der ausschließlichen Ländergesetzgebung relativ beschränkt und Bedingungen für Bundesgesetze weit ausgelegt
fi Länderparlamente fast ohne gesetzgeberische Funktion
fi Ziel: Kompetenzsteigerung bei Verfassungsänderungen zur Wiedervereinigung
- Einstimmiger Beschluss der Ministerpräsidenten: „Eckpunkte für die Gestaltung der bundesstaatlichen Ordnung im vereinten Deutschland“ vom 5. Juli 1990; Forderungen:
- Neugestaltung der Finanzbeziehung zwischen Bund und Ländern
- Neugestaltung der Stimmverteilung im Bundesrat
- Mehr Mitwirkung der Länder in zwischenstaatlichen Einrichtungen
- Stärkung der Gesetzgebungskompetenz
- Eigene Kommission „Verfassungsreform“ des Bundesrates schon vor Beginn der Beratungen der Gemeinsamen Verfassungskommission 1992 mit noch weitergehenderen Forderungen
- bis1994 Erfüllung der meisten Forderungen aus den Eckpunkten
5. Europäischen Integration
- konkrete Änderungen des GG im Zusammenhang mit dem Maastrichter Vertrag von 1991
- Ziele der EU:
1. Wirtschafts- und Währungsunion
2. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
3. Unionsbürgerschaft mit aktivem und passivem Wahlrecht auf kommunaler Ebene
4. Zusammenarbeit der EU-Staaten bei der Justiz- und Inne npolitik Folgen für die Verfassung:
1. Verzicht auf die nationale Währungshoheit; Ersetzung der bislang für die Währungspolitik verantwortlichen nationalen Institutionen (Bundesbank) fi Änderung von Artikel 88 GG
2. regelmäßige Zusammenarbeit in außen- und sicherheitspolitischen Fragen
3. kommunales Ausländerwahlrecht war mit dem GG nicht zu vereinbaren fi Änderung von Artikel 28 GG
4. Asylpolitik gemeinsame Angelegenheit von den EU-Mitgliedstaaten fi Änderung von Artikel 16 II Satz 2 GG
6. Die betroffenen Verfassungsartikel
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Literaturverzeichnis:
1. Batt, Helge-Lothar: Grundgesetzreform nach der deutschen Einheit. Akteure, politischer Prozess und Ereignisse. Opladen 1996. Seite 7 - 43
2. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands - Einigungsvertrag. Bonn 1990
3. Bayrische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. München 1995
4. Schönefelder, Heinrich: Deutsche Gesetze. Textsammlung. München 1983
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck des Grundgesetzes laut diesem Dokument?
Laut diesem Dokument wird das Grundgesetz als die Summe der Regeln, Normen und Prinzipien verstanden, die die Einrichtung, Organisation und Ausübung der Staatsgewalt bestimmen und die Grundsätze des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft sowie der Stellung des Einzelnen im Staat anleiten. Es dient der Staatsorganisation, der Integration der Bürger in ihren Staat und der Dokumentation rechtlicher Maßstäbe des Zusammenlebens.
Wie gestaltete sich die politische Situation zur Zeit der Wiedervereinigung in Bezug auf die Verfassung?
Die Koalitionsregierung von CDU/CSU und FDP hatte eine knappe absolute Mehrheit. Es gab Einigkeit über die Wiedervereinigung, aber unterschiedliche Konzepte zur Durchführung. Die Regierung befürwortete einen schnellen Beitritt der neuen Bundesländer zur BRD (Art. 23 GG), während die Opposition ein langsames Zusammenwachsen der Teilstaaten (Art. 146 GG) bevorzugte. Ein Kompromiss wurde erzielt, der den Beitritt nach Art. 23 vorsah, aber Art. 146 als Option für eine Verfassungsneugebung beibehielt.
Welche Regelungen des Einigungsvertrages betrafen die Verfassung?
Der Einigungsvertrag vom 6. September 1990 erklärte das Grundgesetz ab dem 3. Oktober 1990 zur gesamtdeutschen Verfassung. Er regelte verfassungsrechtliche und einfachgesetzliche Folgen des Beitritts, unterteilte sich in beitrittsbedingte und künftige Verfassungsänderungen und empfahl den gesetzgebenden Organen, sich mit Fragen des Verhältnisses von Bund und Ländern, einer Länderneugliederung, der Aufnahme von Staatszielen und der Anwendung des Art. 146 GG zu beschäftigen.
Welche Auswirkungen hatte der Föderalismus auf die Grundgesetzreform nach der Wiedervereinigung?
Die Länderparlamente hatten aufgrund des Föderalismus wenig gesetzgeberische Funktion. Ziel war eine Kompetenzsteigerung bei Verfassungsänderungen. Die Ministerpräsidenten forderten eine Neugestaltung der Finanzbeziehungen, der Stimmverteilung im Bundesrat, mehr Mitwirkung der Länder in zwischenstaatlichen Einrichtungen und eine Stärkung der Gesetzgebungskompetenz. Bis 1994 wurden die meisten Forderungen erfüllt.
Wie beeinflusste die europäische Integration das Grundgesetz?
Konkrete Änderungen des Grundgesetzes standen im Zusammenhang mit dem Maastrichter Vertrag von 1991. Ziele der EU wie Wirtschafts- und Währungsunion, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Unionsbürgerschaft und Zusammenarbeit in Justiz und Innenpolitik führten zu Änderungen in Bezug auf Währungshoheit (Artikel 88 GG), kommunales Ausländerwahlrecht (Artikel 28 GG) und Asylpolitik (Artikel 16 II Satz 2 GG).
Welche Verfassungsartikel waren von den Reformen betroffen?
Die Texte beziehen sich auf Artikel 16, Artikel 23, Artikel 28, Artikel 88 und Artikel 146 des Grundgesetzes.
- Quote paper
- Cornelia Oed (Author), 2001, Grundgesetzreform nach der deutschen Wiedervereinigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102980