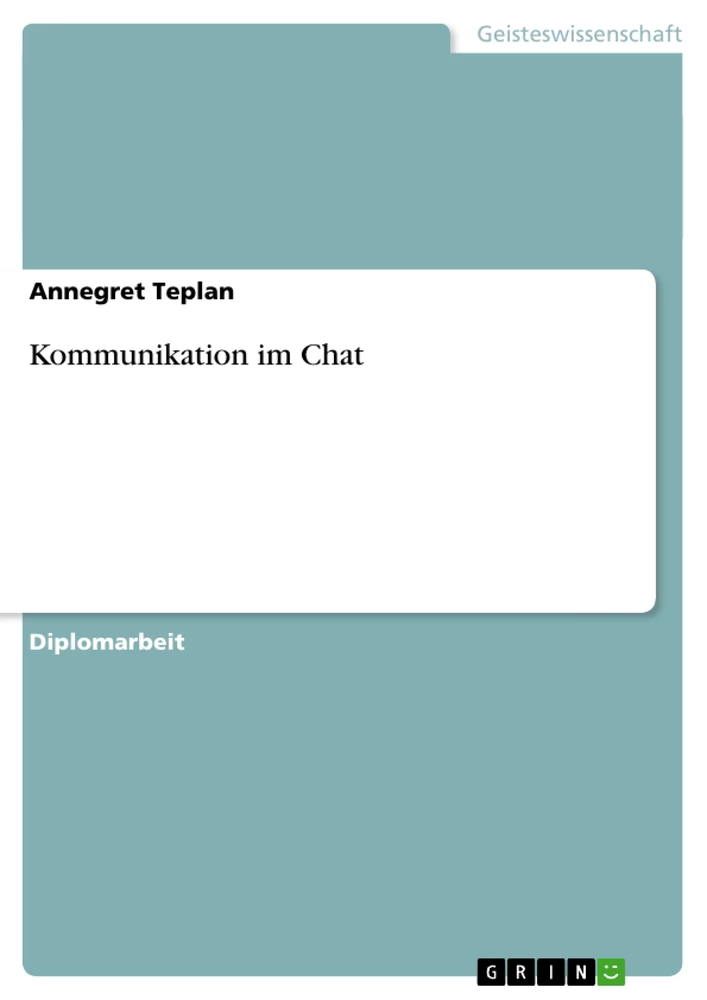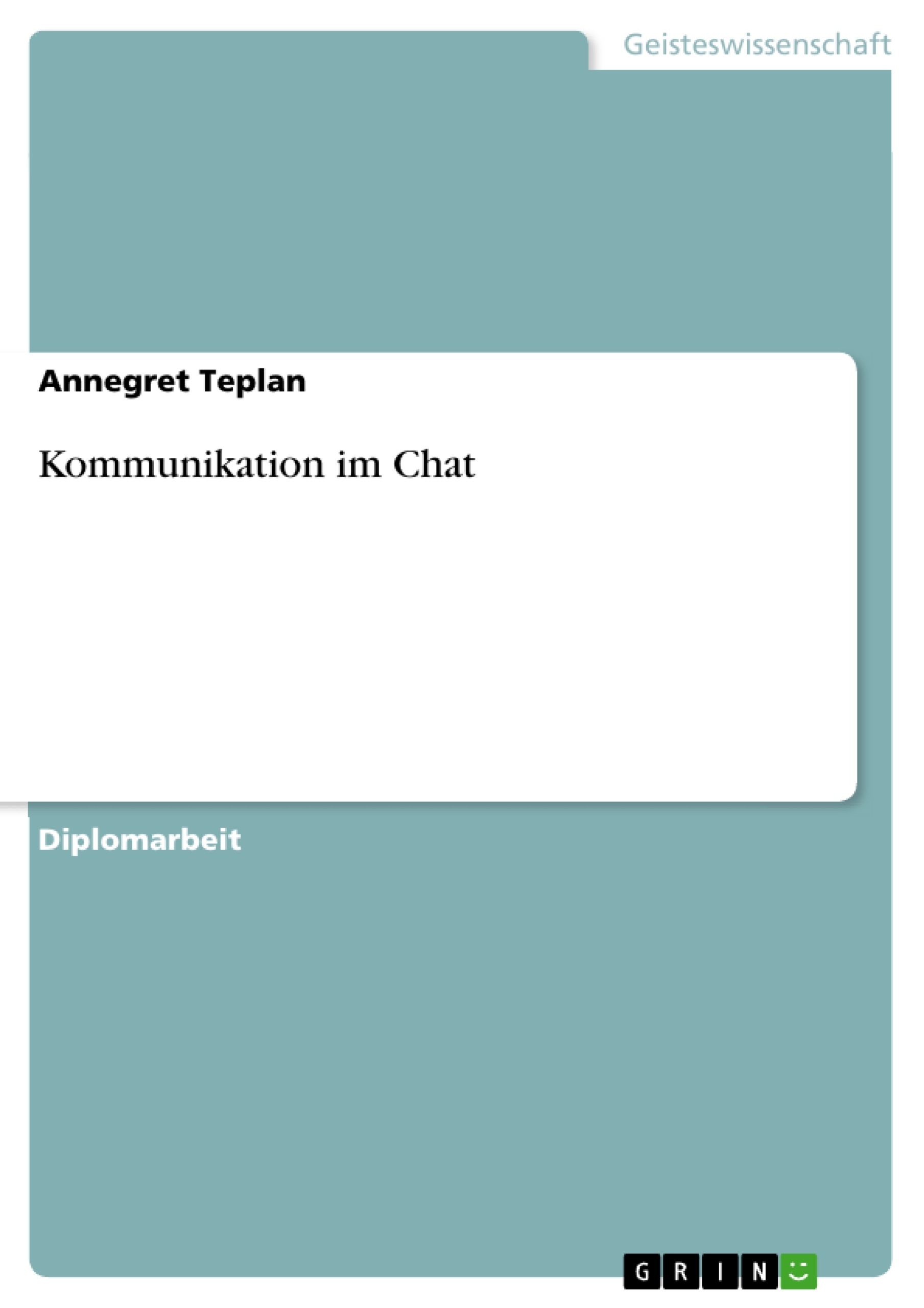Das Internet wird nach aktuellen Schätzungen derzeit von ungefähr 20 bis 40 Millionen Menschen weltweit in verschiedener Form genutzt. Dabei beträgt die Zuwachsrate der Netzteilnehmer etwa 10 Prozent monatlich.
Durch diese explosionsartige Entwicklung kommt dem Internet in der Gesellschaft eine wachsende Bedeutung zu. Es ist anzunehmen, dass der Chat als eine der beliebtesten Kommunikationsformen, die das Internet zur Verfügung stellt, dadurch ebenfalls verstärkt Einfluss nehmen wird auf verschiedene Bereiche des menschlichen Lebens. Aus diesem Grund bin ich davon überzeugt, dass die Sozialwissenschaften, insbesondere die Sozialpädagogik, in Zukunft zunehmend mit dem Thema der Chat-Kommunikation konfrontiert werden und sich mit diesem auseinandersetzen müssen.
Die neue, mediale Kommunikationsform „Chatten“ befindet sich jedoch noch mehr oder minder in der Einführungsphase, weshalb die öffentliche Diskussion zu diesem Thema vor allem durch ambivalente Stereotype geprägt ist. Dementsprechend ist auch die fortschrittgläubige Phantasie von der Allmacht der Technik ebenso verbreitet, wie die Befürchtung durch die computervermittelte Kommunikation würden die Menschen vereinsamen und sich voneinander isolieren. Meiner Meinung nach kann auf die spezifischen Vor- und Nachteile der Chat-Kommunikation allerdings nur adäquat eingegangen werden, wenn eine möglichst realistische Vorstellung der Charakteristika des neuen Kommunikationsmediums existiert. Aus diesem Grund möchte ich in meiner Diplomarbeit versuchen, einen möglichst umfassenden Überblick zum Thema der Chat-Kommunikation zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Der Chat als Teil der Internetdienste
- 1.0 Begriffsdefinition Internet
- 2.0 Datenautobahn und Cyberspace – Zwei Internetmetaphern im Vergleich
- 2.1 Datenautobahn
- 2.2 Cyberspace
- 2.3 Resümee
- 3.0 Internetdienste
- 3.1 World Wide Web (WWW, Web)
- 3.2 Gopher
- 3.3 Electronic Mail (Email, Mail)
- 3.4 Mailinglisten
- 3.5 Newsgroups
- 3.6 File Transfer Protocol (FTP)
- 3.7 Telnet
- 3.8 Chat
- 3.9 ICQ
- 4.0 Arten und Formen des Chats
- 4.1 Unterscheidung nach technischer Funktionsweise
- 4.1.1 Internet Relay Chat (IRC)
- 4.1.2 Web-Chat
- 4.1.3 Visual Virtual World Chat (3D-Chat)
- 4.1.4 Resümee
- 4.2 Unterscheidung nach medialer Ausgestaltung
- 4.2.1 Textbasierte Chats
- 4.2.2 Voice-Chats
- 4.2.3 Video-Chats
- 4.2.4 Resümee
- 4.3 Unterscheidung nach Teilnahmemöglichkeit
- 4.3.1 Offene Chats
- 4.3.2 Geschlossene Chats
- 4.3.3 Moderierte Chats
- 4.3.4 Unmoderierte Chats
- 4.4 Unterscheidung nach inhaltlicher Zielsetzung des Anbieters
- 4.4.1 Kommerzielle Chats
- 4.4.1.1 Kostenpflichtige Chats
- 4.4.1.2 Chats als Mittel der Kundenbindung
- 4.4.2 Nichtkommerzielle Chats
- 4.4.2.1 Therapie-Chats, Online-Beratungen
- 4.4.2.2 Selbsthilfe-Chats
- 4.4.2.3 Themenbasierte Chats
- 4.4.1 Kommerzielle Chats
- 5.0 Technischer Ablauf des Web-Chats
- 4.1 Unterscheidung nach technischer Funktionsweise
- II. Chat-Kommunikation
- 1.0 Grundzüge der Kommunikation im Chat
- 2.0 Standardisierungsformen
- 2.1 Emoticons
- 2.2 ASCII-Bildobjekte
- 2.3 Akronyme
- 2.4 Disclaimer
- 2.5 Soundwörter
- 2.6 Aktionswörter
- 3.0 Theorien und Modelle zur Chat-Kommunikation
- 3.1 Kanalreduktionsmodell
- 3.2 Filtermodelle
- 3.3 Rationale Medienwahl
- 3.4 Normative Medienwahl
- 3.5 Interpersonale Medienwahl
- 3.6 Soziale Informationsverarbeitung
- 3.7 Simulationsmodell
- 3.8 Imaginationsmodell
- 3.9 Digitalisierungsmodell
- 3.10 Kulturraummodell
- 3.11 Medienökologisches Rahmenmodell
- 3.11.1 Medienwahl
- 3.11.2 Mediale Umgebung
- 3.11.3 Mediales Kommunikationsverhalten
- 3.11.4 Kurzfristige soziale Effekte
- 3.11.5 Langfristige soziale Folgen
- III. Sozialpädagogischer Ausblick
- 1.0 Die Konstruktion von Identität im Chat
- 1.1 Eindrucksbildung
- 1.2 Geschlechtsidentität und Gender-Switch
- 1.3 Veränderung bestehender Identitäten
- 2.0 Soziale Beziehungen und Gemeinschaften
- 2.1 Soziale Beziehungen
- 2.2 Beziehungsentwicklung
- 2.3 Gemeinschaften
- 1.0 Die Konstruktion von Identität im Chat
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Kommunikation im Chat und untersucht deren spezifischen Besonderheiten. Sie analysiert die verschiedenen Formen des Chats, die technischen und medialen Aspekte sowie die theoretischen und modellhaften Ansätze zur Erklärung der Chat-Kommunikation.
- Technologische Entwicklung und Funktionsweise des Chats
- Kommunikationsformen und -strategien im Chat
- Theoretische Modelle und Ansätze zur Analyse der Chat-Kommunikation
- Sozialpädagogische Implikationen der Chat-Kommunikation
- Identitätskonstruktion und soziale Beziehungen im Chat
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I beleuchtet den Chat als Teil der Internetdienste und zeichnet die Entwicklung des Internets und seiner verschiedenen Dienste nach. Es werden verschiedene Chat-Formen und -Arten im Hinblick auf ihre technische Funktionsweise, mediale Ausgestaltung, Teilnahmemöglichkeit und inhaltliche Zielsetzung des Anbieters kategorisiert. Das Kapitel schließt mit einer Beschreibung des technischen Ablaufs des Web-Chats.
Kapitel II widmet sich der Chat-Kommunikation und untersucht die spezifischen Kommunikationsformen und Standardisierungsformen, die in diesem Kontext Anwendung finden. Es werden verschiedene Theorien und Modelle zur Erklärung der Chat-Kommunikation vorgestellt, darunter Kanalreduktionsmodell, Filtermodelle, Rationale Medienwahl, Normative Medienwahl, Interpersonale Medienwahl, Soziale Informationsverarbeitung, Simulationsmodell, Imaginationsmodell, Digitalisierungsmodell, Kulturraummodell und das Medienökologisches Rahmenmodell.
Kapitel III beleuchtet die sozialpädagogischen Implikationen der Chat-Kommunikation, insbesondere die Konstruktion von Identität und die Entwicklung sozialer Beziehungen in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Chat, Internetkommunikation, Online-Kommunikation, Kommunikationsformen, Standardisierungsformen, Theorien, Modelle, Sozialpädagogik, Identität, soziale Beziehungen, Gemeinschaften.
Häufig gestellte Fragen
Welche Arten von Chats gibt es?
Man unterscheidet nach Technik (IRC, Web-Chat, 3D-Chat), Medien (Text, Voice, Video) und Zugang (offen, geschlossen, moderiert).
Was sind Emoticons und Akronyme im Chat?
Es sind Standardisierungsformen zur Kompensation fehlender nonverbaler Signale, wie Smileys für Gefühle oder Kürzel wie "LOL" für Lachen.
Wie wird Identität im Chat konstruiert?
Identität entsteht durch textliche Selbstdarstellung, wobei Phänomene wie "Gender-Switch" (Wechsel des Geschlechts) möglich sind.
Was besagt das Kanalreduktionsmodell?
Diese Theorie besagt, dass durch den Wegfall von Mimik und Gestik im textbasierten Chat die Kommunikation sachlicher oder gefilterter abläuft.
Welche Bedeutung hat der Chat für die Sozialpädagogik?
Sozialpädagogen nutzen Chats für Online-Beratungen, Therapie-Angebote und zur Unterstützung von Selbsthilfegruppen.
- Quote paper
- Diplom-Sozialpädagogin (FH) Annegret Teplan (Author), 2002, Kommunikation im Chat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10300