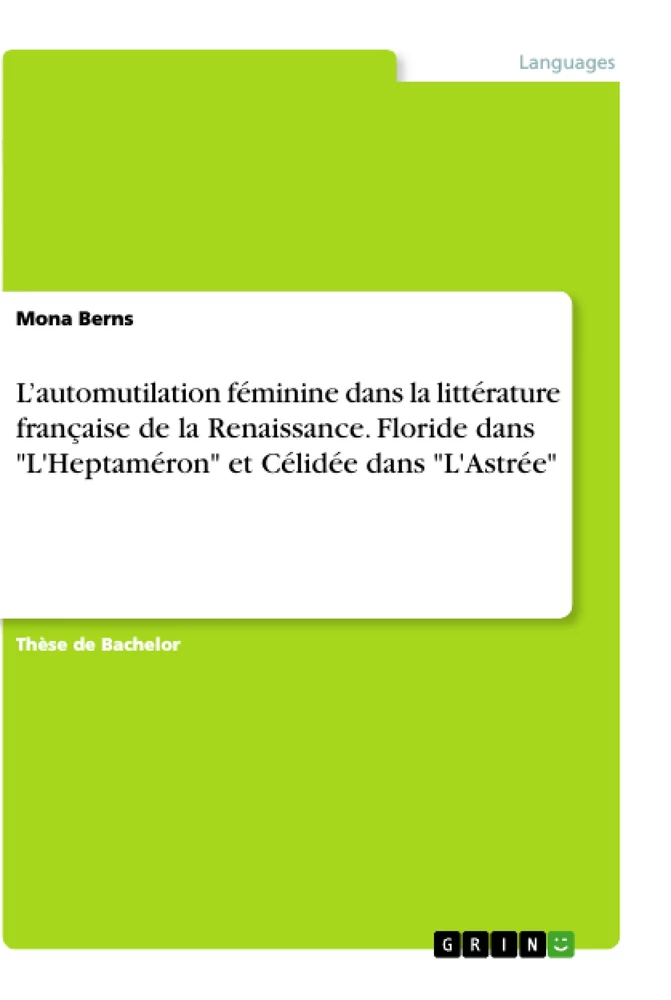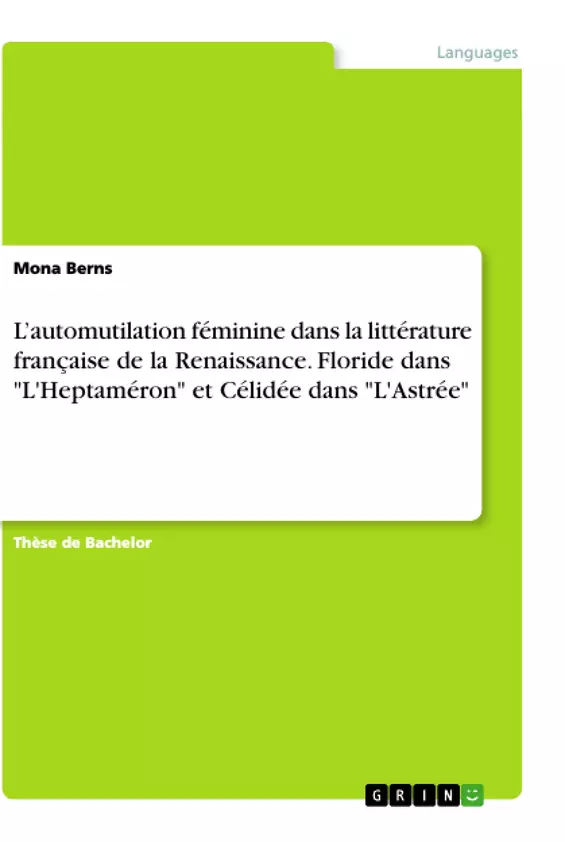Ce travail analyse dans quelle mesure l'automutilation de Floride dans l'Heptaméron (1558) et celle de Célidée dans l'Astrée (1630) peuvent être considérés comme des rébellions contre les désirs possessifs masculins. Dans la plupart des récits littéraires de la Renaissance, la femme prend un rôle d’un objet de désir passif, car dans un contexte d’hétéronormativité et d’hégémonie masculine, elle est victime, faible, privée de parole et d’action. Les seules issues à la possession masculine semblent donc le suicide ou une destruction de l’apparente source du problème du désir masculin : la beauté féminine. Pourtant, la destruction de beauté reste toujours dans un contexte de contrariétés sociales.
Notre première question de recherche sera : si la vertu est attribuée à une belle femme de nature, la destruction de beauté égale-t-elle donc à une destruction de cette vertu attachée à la beauté qu'elle est censée préserver avec cet acte ? Deuxièmement, est- ce que le geste d’automutilation pourrait être compris comme geste qui virilise la femme dans la mesure où elle s’active pour ne plus être uniquement un objet de désir, voire qu’elle refuse activement et fermement d’être considérée comme un objet ? Notre troisième intérêt de recherche sera d’expliquer que d’un côté, l'automutilation féminine dans la littérature est une réaction à une agression masculine. De l’autre côté, nous allons discuter si - même s'il s'agit d'auto-agressions et autodestruction et ne pas de révolte contre l’autrui ou d'autre sorte, - on peut considérer cet acte d’auto-agence courageuse qui montre une capacité d’action.
Premièrement, nous abordons la Xe nouvelle dans l'Heptaméron de Marguerite de Navarre qui raconte l'histoire de Floride, fille d’une duchesse. Ensuite, nous analyserons le conte intertextuel sur la bergère Célidée dans L'Astrée de Honoré d'Urfé, publié environ un siècle plus tard. Il suit une digression pour donner un petit aperçu historique du motif initialement inspiré par l'article La femme qui se mutile le visage (1959) de Raymond Lebègue, un des seuls et premiers chercheurs qui se met à la recherche des sources possibles de la nouvelle X de l’Heptaméron. Troisièmement, nous tirerons des conclusions complètes sur l'automutilation et, ce faisant, trouver des réponses à nos questions de recherche.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- Die Zehnte Nouvelle
- Überblick über das Motiv: Neuinterpretationen der Zehnten Nouvelle
- Die Darstellung: die Rollenverteilung
- Die List
- Das Scheitern der List: Vernunft vs. Leidenschaft
- Die Reaktion des Mädchens
- Die Selbstverstümmelung in der Zehnten Nouvelle
- L'Astrée
- Die Schönheit: Kontextualisierung der Schönheit
- Die Schönheit in L'Astrée
- Die Frau als Objekt, der Mann als Listender
- Vernunft vs. Leidenschaft
- Die Reaktion des Mädchens
- Die Selbstverstümmelung von Célidée
- Exkurs: Werke, die die Entstehung des Heptaméron und der Astrée beeinflusst haben
- Historischer Einfluss
- Literarischer Einfluss
- Hagiographischer und folkloristischer Einfluss
- Werke, die die Astrée außer der Zehnten Nouvelle beeinflusst haben
- Die Selbstverstümmelung
- Für eine Virilisierung der Frau?
- Der Körper als perfektes Werkzeug und Ort der Kommunikation
- Kritik an der Selbstverstümmelung
- Diskussion: Selbstwirksamkeit
- Die Auswirkungen der Selbstverstümmelung
- Die Automatisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die weibliche Selbstverstümmelung in der französischen Renaissance-Literatur, insbesondere in Marguerite de Navarres "Heptaméron" und Honoré d'Urfés "Astrée". Ziel ist es, die Motive und die Bedeutung dieser Handlungsweise im Kontext der damaligen patriarchalischen Gesellschaft zu analysieren und zu verstehen, wie die Schönheit der Frau sowohl mit Tugend als auch mit unerwünschter männlicher Begierde in Verbindung gebracht wird. Die Arbeit befasst sich mit der Frage nach der Selbstwirksamkeit der Frauen in dieser Situation und analysiert die Selbstverstümmelung als möglichen Akt der Rebellion oder als Ausdruck von Ohnmacht.
- Weibliche Selbstverstümmelung als Reaktion auf männliche Dominanz
- Der ambivalenten Rolle der Schönheit in der französischen Renaissance-Literatur
- Die Verbindung zwischen Körper, Tugend und gesellschaftlichen Normen
- Selbstverstümmelung als Akt der Selbstbehauptung oder des Untergangs
- Der Vergleich von unterschiedlichen sozialen Kontexten und deren Einfluss auf die Handlung der Protagonistinnen
Zusammenfassung der Kapitel
Introduction: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Motiven weiblicher Selbstverstümmelung in der französischen Renaissance-Literatur vor, insbesondere im Kontext des "Heptaméron" und der "Astrée". Sie begründet die Auswahl dieser Texte und skizziert die methodische Vorgehensweise, die auf einer vergleichenden Analyse und der Einbeziehung anthropologischer Körpert heorien beruht. Die zentrale Forschungsfrage kreist um die Ambivalenz der Selbstverstümmelung als Akt der Selbstbehauptung oder als Ausdruck von Ohnmacht innerhalb patriarchaler Machtstrukturen.
Die Zehnte Nouvelle: Dieses Kapitel analysiert die Zehnte Nouvelle aus Marguerite de Navarres Heptaméron, welche die Geschichte von Floride erzählt, einer jungen Frau aus dem Adel, die sich selbst verstümmelt, um die unerwünschten Avancen eines Mannes abzuwehren. Die Analyse fokussiert auf die Darstellung der Rollenverteilung, die strategischen Überlegungen Florides, das Scheitern ihrer Handlung und die daraus resultierenden Konsequenzen. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Vernunft und Leidenschaft im Konflikt sowie auf der Frage, ob Florides Handlung als Selbstwirksamkeit oder als Ausdruck von Ohnmacht interpretiert werden kann.
L'Astrée: Das Kapitel widmet sich der Analyse der Geschichte von Célidée in Honoré d'Urfés "Astrée". Célidée, eine Schäferin, verstümmelt sich ebenfalls aus Angst vor unerwünschter männlicher Aufmerksamkeit. Der Vergleich mit Florides Geschichte ermöglicht eine tiefgreifende Untersuchung der unterschiedlichen sozialen Kontexte und ihrer Auswirkungen auf die Handlungsweise der Frauen. Die Analyse betrachtet die Darstellung der Schönheit, die Beziehung zwischen Vernunft und Leidenschaft sowie die Frage nach der letztendlichen Wirksamkeit der Selbstverstümmelung im Hinblick auf die Erlangung von Autonomie.
Exkurs: Werke, die die Entstehung des Heptaméron und der Astrée beeinflusst haben: Dieser Exkurs beleuchtet die historischen, literarischen und hagiographischen Einflüsse, die die Entstehung des Heptaméron und der Astrée geprägt haben und somit das Verständnis der dargestellten Selbstverstümmelungen kontextualisieren. Es werden Parallelen und Unterschiede zu anderen Werken aufgezeigt, die das Motiv der Selbstverstümmelung thematisieren.
Werke, die die Astrée außer der Zehnten Nouvelle beeinflusst haben: Dieses Kapitel untersucht weitere Einflüsse auf die "Astrée", die nicht direkt mit der Zehnten Nouvelle zusammenhängen, aber dennoch zum Verständnis des Werkes und seiner Thematik beitragen. Der Fokus liegt dabei auf den literarischen und kulturellen Kontexten, welche die Darstellung der Selbstverstümmelung in der "Astrée" mitprägten.
Die Selbstverstümmelung: Dieses Kapitel beleuchtet die Thematik der Selbstverstümmelung an sich. Die Frage nach einer möglichen "Virilisierung" der Frau durch diesen Akt wird kritisch diskutiert. Der Körper wird als Ort der Kommunikation und des Ausdrucks von Macht und Ohnmacht gleichermaßen analysiert. Die gesellschaftliche Kritik an der Selbstverstümmelung wird ebenfalls beleuchtet.
Diskussion: Selbstwirksamkeit: Dieses Kapitel diskutiert die Frage nach der Selbstwirksamkeit der Protagonistinnen. Es wird analysiert, inwieweit die Selbstverstümmelung als Akt der Selbstbestimmung oder als Ausdruck von Ohnmacht und gesellschaftlicher Gefangenschaft interpretiert werden kann. Es wird untersucht, ob die Handlungen der Protagonistinnen als Rebellion gegen die patriarchalische Gesellschaft gewertet werden können.
Die Auswirkungen der Selbstverstümmelung: Dieses Kapitel untersucht die Folgen der Selbstverstümmelung für die Protagonistinnen. Es wird analysiert, ob die Selbstverstümmelung das gewünschte Ergebnis – nämlich die Abwendung männlicher Avancen – erreicht. Die Bedeutung der sichtbaren und unsichtbaren Auswirkungen des Aktes auf die Frauen werden genauer beleuchtet.
Die Automatisierung: Das Kapitel widmet sich dem Aspekt der Automatisierung als Teil des Prozesses der Selbstverstümmelung und den darin liegenden Implikationen für die psychologischen und gesellschaftlichen Aspekte der Handlung.
Schlüsselwörter
Selbstverstümmelung, weibliche Selbstverstümmelung, Renaissance-Literatur, Frankreich, Heptaméron, Astrée, Marguerite de Navarre, Honoré d'Urfé, Patriarchat, Schönheit, Tugend, Körper, Machtverhältnisse, Selbstwirksamkeit, Autonomie, Geschlechterrollen, Vergleichende Literaturanalyse, Anthropologie des Körpers.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse weiblicher Selbstverstümmelung in der französischen Renaissance-Literatur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die weibliche Selbstverstümmelung in der französischen Renaissance-Literatur, insbesondere in Marguerite de Navarres "Heptaméron" und Honoré d'Urfés "Astrée". Der Fokus liegt auf den Motiven, der Bedeutung dieser Handlungsweise im Kontext der patriarchalischen Gesellschaft und der Frage nach der Selbstwirksamkeit der Frauen.
Welche Texte werden untersucht?
Die Haupttexte sind Marguerite de Navarres "Heptaméron" (insbesondere die Zehnte Nouvelle) und Honoré d'Urfés "Astrée". Die Analyse bezieht außerdem weitere Werke ein, die die Entstehung und Thematik dieser beiden Romane beeinflusst haben.
Welche zentralen Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Selbstverstümmelung als mögliche Reaktion auf männliche Dominanz, die ambivalente Rolle der Schönheit, die Verbindung zwischen Körper, Tugend und gesellschaftlichen Normen, und die Selbstverstümmelung als Akt der Selbstbehauptung oder des Untergangs. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Vergleich unterschiedlicher sozialer Kontexte und deren Einfluss auf das Handeln der Protagonistinnen. Schließlich wird die Frage nach der Selbstwirksamkeit der Frauen im Kontext ihrer Handlung untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: eine Einleitung, Kapitel zur Analyse der Zehnten Nouvelle und der "Astrée", Exkurse zu den Einflüssen auf die Entstehung beider Werke, ein Kapitel zur Thematik der Selbstverstümmelung allgemein, ein Kapitel zur Diskussion der Selbstwirksamkeit der Protagonistinnen, ein Kapitel zu den Auswirkungen der Selbstverstümmelung und ein abschließendes Kapitel zur Automatisierung im Prozess der Selbstverstümmelung.
Welche Aspekte der Zehnten Nouvelle werden analysiert?
Die Analyse der Zehnten Nouvelle konzentriert sich auf die Darstellung der Rollenverteilung, die strategischen Überlegungen Florides, das Scheitern ihrer Handlung, die Konsequenzen und den Konflikt zwischen Vernunft und Leidenschaft. Die Interpretation der Handlung als Selbstwirksamkeit oder Ausdruck von Ohnmacht spielt eine zentrale Rolle.
Welche Aspekte von L'Astrée werden analysiert?
Die Analyse von L'Astrée fokussiert auf die Geschichte von Célidée und ihren Vergleich mit Florides Geschichte. Es werden die Darstellung der Schönheit, die Beziehung zwischen Vernunft und Leidenschaft und die Frage nach der Wirksamkeit der Selbstverstümmelung im Hinblick auf Autonomie untersucht.
Welche Einflüsse auf die Entstehung des Heptaméron und der Astrée werden berücksichtigt?
Die Arbeit beleuchtet historische, literarische und hagiographische Einflüsse, die die Entstehung des "Heptaméron" und der "Astrée" geprägt haben und somit das Verständnis der dargestellten Selbstverstümmelungen kontextualisieren. Parallelen und Unterschiede zu anderen Werken mit dem Motiv der Selbstverstümmelung werden aufgezeigt.
Wie wird die Thematik der Selbstverstümmelung allgemein behandelt?
Das Kapitel zur Selbstverstümmelung diskutiert kritisch die Frage nach einer möglichen "Virilisierung" der Frau durch diesen Akt. Der Körper wird als Ort der Kommunikation und des Ausdrucks von Macht und Ohnmacht analysiert, und die gesellschaftliche Kritik an der Selbstverstümmelung wird beleuchtet.
Wie wird die Selbstwirksamkeit der Protagonistinnen diskutiert?
Die Diskussion der Selbstwirksamkeit analysiert, inwieweit die Selbstverstümmelung als Akt der Selbstbestimmung oder als Ausdruck von Ohnmacht und gesellschaftlicher Gefangenschaft interpretiert werden kann. Die Frage, ob die Handlungen der Protagonistinnen als Rebellion gegen die patriarchalische Gesellschaft gewertet werden können, wird untersucht.
Welche Auswirkungen der Selbstverstümmelung werden betrachtet?
Die Analyse der Auswirkungen betrachtet, ob die Selbstverstümmelung das gewünschte Ergebnis (Abwendung männlicher Avancen) erreicht hat und beleuchtet die sichtbaren und unsichtbaren Folgen des Aktes für die Frauen.
Was ist unter "Automatisierung" im Kontext der Selbstverstümmelung zu verstehen?
Das Kapitel zur Automatisierung untersucht diesen Aspekt als Teil des Prozesses der Selbstverstümmelung und dessen Implikationen für die psychologischen und gesellschaftlichen Aspekte der Handlung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstverstümmelung, weibliche Selbstverstümmelung, Renaissance-Literatur, Frankreich, Heptaméron, Astrée, Marguerite de Navarre, Honoré d'Urfé, Patriarchat, Schönheit, Tugend, Körper, Machtverhältnisse, Selbstwirksamkeit, Autonomie, Geschlechterrollen, Vergleichende Literaturanalyse, Anthropologie des Körpers.
- Arbeit zitieren
- Mona Berns (Autor:in), 2020, L’automutilation féminine dans la littérature française de la Renaissance. Floride dans "L'Heptaméron" et Célidée dans "L'Astrée", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030079