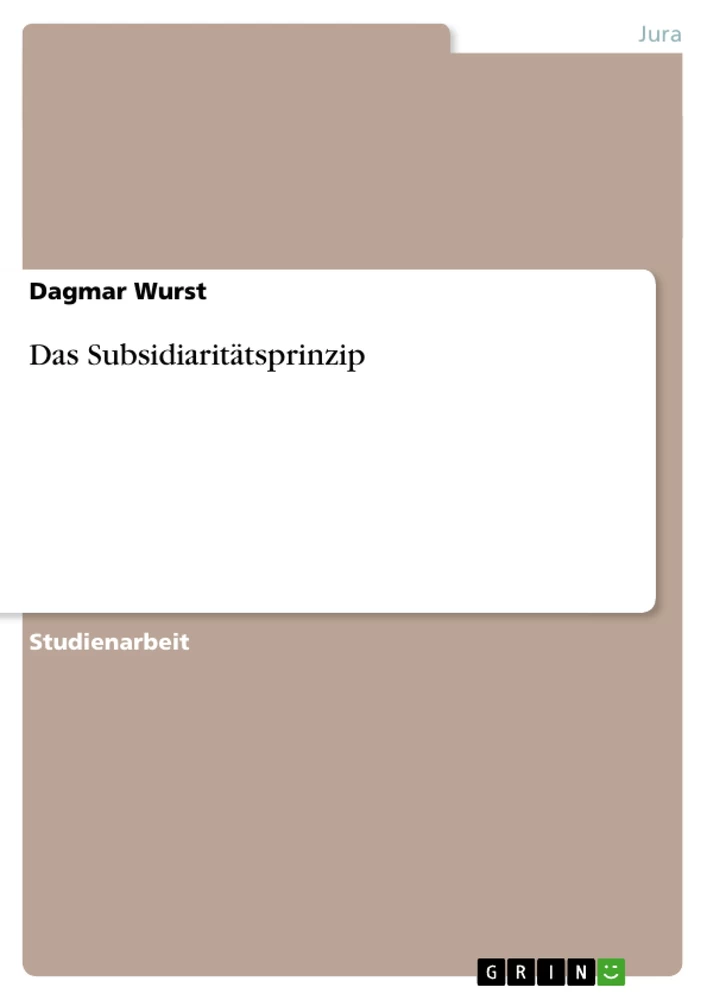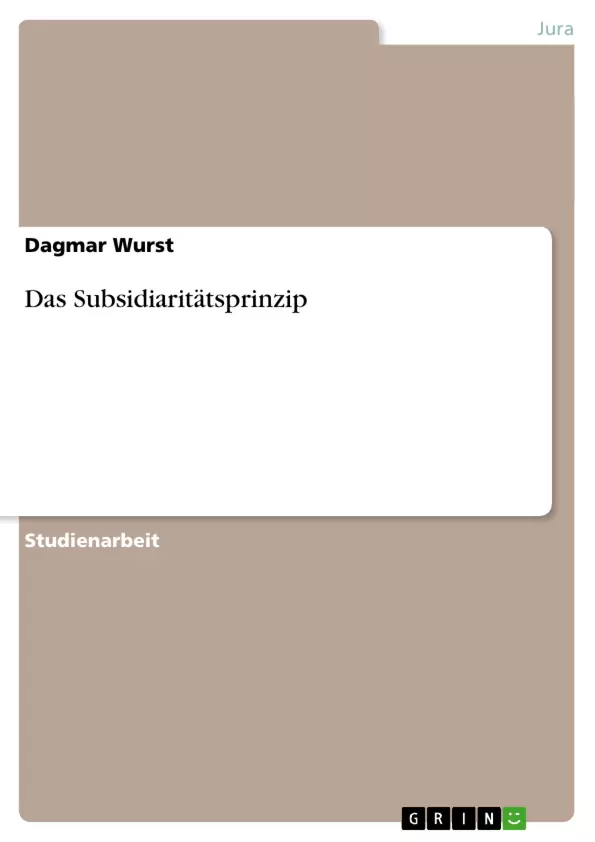Der Amsterdamer Vertrag enthält eine „Subsidiaritätsklausel“, die besagt, dass die Gemeinschaft ihre Aktivitäten auf diejenigen Maßnahmen beschränkt, die nicht auf der Ebene der Mitgliedstaaten erreicht werden können. Insofern steht die Gemeinschaft vor einer der europäischen Integration bisher fremden und daher völlig neuen Situation, die sich nach Jahren des Ringens um Kompetenzen nunmehr mit deren Begrenzung auseinander zusetzen hat. Die neue Qualität der europäischen Integration nach dem EUV macht ein Umdenken erforderlich, denn nur so kann ihrem Ziel, der Schaffung eines europäischen Bundesstaates eigener Art, Erfolg beschieden sein und die Ausbalancierung von zentralen und dezentralen Entscheidungsebenen im komplizierten Kompetenzengefüge der Gemeinschaft bewirkt werden. Allerdings entwickelte das Subsidiaritätsprinzip im Spiegel der Verhandlungen zum Vertrag über die EU ein verwirrendes Eigenleben und wurde dabei oftmals als Instrument rein nationaler Interessenpolitik missverstanden. Vor diesem Hintergrund, soll gezeigt werden, dass der Inhalt des Prinzips, wie es insbes. in Art. 5 II EGV und Art. 2 II EUV seinen Ausdruck gefunden hat, im Kontext der europäischen Integration der Präzisierung bedarf.
Inhalt
A. Einleitung
B. Entstehung des Subsidiaritätsprinzips
I. Zum Begriff der Subsidiarität
II. Die Herkunft des Subsidiaritätsprinzips
C. Seine Einführung in den Vertrag - Rolle in der EG bis zum Vertrag von Amsterdam
I. Diskussion im Vorfeld der Verhandlungen des Vertrages über die Europäische Union
II. Weiterentwicklung und konkrete Ausformungen im EGV
D. Materieller Gehalt des SP
I. Auslegung des Tatbestands
- die Ebene der Mitgliedstaaten ist nicht ausreichend,
- und die Ziele können besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden
II. Inhaltliche Mängel
III. Die Rolle des Subsidiaritätsprinzips in der EG
E. Gerichtliche Überprüfbarkeit
I. Zweifel an der Justiziabilität
II. Ansicht des BVerfG
F. Aufgabenwahrnehmung durch die Organe
I. Kommission
II. Rat
III. Europäische Parlament
IV. Europäische Gerichtshof
G. Bisherige Praxis und Tätigkeit der Mitgliedstaaten
H. Aussicht
I. Fazit
Prinzip der Subsidiarität und Praxis der Aufgabenwahrnehmung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten
A. Einleitung
Der Amsterdamer Vertrag enthält eine „Subsidiaritätsklausel“, die besagt, dass die Gemeinschaft ihre Aktivitäten auf diejenigen Maßnahmen beschränkt, die nicht auf der Ebene der Mitgliedstaaten erreicht werden können. Insofern steht die Gemeinschaft vor einer der europäischen Integration bisher fremden und daher völlig neuen Situation, die sich nach Jahren des Ringens um Kompetenzen nunmehr mit deren Begrenzung auseinander zusetzen hat. Die neue Qualität der europäischen Integration nach dem EUV macht ein Umdenken erforderlich, denn nur so kann ihrem Ziel, der Schaffung eines europäischen Bundesstaates eigener Art, Erfolg beschieden sein und die Ausbalancierung von zentralen und dezentralen Entscheidungsebenen im komplizierten Kompetenzengefüge der Gemeinschaft bewirkt werden. Allerdings entwickelte das Subsidiaritätsprinzip im Spiegel der Verhandlungen zum Vertrag über die EU ein verwirrendes Eigenleben und wurde dabei oftmals als Instrument rein nationaler Interessenpolitik missverstanden. Vor diesem Hintergrund, soll gezeigt werden, dass der Inhalt des Prinzips, wie es insbes. in Art. 5 II EGV und Art. 2 II EUV seinen Ausdruck gefunden hat, im Kontext der europäischen Integration der Präzisierung bedarf.
B. Entstehung des Subsidiaritätsprinzips
I. Zum Begriff der Subsidiarität
In seiner ursprünglichen Bedeutung leitet sich der Begriff „Subsidiarität“ vom lateinischen Wort „subsidium“ ab, das dem militärischen Bereich entstammt und die zurückbleibende Hilfe bezeichnet, die erst eingreift, wenn die in der vordersten Schlachtreihe stehenden Kräfte nicht ausreichen. In der staatstheoretischen Diskussion wurde der Grundsatz als Organisations- und Handlungsprinzip im Rahmen der politischen Ordnung mit der Frage nach der Rechtsbegründung und Rechtsträgerschaft verknüpft.[1] Insofern macht die Geschichte des Subsidiaritätsgedankens seit Aristoteles deutlich, dass es darum geht, in einem politischen Gemeinwesen, welches sich naturgemäß aus anderen Gemeinschaften zusammensetzt, jenen kleineren Gemeinschaften den Vorrang im Handeln, sog. Zuständigkeitsprärogative, gegenüber der größeren Einheit nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit zukommen zu lassen.[2] Somit wirkt der Gedanke insofern zum einen passiv, als Abwehrrecht, das die kleinere Einheit, gegen unangemessene Eingriffe der größeren Einheit schützt; aber auch glz. staatsentlastend, indem er ihn davor bewahrt, mit Aufgaben belastet zu werden, denen er letztlich unter Effektivitätsgesichtpunkten nicht gewachsen ist. Andererseits lässt sich der Subsidiaritätsgedanke aber auch aktiv, als Recht auf Beistand und Hilfeleistung interpretieren. Schließlich ergibt sich noch ein dritter Aspekt aus dem Subsidiaritätsgrundsatz: Orientiert am Recht des Individuums auf Selbstbestimmung folgt, dass der Staat nicht beliebig in dessen Sphäre eingreifen darf, es ist also als Art Garantie individualer Grundrechte zu verstehen.
II. Die Herkunft des Subsidiaritätsprinzips
Zunächst hat das Subsidiaritätsprinzip in der päpstlichen Sozialenzyklika von Pius XI. „Quadragesimo Anno“ vom 15.Mai 1931,[3] die von der katholischen Kirche unter dem Eindruck der heranwachsenden totalitären Staaten mit dem Ziel erlassen wurde, die selbstverantwortliche Person und die gesellschaftlichen Zwischenverbände vor dem Staat in Schutz zu nehmen, eine relativ konkrete Ausprägung erfahren.[4] Auch das deutsche Grundgesetz enthält auf dem Subsidiaritätsprinzip basierende Regelungen in Art. 72 II GG, wonach der Bund im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung das Gesetzgebungsrecht hat, „ soweit eine Angelegenheit durch die Gesetzgebung einzelner Länder nicht wirksam geregelt werden kann“. Obwohl jedoch geschichtlich verwurzelt, war der Föderalismus in Europa immer eine Ausnahme, denn die meisten Mitgliedstaaten verfügen über ein parlamentarisches System, in dem sich alle politische Aktivität auf das nationale Parlament konzentriert.
C. Seine Einführung in den Vertrag - Rolle in der EG bis zum Vertrag von Amsterdam
I. Diskussion im Vorfeld der Verhandlungen des Vertrages über die Europäische Union
Der Gedanke des Subsidiaritätsprinzips hatte bereits 1986 im Rahmen der EEA ausdrücklich Eingang in das EG-Recht gefunden, und zwar im Hinblick auf die Umweltpolitik, die damals neu eingeführt wurde, Art. 130r EWGV.[5] Die Verankerung des Prinzips, in der im Vertrag enthaltenen Formulierung, ist von der Bundesregierung, für die die vielzitierte „Landesblindheit“[6] der EG-Verträge von Anfang an ein Problem war,[7] mit der Unterstützung von Großbritannien,[8] gegen die mehr oder minder große Zurückhaltung der anderen Mitgliedstaaten durchgesetzt worden. Denn diese befürchteten, dass es in Verbindung mit der Verankerung des Föderalismus und der Errichtung des Regionalausschusses, einzelne Regionen zur Verstärkung eigenständiger Tendenzen berstärken könnte.[9] Mit dem Zustimmungsgesetz zur EEA haben die Bundesländer, allen voran Bayern,[10] zunächst versucht, diesen fortschreitenden Kompetenzverlust durch Institutionalisierung von Mitwirkungs- und Partizipationsrechten im Bundesrat zu kompensieren,[11] während sie glz. systematisch eigene EG-Aktivitäten aufbauten, indem sie etwa ihre Präsenz in Brüssel durch Länderbüros verstärkten. Dieses Stimmungsbild, das ablehnende Votum der Dänen im ersten Referendum und der knappe Ausgang der Volksabstimmung in Frankreich, veranlassten den Europäischen Rat, bei seinem Treffen in Edinburgh am 11. und 12. Dezember 1992 zu einer klärenden Stellungnahme[12]: Es wurden die Grundprinzipien festgelegt, nach denen die Organe der Gemeinschaft bei der Anwendung des Prinzips der Subsidiarität zu verfahren haben.
II. Weiterentwicklung und konkrete Ausformungen im EGV
Nach mehreren Beratungen des Europäischen Rats (z.B. Edinburgh, Dez. 1992; Brüssel, Dez. 1993), fand das Subsidiaritätsprinzip letztlich, als für den gesamten Vertrag verbindliche Definition, eingefügt durch den am 1.11.1993 in Kraft getretenen Vertrag über die EU von Maastricht, in Art 5 (3b) EGV Eingang in den EG-Vertrag. Gerade der Abs. II stellte eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas dar, in der die Entscheidungen möglichst bürgernah[13] getroffen wurden.[14] Der Vertrag von Amsterdam vom 2.10.1997 fügte dem EGV ein „Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität“[15] an, welches den Rang von primären Gemeinschaftsrecht i.S.v. Art 311 EGV hat und sich zum Ziel nahm, die politischen zu nunmehr verbindlichen Rechtsvorschriften weiterzuentwickeln.[16] Spezielle Ausprägung hat sein Gedanke überdies in mehreren Kompetenznormen des EGV (Art 44 II lit g; 94, 95 iVm. 3 I h, 137, 149-154, 157, 164, 308 EGV) gefunden sowie in den Bestimmungen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres.[17]
D. Materieller Gehalt des SP
I. Auslegung des Tatbestands
Da die Forderung nach Subsidiarität vor allem aus dem politischen Bereich stammt, ist ihr Motiv oft unterschiedlich und sind schon seine sachliche Aussage, sein ideologischer Hintergrund und seine rechtliche Gestaltung umstritten.[18] Die Ausübung der Gemeinschaftskompetenz wird von Bedingungen abhängig gemacht, die wie folgt umschrieben werden:
- die Ebene der Mitgliedstaaten ist nicht ausreichend,
- und die Ziele können besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden
Ob ein Tätigwerden auf EG-Ebene notwendig ist, darf nur außerhalb der ausschließlichen Zuständigkeit der Gemeinschaft, also nur bei einem Rückgriff auf ihre konkurrierende Zuständigkeitsbefugnis gestellt werden.[19] Drei Begriffe sind bes. hervorzuheben, da sie am unbestimmtesten sind.: „nicht ausreichend“, „besser“ sowie „und daher“. Wie das Wort „daher“ zeigt, liegt der Schwerpunkt des Prinzips in der ersten Voraussetzung; damit soll die Bestimmung eine „Grenze“ ziehen;[20] nicht ohne weiteres erkennbar ist jedoch, wo diese verlaufen soll. Nach Ansicht der Kommission soll ein Test der vergleichenden Effizienz darüber vorgenommen werden, ob die aktuelle Sach- und Rechtslage in den Mitgliedstaaten neben einer Einschätzung ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten zur Erreichung künftiger Maßnahmen zur Verfügung steht.[21] Die Gemeinschaft soll bereits dann tätig werden dürfen, wenn ihre Ziele durch sie besser erreicht werden können als durch einzelne Mitgliedstaaten. Hinzugekommen ist die Formulierung, nach der die Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend sein darf, was von einem EG-Organ nachvollziehbar dargelegt werden muss. Denn aus dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung steht den Mitgliedstaaten grds. ein Handlungsvorrang gegenüber der EG zu. Für ein erforderliches Handeln der Gemeinschaft - wie es von den dt. Bundesländern gefordert wird – trägt daher die Gemeinschaft die Beweislast.[22] Zur Konkretisierung hat das Protokoll folgende Leitlinien aufgestellt: - der betreffende Bereich muss transnationale Aspekte aufweisen, die durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht ausreichend geregelt werden können, - alleinige Maßnahme oder das Fehlen von EG-Maßnahmen würde gegen die Anforderungen des Vertrages verstoßen, und - Maßnahmen auf EG-Ebene würden wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen im Vergleich zu Maßnahmen der Mitgliedstaaten deutliche Vorteile mit sich bringen.[23]
II. Inhaltliche Mängel
Kritisiert wird, dass ungeklärt bleibt, was passieren soll, wenn ein Staat, obwohl er eine Maßnahme effektiv durchführen könnte, untätig bleibt.[24] Das Subsidiaritätsprinzip kann nur dann eine volle Wirkung entfalten, wenn durch Verfahrensvorschriften sichergestellt ist, dass bei Erlass eines Rechtsaktes die Einhaltung des Prinzips von allen Organen geprüft und die Notwendigkeit des Handelns ausdrücklich begründet wird.
Es ist in Art. 5 II EGV auf Zuständigkeiten beschränkt, die der Gemeinschaft nicht ausschließlich zustehen. Bereits diese eindeutig klingende Regelung,erweist sich jedoch bei näherer Betrachtung als bedenklich, weil schon der Begriff der „nicht ausschließlichen Zuständigkeit“ im Gemeinschaftsrecht nicht eindeutig ist, nur durch eine Funktionsbeschreibung erfolgt und deshalb zu Kontroversen führt.[25] So werden z.B. bei der Gemeinsamen Handelspolitik nach neuerer Rechtssprechung den Mitgliedstaaten gewisse parallele Kompetenzen überlassen.
[...]
[1] Kimminich, S. 10
[2] Isensee, S. 71
[3] Pieper, S. 33
[4] Weidenfeld, S. 136
[5] „Die Gemeinschaft wird im Bereich der Umwelt insoweit tätig, als die in Abs 1 genannten Ziele besser auf
Gemeinschaftsebene erreicht werden können als auf Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten.“
[6] Ipsen, S. 256
[7] denn die Verträge nahmen auf die föderative Struktur des Grundgesetz rechtlich keinerlei Rücksicht
[8] Pipkorn, S. 698
[9] Weidenfeld, S.180
[10] Kennzeichnend, verband der ehem. Bayerische Ministerpräsident Alfons Goppel, die Idee der europäischen Eini
gung mit der Idee eines Europa der Regionen, vgl. Kneymeyer, S. 17
[11] Hailbronner, JZ 1990, S. 149 ff.
[12] vgl. Europäischer Rat v. Edinburgh, Schlussfolgerungen des Vorsitzes, COM. SI (92) 1050 vom 13.12.1992, Teil A
Anl. 1, III, S. 10 ff.
[13] Dies als Ersatz für den gestrichenen Hinweis auf die föderale Struktur der Union., vgl. Pipkorn, EuZW 1992, 697
[14] Geiger, EUV/ EGV, Art. 5 Rn.5
[15] Abgedruckt in EuGRZ 1993, 602 ff.
[16] Geiger, EUV/EGV, Art. 5, Rn.5
[17] vgl. Calliess/ Ruffert, Art 5, Rn. 53
[18] Kimminich, S. 30 ff.
[19] Blanke, in Hrbek, S. 97
[20] Geiger, s.o. Art. 5 Rn. 8
[21] Calliess/ Ruffert, Art. 5 Rn. 40
[22] Hirsch, S. 10
[23] vgl. Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rats von Edinburgh, Teil A, Anl. 1, S. 7a, 138 ff.
[24] Steindorff, ZHR 1999, 405
[25] Ronge, S. 169
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das Subsidiaritätsprinzip in der EU?
Es besagt, dass die Europäische Gemeinschaft nur dann tätig wird, wenn die Ziele einer Maßnahme auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können.
In welchen Verträgen ist das Subsidiaritätsprinzip verankert?
Wichtige Verankerungen finden sich in Art. 5 II EGV (nach Maastricht) und Art. 2 II EUV sowie im speziellen Protokoll des Amsterdamer Vertrages.
Woher stammt der Begriff „Subsidiarität“ ursprünglich?
Der Begriff leitet sich vom lateinischen „subsidium“ ab und hat Wurzeln in der päpstlichen Sozialenzyklika „Quadragesimo Anno“ von 1931.
Ist das Subsidiaritätsprinzip gerichtlich überprüfbar?
Die Arbeit diskutiert die Justiziabilität des Prinzips, einschließlich der Zweifel daran und der Ansichten des Bundesverfassungsgerichts.
Welche Kriterien müssen für ein Tätigwerden der Gemeinschaft erfüllt sein?
Die Maßnahmen der Mitgliedstaaten müssen unzureichend sein und die Ziele müssen aufgrund ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen „besser“ auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können.
- Citation du texte
- Dagmar Wurst (Auteur), 2001, Das Subsidiaritätsprinzip, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10302