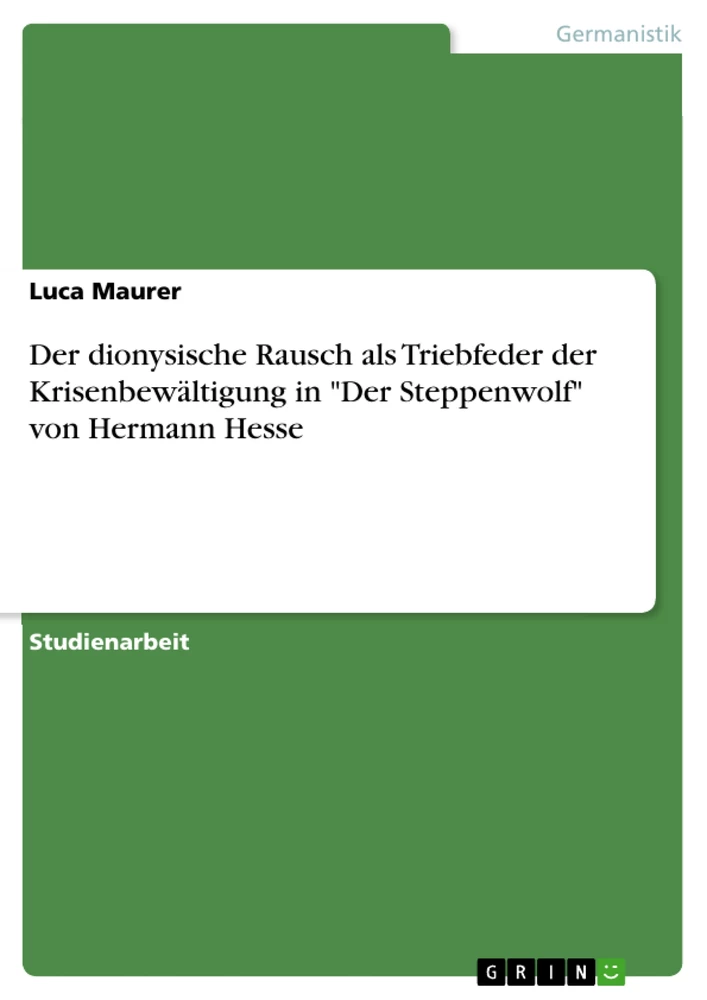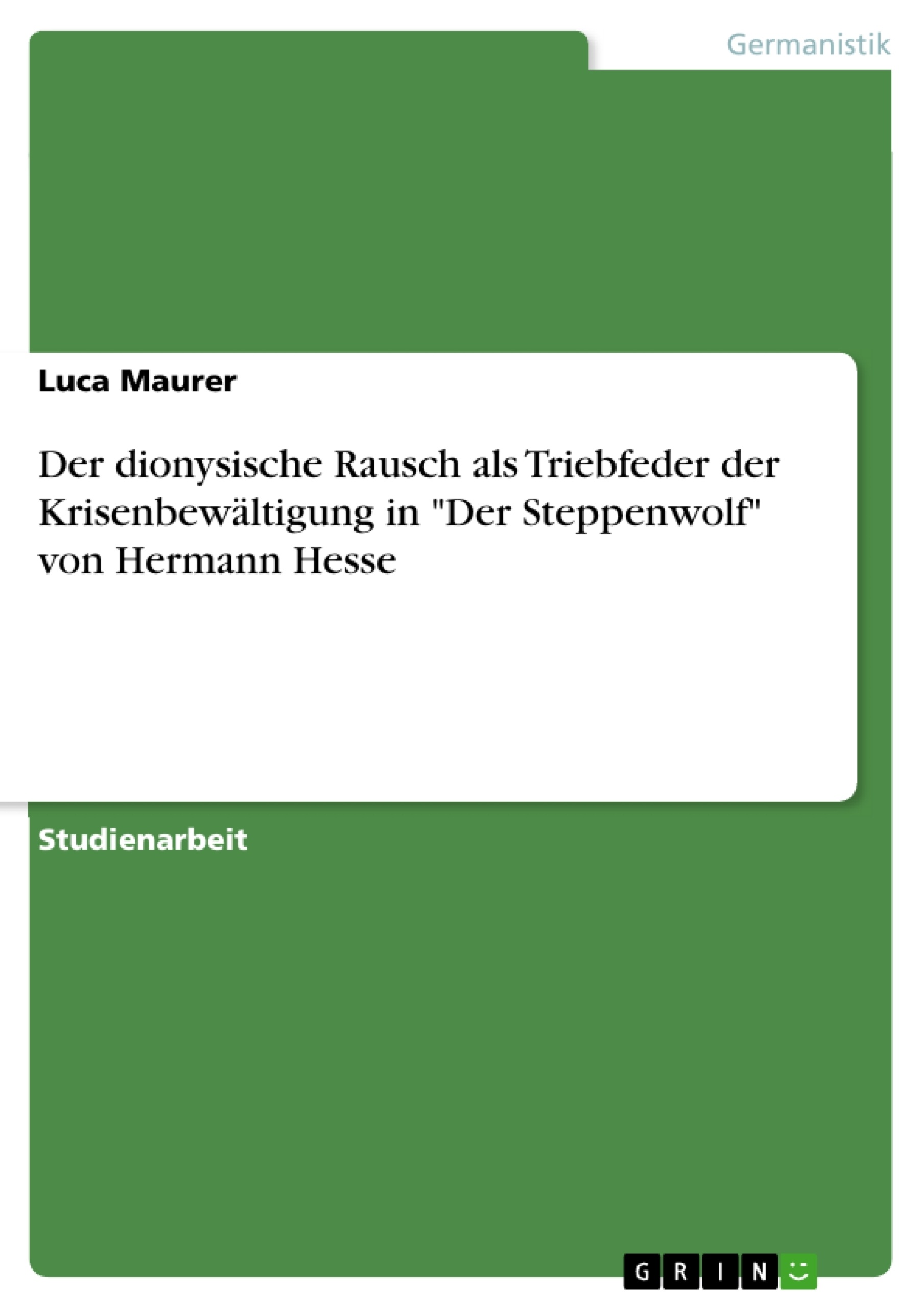Dem dionysischen Rausch wird innerhalb des Steppenwolfs eine besondere Geltung zuteil, die es genauer zu untersuchen gilt. Zunächst soll hierfür die Figurenkonzeption Harry Hallers vor dem Hintergrund Nietzsches untersucht und innerhalb des Spannungsfeldes zwischen Dionysischem und Apollinischem eingeordnet werden, um eine Operationsbasis für die Frage nach der Funktion und Überwindung dieses Gegensatzes schaffen zu können. Anschließend soll anhand dieser theoretischen Implikationen die Frage geklärt werden, ob und inwiefern der dionysische Rausch im Steppenwolf als Triebfeder der Krisenbewältigung dient und wie die scheinbare Aporie der Unvereinbarkeit von Apollinischem und Dionysischem innerhalb der Erzählung aufgelöst werden kann.
Hermann Hesses "Der Steppenwolf" ist eine Erzählung des Widerspruchs. Polaritäten der Zeit, scheinbar unvereinbare Vielheiten des Wesens und im Widerstreit liegende Sehnsüchte münden in einem Konfliktpluralismus, der das Gespalten Sein der Figur Harry Haller in seiner aporetischen Verstrickung äußerlich sinnfällig macht.
Mögliche Entfaltungs- und Verbalisierungsmöglichkeiten dieser diametral-aporetischen Opposition wurden in der Literaturwissenschaft eingehend erforscht. Dabei hat sich unter anderem ein Begriffsgespann der Kulturphilosophie Friedrich Nietzsches als hinreichendes Erklärungsmodell etabliert. Hesse selbst hat Nietzsche bereits früh rezipiert und innerhalb des Steppenwolfes häufig direkt auf dessen Werke verwiesen, weshalb die Berührungspunkte zwischen Hesses literarischer Produktion und Friedrich Nietzsches Philosophie unverkennbar scheinen. Nietzsche popularisiert in seiner Auseinandersetzung mit der griechischen Kultur zwei entgegengesetzte ästhetisch wirkende Impulse der Wesensausprägung, die er den griechischen Gottheiten Apollon und Dionysos zuschreibt.
Der Begriff des Apollinischen beschreibt innerhalb dieses Spannungsfelds das Maßvolle, Begrenzende und Formgebende. Dieser analytische Ordnungsanspruch resultiert in einem Ausdruck von Separation und Individualisierung. Das Prinzip des Dionysischen hingegen, verkörpert das ekstatische, sinnliche und triebhafte Streben nach Vereinigung und Deindividuation. Sinnstiftend wird diese Dichotomie im Steppenwolf, wenn die beiden Prinzipien aufeinanderprallen und „im offnen Zwiespalt mit einander“ sowohl in die Figurenkonzeption Harry Hallers als auch in die Konstitutionslogik der Erzählhandlung eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Im Zickzack zwischen Trieb und Geist: Die identitäre Krise Harry Hallers
- Märtyrer des Geistes: Die apollinische Heimat
- Märtyrer der Triebe: Der dionysische Ausbruch
- Zurück ins All: Der Weg aus der Krise
- Die Fiktion vom Ich: Der Schleier der Maya
- Wie Salz im Wasser: Der dionysische Rausch
- Abschließendes Urteil und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des dionysischen Rausches in Hermann Hesses "Der Steppenwolf" als Triebfeder der Krisenbewältigung des Protagonisten Harry Haller. Sie analysiert, wie die konträren Kräfte des Apollinischen und Dionysischen in Hallers Persönlichkeit und dem Spannungsfeld der Erzählung aufeinanderprallen und zur Herausbildung einer identitären Krise führen.
- Der Konflikt zwischen Apollinischem und Dionysischem in der Figur Harry Hallers
- Die Bedeutung des dionysischen Rausches als Mittel der Krisenbewältigung
- Die Auflösung der scheinbaren Aporie zwischen den gegensätzlichen Prinzipien im Werk
- Die Rezeption von Nietzsches Philosophie in Hesses "Der Steppenwolf"
- Die Rolle des Traums als apollinische Kunstwelt und Selbsttäuschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die zentrale Fragestellung ein und stellt die Bedeutung der apollinisch-dionysischen Dichotomie für die Analyse des Steppenwolfes heraus. Kapitel 2 beleuchtet die Identitätskrise des Protagonisten Harry Haller, die durch das Spannungsfeld zwischen Apollinischem und Dionysischem geprägt ist.
In Kapitel 2.1 wird Harrys apollinische Heimat, die durch Ordnung, Reinheit und den Traum geprägt ist, beschrieben. Kapitel 2.2 untersucht dann das dionysische Element in Hallers Persönlichkeit, das sich in seinem Lebensstil und dem Wunsch nach Vereinigung und Deindividuation äußert.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Weg aus der Krise. Kapitel 3.1 betrachtet die Rolle der Fiktion und des Traumes als "Schleier der Maya", während Kapitel 3.2 den dionysischen Rausch als Mittel der Krisenbewältigung untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Hermann Hesses "Der Steppenwolf" im Kontext der Nietzsche'schen Philosophie. Zentrale Begriffe sind das Apollinische und das Dionysische, die identitäre Krise, der dionysische Rausch, die Rolle des Traumes, die Auseinandersetzung mit der Kulturphilosophie und die Suche nach Heimat und Identität.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeuten „apollinisch“ und „dionysisch“ bei Nietzsche?
Das Apollinische steht für Ordnung, Maß und Form; das Dionysische für Rausch, Ekstase und die Auflösung der Individualität.
Wie zeigt sich Harry Hallers Krise im „Steppenwolf“?
Haller ist zwischen seinem geistigen, bürgerlichen Ich (Apollinisch) und seinem triebhaften, einsamen „Steppenwolf“ (Dionysisch) hin- und hergerissen.
Welche Rolle spielt der dionysische Rausch für die Krisenbewältigung?
Der Rausch dient als Triebfeder, um die starren Grenzen des Ichs zu überwinden und eine neue Einheit des Wesens zu finden.
Was ist der „Schleier der Maya“ in Hesses Erzählung?
Es beschreibt die Fiktion des Ichs und die Täuschung durch die apollinische Kunstwelt, die Harry Haller hinter sich lassen muss.
Wie löst Hesse den Widerspruch zwischen Trieb und Geist auf?
Die Arbeit analysiert, wie die scheinbare Unvereinbarkeit innerhalb der Erzähllogik durch dionysische Erfahrungen und Selbsterkenntnis aufgelöst wird.
- Quote paper
- Luca Maurer (Author), 2021, Der dionysische Rausch als Triebfeder der Krisenbewältigung in "Der Steppenwolf" von Hermann Hesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030360