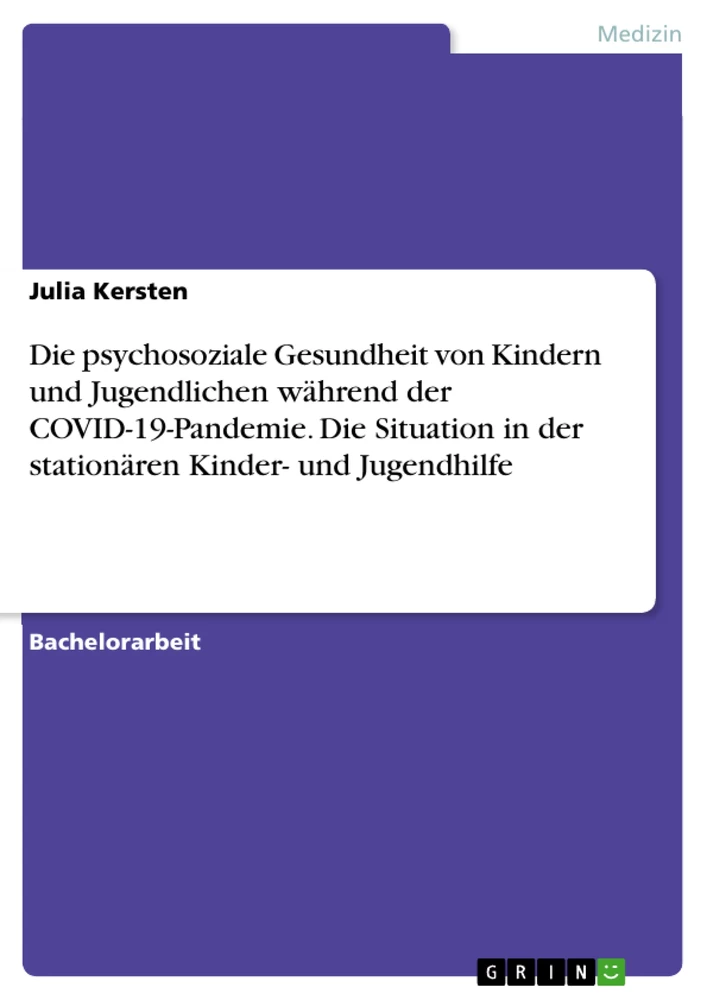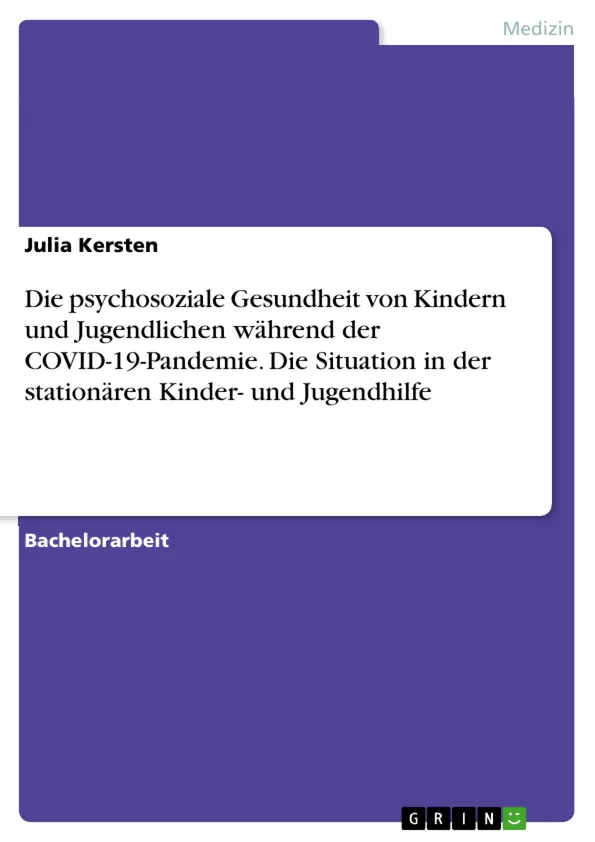Um der COVID-19-Pandemie entgegenzuwirken, wurden Eindämmungsmaßnahmen und Kontaktbeschränkungen initiiert, die weitreichende Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Zusammenleben haben. Besonders für Kinder und Jugendliche ist seit Anfang 2020 ein gewohnter Alltag nicht mehr möglich. In Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe benötigen gerade sie daher einen strukturierten und gewohnten Tagesablauf, der ihnen fernab von der Herkunftsfamilie Sicherheit gibt.
Ziel der vorliegenden Bachelor-Thesis ist es, aus Sicht von betreuenden Sozialpädagog*innen einen Einblick in das Erleben von Kindern und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe während der COVID-19-Pandemie zu geben und Rückschlüsse auf deren psychosoziale Gesundheit zu ziehen. Dazu wird folgende Forschungsfrage gestellt: „Wie erleben Sozialpädagog*innen die psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe während der COVID-19-Pandemie?“
Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt und ein teilstandardisiertes Leitfadeninterview durchgeführt. Insgesamt wurden fünf Sozialpädagoginnen aus drei verschiedenen Bundesländern interviewt. Im Anschluss an die Interviews erfolgte eine strukturierte Inhaltsanalyse nach Mayring sowie eine deduktiv-induktive Kategorienbildung. Die qualitative Forschungsarbeit zeigt, dass Kinder und Jugendliche, die sich während der COVID-19-Pandemie in der stationären Kinder- und Jugendhilfe befinden, in ihrer psychosozialen Gesundheit insbesondere während eines Lockdowns beeinträchtigt sind. Aus den Ergebnissen lassen sich verschiedene Handlungsmaßnahmen und weiterer Forschungsbedarf ableiten.
Inhaltsverzeichnis
- Problemhintergrund
- Zielentwicklung und Fragestellung
- Theoretischer Rahmen
- COVID-19-Pandemie
- Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland
- Die stationäre Kinder- und Jugendhilfe
- Psychosoziale Gesundheit
- Methodik
- Stichprobenbildung
- Datenerhebung
- Datenauswertung
- Ergebnisse
- Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Thesis analysiert die psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe während der COVID-19-Pandemie aus der Perspektive von Sozialpädagog*innen. Ziel der Arbeit ist es, die Erfahrungen der Betreuenden zu beleuchten und Rückschlüsse auf die Auswirkungen der Pandemie auf die psychosoziale Entwicklung der jungen Menschen zu ziehen.
- Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe
- Die Erfahrungen von Sozialpädagog*innen mit den Herausforderungen und Folgen der Pandemie
- Die Rolle von strukturierten Tagesabläufen und familiären Unterstützungssystemen während der Pandemie
- Handlungsmöglichkeiten zur Unterstützung der psychosozialen Gesundheit der Kinder und Jugendlichen
- Der Einfluss von Lockdown-Maßnahmen auf die psychosoziale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Der Problemhintergrund beleuchtet die umfassenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das gesellschaftliche Zusammenleben und die besonderen Herausforderungen für Kinder und Jugendliche, insbesondere im Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel definiert die Zielsetzung der Thesis und die Forschungsfrage, die sich auf die Erfahrungen von Sozialpädagog*innen mit der psychosozialen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie konzentriert.
- Kapitel 3: Der theoretische Rahmen stellt die relevanten Konzepte der COVID-19-Pandemie, der stationären Kinder- und Jugendhilfe sowie der psychosozialen Gesundheit vor.
- Kapitel 4: Die Methodik beschreibt die Forschungsstrategie, die Stichprobenbildung, die Datenerhebung durch teilstandardisierte Leitfadeninterviews und die Datenauswertung mithilfe einer strukturierten Inhaltsanalyse.
- Kapitel 5: Die Ergebnisse der qualitativen Forschungsarbeit werden präsentiert und analysiert.
- Kapitel 6: Die Ergebnisse werden im Kontext des theoretischen Rahmens diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Bachelor-Thesis sind die COVID-19-Pandemie, die stationäre Kinder- und Jugendhilfe, die psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die Erfahrungen von Sozialpädagog*innen, qualitative Forschungsmethoden, strukturierte Inhaltsanalyse, Lockdown-Maßnahmen und Handlungsmaßnahmen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkte sich der Lockdown auf Kinder in Heimen aus?
Lockdowns führten zu erheblichen psychosozialen Belastungen, da gewohnte Strukturen, Kontakte zur Herkunftsfamilie und Freizeitangebote wegfielen.
Was ist die stationäre Kinder- und Jugendhilfe?
Dazu gehören Einrichtungen wie Kinderheime oder Wohngruppen, in denen Kinder leben, die vorübergehend oder dauerhaft nicht in ihren Familien bleiben können.
Was berichten Sozialpädagogen über die Pandemie-Zeit?
Interviews zeigen, dass Pädagogen eine Zunahme von psychischen Auffälligkeiten, Einsamkeit und Stress bei den betreuten Kindern wahrgenommen haben.
Warum ist ein strukturierter Tagesablauf so wichtig?
Struktur gibt Kindern in der Jugendhilfe Sicherheit und Vorhersehbarkeit, was besonders in Krisenzeiten für die psychosoziale Gesundheit essenziell ist.
Welche Handlungsmaßnahmen werden empfohlen?
Empfohlen werden unter anderem bessere digitale Ausstattung für Heimkinder, verstärkte psychologische Betreuung und flexiblere Konzepte für Kontaktbeschränkungen.
- Quote paper
- Julia Kersten (Author), 2021, Die psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen während der COVID-19-Pandemie. Die Situation in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030386