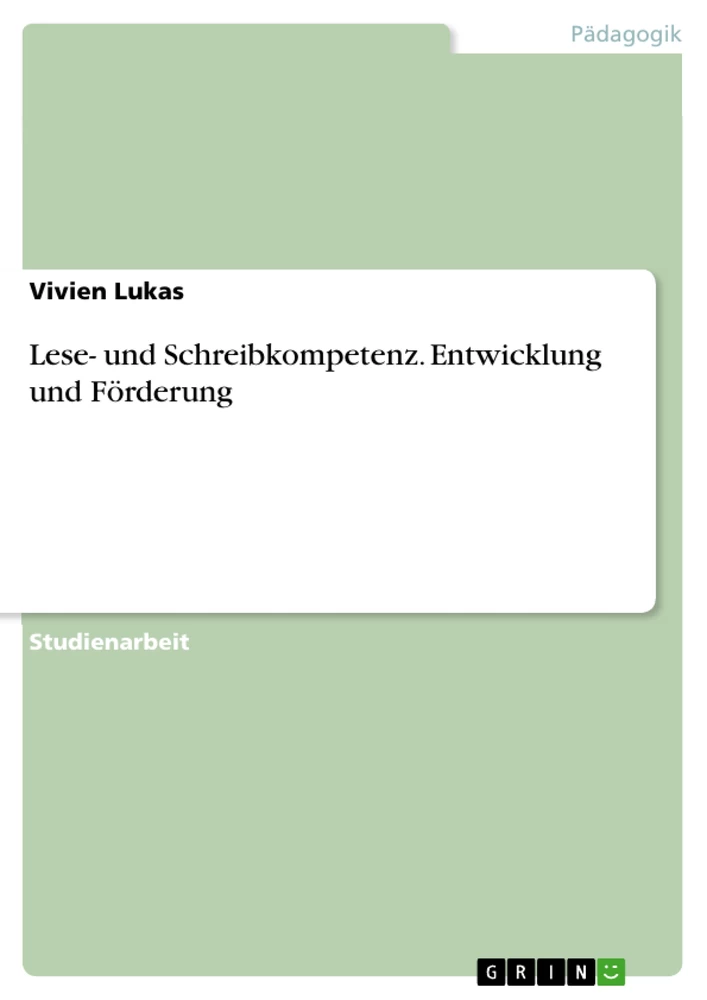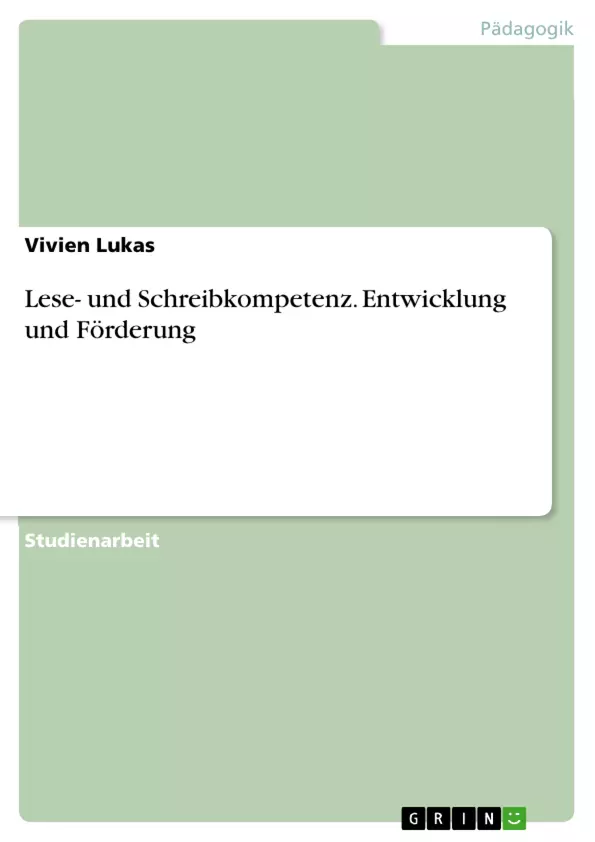In diesem Portfolio werde ich Lösungsansätze für die Förderung von Schülerinnen und Schülern und angehenden Lehrkräften erforschen. Hierbei werde ich den Fokus insbesondere auf die Entwicklung und Förderung der Lese- und Schreibkompetenz setzen. Mittels einer literaturbasierten Analyse und im Seminar behandelten Unterrichtssituationen werde ich Handlungsvorschläge für Problemsituationen aufgreifen, die beispielsweise bei einer Aufgabengestaltung
von Lehrkräften auftreten können. Zur Vervollständigung werde ich im Rahmen des Portfolios zwei schulische Texte behandeln und exemplarisch im Kapitel der narrativen Beschreibung eigene Schreibprozesse analysieren und reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schreibkompetenz und Schreibkompetenzentwicklung
- 3. Lesekompetenz und Lesekompetenzentwicklung
- 4. Leseförderung
- 5. Lesesozialisation
- 6. Aufgabengestaltung
- 7. Text-Feedback
- 8. Schulische Textform - Narratives Beschreiben
- 9. Schulische Textform - Berichten
- 10. Abschlussreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Portfolio befasst sich mit Lösungsansätzen zur Förderung der Lese- und Schreibkompetenz von Schülerinnen und Schülern sowie angehenden Lehrkräften. Es werden Handlungsvorschläge für Problemsituationen, die im Unterricht auftreten können, entwickelt und mithilfe literaturbasierter Analysen sowie im Seminar behandelter Unterrichtssituationen veranschaulicht. Das Portfolio beinhaltet zudem eine exemplarische Analyse und Reflexion eigener Schreibprozesse im Kontext der narrativen Beschreibung schulischer Texte.
- Entwicklung und Förderung der Lese- und Schreibkompetenz
- Handlungsvorschläge für Problemsituationen im Unterricht
- Literaturbasierte Analysen und Reflexion eigener Schreibprozesse
- Analyse schulischer Texte
- Professionalisierungsprozess angehender Lehrkräfte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung legt den Schwerpunkt auf die Bedeutung der Lese- und Schreibkompetenz im Deutschunterricht und die Notwendigkeit, diese bei Schülerinnen und Schülern sowie angehenden Lehrkräften zu fördern. Es wird auf die Debatte um Studieneingangstests eingegangen und verschiedene Standpunkte von Experten aus dem Bereich der Sprachdidaktik und Literaturwissenschaft beleuchtet.
2. Schreibkompetenz und Schreibkompetenzentwicklung
Dieses Kapitel definiert die Schreibkompetenz und erläutert den Schreibprozess als einen komplexen, mental anspruchsvollen Prozess, der verschiedene kognitive und graphomotorische Fähigkeiten erfordert. Die Bedeutung der Schreibmotivation und der notwendigen Kompetenzen wie Orthografie, Grammatik und Handschrift werden hervorgehoben.
3. Lesekompetenz und Lesekompetenzentwicklung
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Thema Lesekompetenz und ihrer Entwicklung. Es werden verschiedene Aspekte der Lesekompetenz, wie die Fähigkeit zum Verstehen und Interpretieren von Texten, sowie die Relevanz der Lesestrategien und Lesemotivation beleuchtet.
4. Leseförderung
In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden und Ansätze zur Leseförderung vorgestellt und diskutiert. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern gezielt gefördert werden kann.
5. Lesesozialisation
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Einfluss der Lesesozialisation auf die Entwicklung der Lesekompetenz. Es werden verschiedene Faktoren, die die Lesesozialisation beeinflussen, untersucht und die Bedeutung des familiären und schulischen Umfelds für die Leseförderung hervorgehoben.
6. Aufgabengestaltung
Das Kapitel behandelt die Gestaltung von Aufgaben im Deutschunterricht, die die Lese- und Schreibkompetenz fördern. Es werden verschiedene Aufgabentypen vorgestellt und Kriterien für die Auswahl und Gestaltung von geeigneten Aufgaben erörtert.
7. Text-Feedback
Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von Text-Feedback für die Entwicklung der Schreibkompetenz. Es werden verschiedene Arten von Feedback vorgestellt und deren Einfluss auf den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler untersucht.
8. Schulische Textform - Narratives Beschreiben
In diesem Kapitel wird die schulische Textform des narrativen Beschreibens analysiert und reflektiert. Es werden Merkmale und Anforderungen dieser Textform sowie verschiedene Strategien zum Verfassen eines narrativen Beschreibens vorgestellt.
9. Schulische Textform - Berichten
Dieses Kapitel fokussiert auf die schulische Textform des Berichtens. Es werden Merkmale und Anforderungen dieser Textform sowie verschiedene Strategien zum Verfassen eines Berichtes vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieses Portfolios sind die Entwicklung und Förderung der Lese- und Schreibkompetenz, die Gestaltung von Aufgaben im Deutschunterricht, die Analyse und Reflexion von Schreibprozessen sowie die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Ansätzen zur Förderung von Lernenden.
Häufig gestellte Fragen
Wie lässt sich Schreibkompetenz im Unterricht fördern?
Durch gezielte Schreibaufgaben, die Berücksichtigung von Schreibmotivation und regelmäßiges Text-Feedback, das den kognitiven Schreibprozess unterstützt.
Was ist der Unterschied zwischen Lesekompetenz und Lesesozialisation?
Lesekompetenz ist die Fähigkeit, Texte zu verstehen; Lesesozialisation beschreibt den Prozess des Hineinwachsens in die Lesekultur durch Familie und Schule.
Welche Bedeutung hat Text-Feedback für Schüler?
Feedback hilft Lernenden, ihre eigenen Texte kritisch zu reflektieren und orthografische sowie inhaltliche Strategien für zukünftige Schreibprozesse zu verbessern.
Was sind typische schulische Textformen in der Sekundarstufe?
Die Arbeit behandelt insbesondere das narrative Beschreiben und das Berichten als zentrale Kompetenzbereiche im Deutschunterricht.
Warum ist die Aufgabengestaltung für Lehrkräfte so wichtig?
Eine gute Aufgabengestaltung setzt klare Lernziele und motiviert Schüler dazu, ihre Lese- und Schreibstrategien aktiv anzuwenden und weiterzuentwickeln.
- Quote paper
- Vivien Lukas (Author), 2020, Lese- und Schreibkompetenz. Entwicklung und Förderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030440