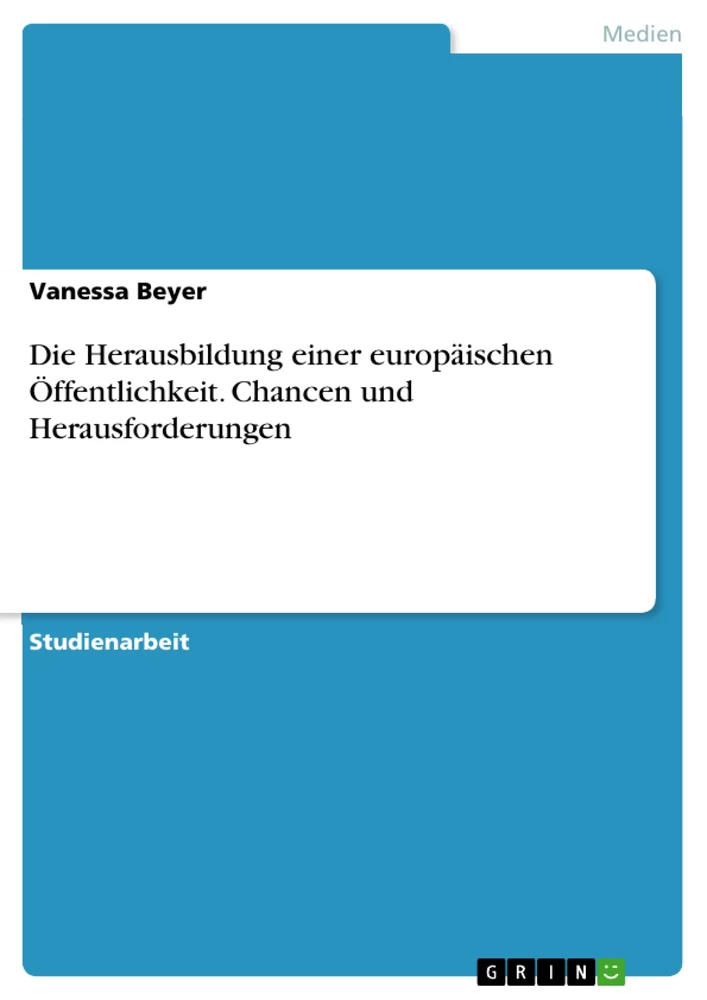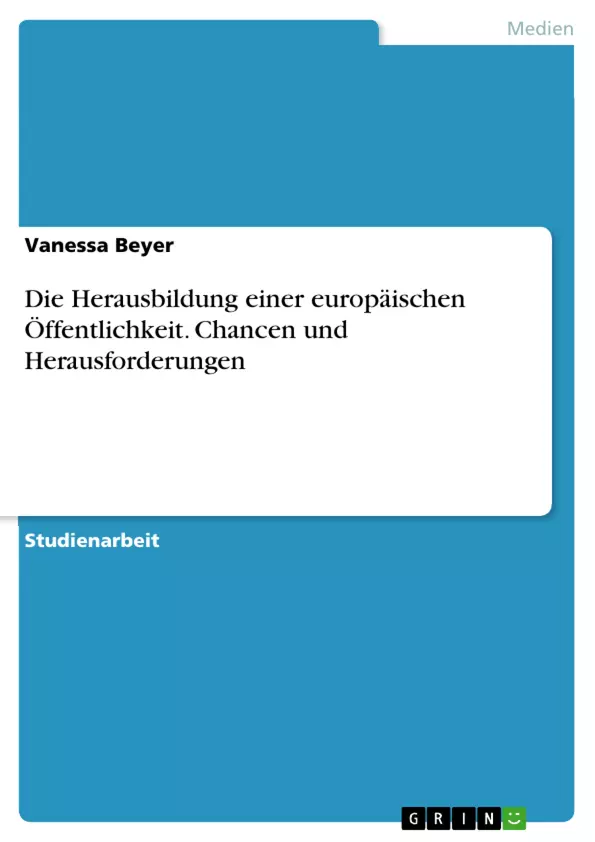Die vorliegende Arbeit wird zunächst in einer theoretischen Abhandlung eine Annäherung an den Begriff Digitalisierung vornehmen und einen Bezug zum theoretischen Konzept der Mediatisierung nach Friedrich Krotz herstellen, das makro- und mikrosoziologische Erscheinungen und Prozesse im Verhältnis zueinander betrachtet. Hiernach wird, auf Grundlage
der diskurstheoretischen Überlegungen von Jürgen Habermas und dem daran anschließenden modifizierten Verständnis verschiedener Autoren, der Begriff Öffentlichkeit gefasst.
Hierauf aufbauend wird ein Verständnis einer europäischen Öffentlichkeit entwickelt, dass die Grundannahmen sowie Grundproblematiken der Entstehung von Öffentlichkeit im transnationalen Raum diskutiert. Vor dem Hintergrund der bereits erläuterten demokratietheoretischen Qualitäten und Funktionen einer Öffentlichkeit haben Ferree et al. vier normative Kriterien identifiziert, die universell auf verschiedene Perspektiven und Demokratiemodelle anwendbar sind. Da die Europäische Union innerhalb der Europaforschung als ein politisches System sui generis gilt und sich selbst nach Art. 10 Abs. 1 EUV als repräsentative Demokratie versteht, sind diese vier Kriterien auch auf eine Öffentlichkeit der europäischen Demokratie anwendbar.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- PROBLEMSTELLUNG UND FORSCHUNGSINTERESSE
- AUFBAU UND METHODIK
- THEORETISCHE ANNÄHERUNG
- DIGITALISIERUNG UND MEDIATISIERUNG
- KONZEPTION EINER EUROPÄISCHEN ÖFFENTLICHKEIT
- Theoretische Grundlage einer europäischen Öffentlichkeit
- Definition europäische Öffentlichkeit
- EUROPÄISCHE ÖFFENTLICHKEIT IM DIGITALEN WANDEL
- WHO
- WHAT
- How
- OUTCOME
- AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die vielfältigen Auswirkungen der Digitalisierung auf die Strukturen einer politischen Öffentlichkeit im europäischen Kontext zu beleuchten und die Chancen und Herausforderungen für die Realisierung der Legitimationsfunktion einer europäischen Öffentlichkeit im digitalen Raum zu analysieren.
- Die Rolle der Digitalisierung im Wandel öffentlicher Kommunikation und ihre Auswirkungen auf die Entstehung und Konstituierung von Öffentlichkeit
- Das Konzept der europäischen Öffentlichkeit und die theoretischen Grundlagen für die Herausbildung eines transnationalen öffentlichen Raums
- Die Analyse von Chancen und Herausforderungen im Rahmen digitalisierter Öffentlichkeiten im transnationalen Raum für die Bewältigung des Öffentlichkeitsdefizits der Europäischen Union
- Die kritische Betrachtung der demokratietheoretischen Qualitäten und Funktionen einer europäischen Öffentlichkeit im digitalen Kontext
- Die Untersuchung von vier normativen Kriterien, die für die Gestaltung einer öffentlichen Kommunikation in der Europäischen Union relevant sind: Wer sollte sprechen, worüber, in welchem Stil und welche Auswirkungen hat die Kommunikation auf die Entscheidungsfindung?
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Forschungsinteresse der Arbeit vor, welches sich auf die Untersuchung der Auswirkungen der Digitalisierung auf die Strukturen einer politischen Öffentlichkeit im europäischen Kontext konzentriert. Die Arbeit beleuchtet das Öffentlichkeitsdefizit der Europäischen Union und analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich im digitalen Raum für die Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit ergeben.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der theoretischen Annäherung an die Themen Digitalisierung und Mediatisierung. Es werden relevante Theorien zur Entstehung und Entwicklung von Öffentlichkeit vorgestellt und das Konzept der europäischen Öffentlichkeit diskutiert.
Das dritte Kapitel analysiert die Europäische Öffentlichkeit im digitalen Wandel, indem es die Fragen wer, was, wie und mit welchen Folgen im Rahmen der öffentlichen Kommunikation im digitalen Raum relevant sind, beleuchtet.
Das vierte Kapitel bietet einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen der Europäischen Öffentlichkeit im digitalen Raum.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Digitalisierung, Mediatisierung, europäische Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsdefizit, Demokratie, Transnationalität, Kommunikation, Legitimation und Partizipation.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer „europäischen Öffentlichkeit“?
Es ist ein transnationaler Kommunikationsraum, in dem politische Themen der EU über Staatsgrenzen hinweg diskutiert werden und so eine demokratische Legitimation ermöglichen.
Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Öffentlichkeit?
Die Digitalisierung senkt Barrieren für grenzüberschreitende Kommunikation, birgt aber auch Gefahren wie Fragmentierung oder die Entstehung von Filterblasen.
Was ist das „Öffentlichkeitsdefizit“ der EU?
Es beschreibt die Problematik, dass EU-Entscheidungen oft fernab der Bürger getroffen werden und es an einem gemeinsamen Raum für politische Debatten mangelt.
Welche normativen Kriterien für Öffentlichkeit gibt es?
Nach Ferree et al. sind dies: Wer spricht (Inklusion), worüber (Themenrelevanz), in welchem Stil (Diskursqualität) und mit welcher Wirkung (Outcome).
Was bedeutet „Mediatisierung“ nach Friedrich Krotz?
Mediatisierung beschreibt den langfristigen Prozess, in dem Medien immer stärker alle Bereiche von Kultur und Gesellschaft durchdringen und verändern.
Kann das Internet das Demokratiedefizit der EU lösen?
Es bietet Chancen für mehr Partizipation und Transparenz, erfordert aber auch neue Formen der digitalen politischen Bildung und Regulierung.
- Citar trabajo
- Vanessa Beyer (Autor), 2020, Die Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit. Chancen und Herausforderungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030470