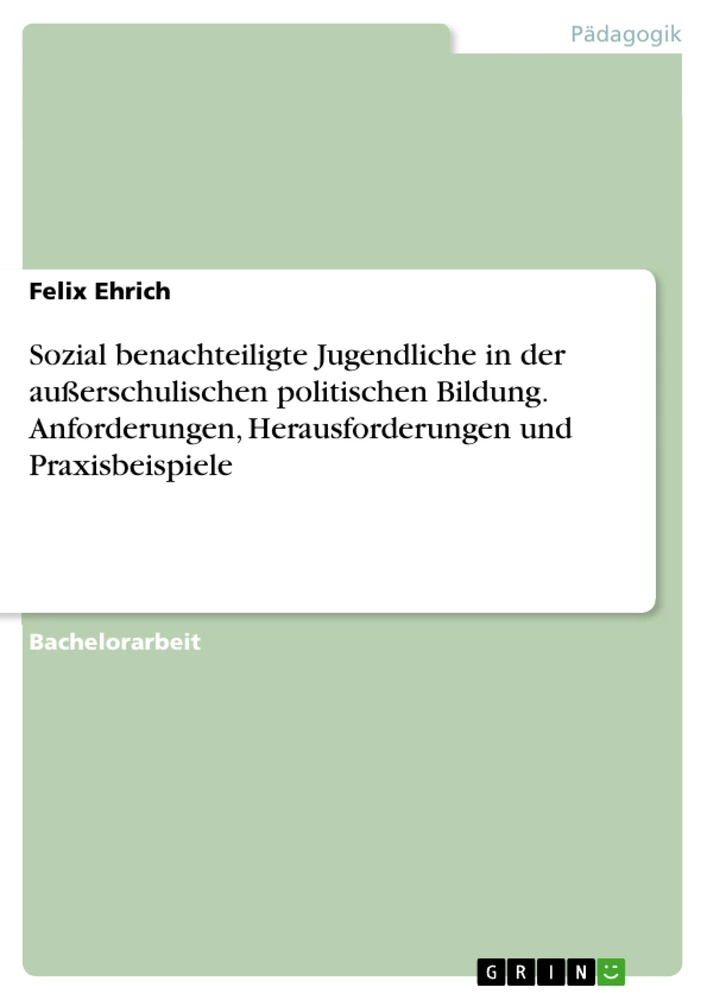In dieser Bachelorarbeit soll die politische außerschulische Jugendbildung mit der Zielgruppe der Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten oder Milieus analysiert und erläutert werden. Zentral wird dabei die Frage sein, inwieweit Jugendliche aus bildungsfernen Schichten an der politischen Bildung interessiert sind und ihre Angebote wahrnehmen.
In den 70er und 80er Jahren erfuhr die politische Jugendbildung durch neue Gesetze und Fördermittel eine Zeit des Aufschwungs. In den folgenden zwei Jahrzehnten erlebte die Bundesrepublik Deutschland eine steigende Zahl an Jugendarbeitslosigkeit, womit sich die Gruppe der sozial benachteiligten Jugendlichen erheblich erhöhte und die Betroffenen, aufgrund ihrer persönlichen geringen Zukunftsaussichten, von der politischen Jugendbildung schwerer zu erreichen waren. Die Folgen waren die Errichtung neuer Kooperationen mit Trägern der Jugendhilfe und Schulen, um die politische Jugendbildung mit sozial Benachteiligten zu intensivieren.
Auf der Bundesebene manifestierte sich dieses Ziel ebenfalls weiter. Im Jahr 1999 startete das bundesweite Programm "Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten", womit die sozialen Bedingungen und Lebenswelten der Jugendlichen verbessert werden sollten. Dabei war es ebenso zentrales Anliegen der Fachorganisationen eine politische und gesellschaftliche Integration der sozial benachteiligten Jugendlichen zu fördern.
Heutzutage ergeben sich unterschiedliche An- und Herausforderungen an die außerschulische politische Jugendbildung, die sich auf die Zielgruppe der bildungsbenachteiligten Jugendlichen spezialisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Entwicklung der politischen Bildung
- Historischer Überblick
- Rechtlicher Rahmen
- Institutionen
- Die Landeszentralen für politische Bildung
- Volkshochschulen
- Freie Träger der außerschulischen politischen Bildung
- Analyse der politischen Bildung mit sozial benachteiligten Jugendlichen
- Zielgruppenanalyse
- Prekäre Jugendliche
- Materialistische Hedonisten
- Gemeinsamkeiten
- Teilnahmehindernisse durch die Bildungsträger und Politik
- Evaluierung der Beteiligung an politischer Bildung
- Außerschulische politische Bildung mit Bildungsfernen in der Praxis
- Anforderungen und Herausforderungen
- Gestaltungsprinzipien
- Subjektorientierung
- Partizipation
- Anerkennung
- Handlungsorientierung
- Verknüpfung von Anforderungen und Gestaltungsprinzipien
- Praxisbeispiele
- Das Partizipationsmodell „laut!“
- ,,Wir haben was zu sagen”
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der außerschulischen politischen Bildung mit sozial benachteiligten Jugendlichen und analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten dieser Bildungsarbeit. Im Fokus stehen die spezifischen Bedürfnisse und Lebenswelten dieser Zielgruppe sowie die Entwicklung geeigneter Bildungsangebote und -methoden.
- Herausforderungen der außerschulischen politischen Bildung mit sozial benachteiligten Jugendlichen
- Entwicklung und Gestaltung von Bildungsprogrammen für bildungsferne Jugendliche
- Analyse von Erfolgsfaktoren und Erfolgsmodellen für die politische Bildung mit dieser Zielgruppe
- Partizipation und Handlungsfähigkeit als zentrale Elemente der politischen Bildung
- Der Einfluss von sozialen und politischen Strukturen auf die Bildungschancen von Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Problematik der politischen Bildung mit sozial benachteiligten Jugendlichen und führt in die Thematik der Bildungsförderung in diesem Kontext ein. Es wird die Entwicklung der politischen Bildung im historischen Kontext sowie der rechtliche Rahmen und die beteiligten Institutionen beschrieben. Die Analyse der politischen Bildung mit sozial benachteiligten Jugendlichen betrachtet die spezifischen Merkmale dieser Zielgruppe, die Herausforderungen der Teilhabe an politischen Bildungsangeboten und die Evaluierung der Beteiligung. Das Kapitel „Außerschulische politische Bildung mit Bildungsfernen in der Praxis" befasst sich mit den Anforderungen und Herausforderungen der politischen Bildung mit Bildungsfernen und beleuchtet verschiedene Gestaltungsprinzipien sowie Praxisbeispiele erfolgreicher Projekte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der politischen Bildung, insbesondere im Kontext der sozialen Benachteiligung von Jugendlichen. Wesentliche Schlüsselbegriffe sind: Außerschulische politische Bildung, Bildungsferne, Partizipation, Handlungsfähigkeit, soziale Benachteiligung, Zielgruppenanalyse, Gestaltungsprinzipien, Praxisbeispiele.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist politische Bildung für sozial benachteiligte Jugendliche schwierig?
Jugendliche aus bildungsfernen Schichten haben oft geringe Zukunftsaussichten und fühlen sich von traditionellen politischen Bildungsangeboten nicht angesprochen oder repräsentiert.
Was sind die zentralen Gestaltungsprinzipien der Arbeit mit Bildungsfernen?
Wichtige Prinzipien sind Subjektorientierung, Partizipation (Mitbestimmung), Anerkennung und Handlungsorientierung, um die Jugendlichen direkt in ihrer Lebenswelt abzuholen.
Welche Rolle spielen Institutionen wie Volkshochschulen und freie Träger?
Sie fungieren als Akteure der außerschulischen Bildung und kooperieren oft mit der Jugendhilfe, um spezialisierte Programme für benachteiligte Gruppen anzubieten.
Was ist das Partizipationsmodell „laut!“?
Es ist ein Praxisbeispiel für ein Modell, das Jugendlichen eine Stimme gibt und zeigt, wie politische Teilhabe konkret organisiert werden kann.
Wie hat sich die politische Jugendbildung seit den 70er Jahren verändert?
Nach einem Aufschwung durch neue Gesetze führten steigende Jugendarbeitslosigkeit und soziale Brennpunkte zu neuen Programmen wie "Entwicklung und Chancen junger Menschen".
- Quote paper
- Felix Ehrich (Author), 2019, Sozial benachteiligte Jugendliche in der außerschulischen politischen Bildung. Anforderungen, Herausforderungen und Praxisbeispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030573