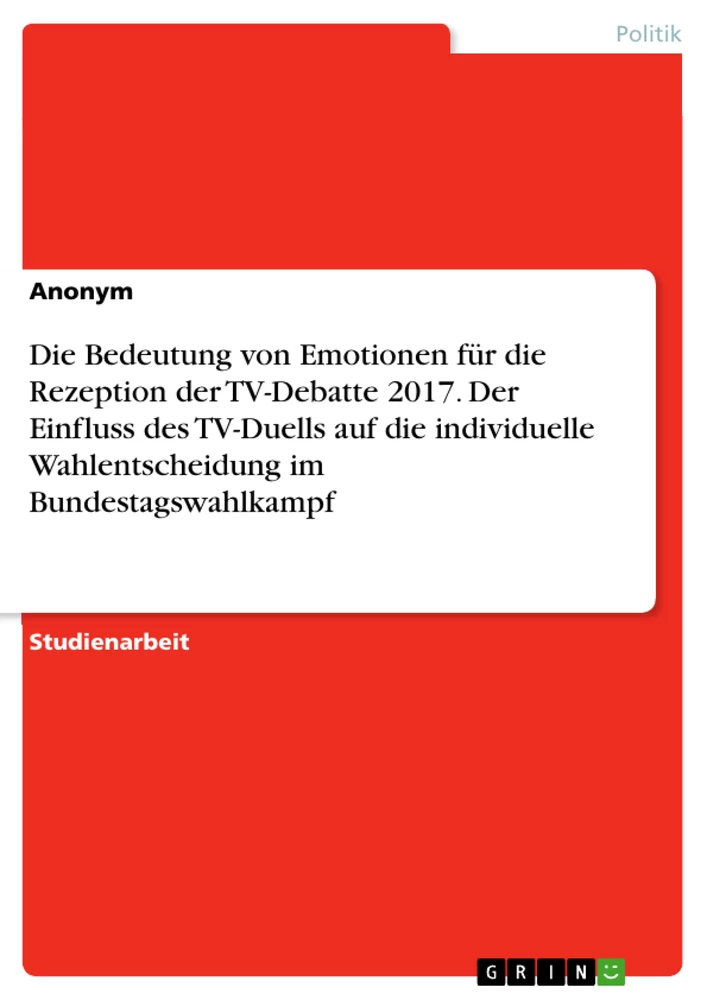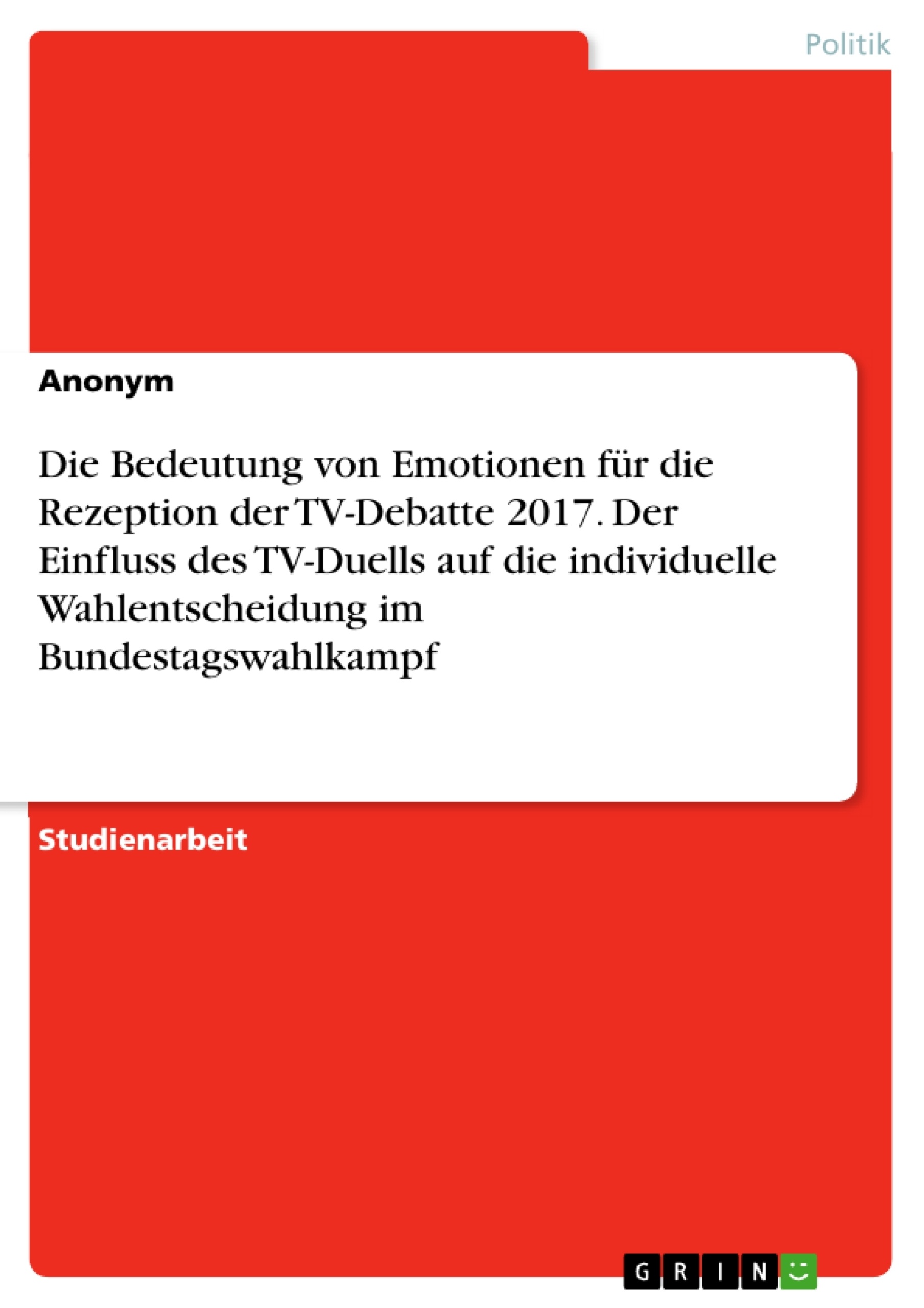Im Rahmen der Ausarbeitung soll der Ansatz der affektiven Theorie auf seine empirische Validität untersucht werden. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird zunächst diskutiert, wie Wähler*innen ihre Wahlentscheidung treffen und welche Rolle den TV-Duellen dabei zukommt. Dieser Teil der Diskussion legt den Schwerpunkt auf die Theorie der affektiven Intelligenz. Die Argumente der Theorie der affektiven Intelligenz werden dazu genutzt, eine empirisch prüfbare Hypothese zur Bundestagswahl 2017 zu formulieren. Diese Erwartung wird behelfsweise unter Anwendung einer Analogie und unter Bezugnahme auf vorhergehende Untersuchungen überprüft. Die Hausarbeit schließt mit einer kurzen Zusammenfassung und Diskussion der zentralen Ergebnisse. Unter kritischer Auseinandersetzung des TV-Duells als Instrument im Wahlkampf wird ein Fazit gezogen, das insbesondere die zukünftige Bedeutung des Experimentellen Designs sowie der Realtime-Response-Messung (RTR) als Mittel der Datenerhebung betont.
Am 26.09.2021 stehen in der Bundesrepublik Deutschland erneut die Wahlen zum Bundestag an. Erstmals bei der Bundestagswahl 2002 durchgeführt, sind TV-Debatten von Kanzlerkandidat*innen mittlerweile fester Bestandteil bundesdeutscher Wahlkämpfe. Bereits im Vorfeld der Bundestagswahl 2002 galten die TV-Duelle als zentrales Wahlkampfereignis, die von rund 15 Millionen Menschen rezipiert wurden. Die Bedeutsamkeit der ursprünglich nach US-amerikanischem Vorbild geschaffenen Debattenmodelle ist seit ihrer Etablierung nur gestiegen. So erreichte das TV-Duell „Merkel - Schulz“ 2017 insgesamt 16,3 Millionen Zuschauende, was einen Marktanteil von 46,1 Prozent entspricht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wahlverhaltenstheorien und Emotionen
- Theorie der affektiven Intelligenz
- Forschungsstand und Hypothese
- Empirische Analyse: Das TV-Duell „Merkel-Schulz“, 2017
- Direkte und indirekte Debatteneffekte
- Experimentelles Design und RTR
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Emotionen für die Rezeption der TV-Debatte im Bundestagswahlkampf 2017. Sie analysiert, inwiefern das Format des TV-Duells die individuelle Wahlentscheidung beeinflussen kann. Dazu bedient sie sich der Theorie der affektiven Intelligenz.
- Die Bedeutung von TV-Debatten im deutschen Wahlkampf
- Die Rolle von Emotionen im Wahlverhalten
- Die Theorie der affektiven Intelligenz und ihre Anwendung auf das TV-Duell 2017
- Direkte und indirekte Debatteneffekte auf die Wahlentscheidung
- Das Potenzial experimenteller Designs und RTR-Messungen für die Wahlverhaltensforschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung erläutert die Bedeutung von TV-Debatten im deutschen Wahlkampf und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss von Emotionen auf die Rezeption des TV-Duells „Merkel-Schulz“ 2017.
- Wahlverhaltenstheorien und Emotionen: Dieses Kapitel diskutiert verschiedene Wahlverhaltenstheorien und stellt die Theorie der affektiven Intelligenz als theoretischen Rahmen für die Untersuchung vor.
- Theorie der affektiven Intelligenz: Die Theorie der affektiven Intelligenz wird vorgestellt und ihre Relevanz für die Erklärung von kurzfristigen Wahlentscheidungen im Kontext von TV-Duellen erläutert.
- Forschungsstand und Hypothese: Anhand der Theorie der affektiven Intelligenz wird eine empirisch prüfbare Hypothese für die Bundestagswahl 2017 formuliert.
- Empirische Analyse: Das TV-Duell „Merkel-Schulz“, 2017: Dieses Kapitel präsentiert die empirische Analyse des TV-Duells „Merkel-Schulz“ 2017. Aufgrund fehlender Forschungsdaten für dieses spezifische Duell wird ein analoges Vorgehen gewählt, das auf früheren Studien basiert.
- Direkte und indirekte Debatteneffekte: Die Analyse untersucht die direkten und indirekten Effekte des TV-Duells auf die Wahlentscheidung der Wähler*innen.
- Experimentelles Design und RTR: Der Abschnitt diskutiert die Notwendigkeit von experimentellen Designs und Realtime-Response-Messungen (RTR) in zukünftigen Forschungsarbeiten zum Thema TV-Duell und Wahlentscheidung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte der Arbeit sind: TV-Debatten, Wahlverhalten, Emotionen, affektive Intelligenz, TV-Duell "Merkel-Schulz" 2017, direkte und indirekte Debatteneffekte, Wahlentscheidung, Experimentelles Design, Realtime-Response-Messung (RTR).
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Emotionen die Wahrnehmung von TV-Duellen?
Emotionen steuern die Aufmerksamkeit und Bewertung der Kandidaten; die Theorie der affektiven Intelligenz erklärt, wie Gefühle kurzfristige Wahlentscheidungen beeinflussen.
Was ist die Theorie der affektiven Intelligenz?
Sie besagt, dass politische Urteile nicht rein rational, sondern durch emotionale Systeme (wie Angst oder Enthusiasmus) beeinflusst werden, die Informationen filtern.
Welche Rolle spielte das TV-Duell Merkel-Schulz 2017?
Es war ein zentrales Wahlkampfereignis mit über 16 Millionen Zuschauern, das direkte und indirekte Effekte auf die Kandidatenpräferenz hatte.
Was bedeutet Realtime-Response-Messung (RTR)?
RTR ist ein Verfahren, bei dem Zuschauer während der Debatte per Knopfdruck ihre Zustimmung oder Ablehnung in Echtzeit signalisieren.
Können TV-Duelle eine Wahl entscheiden?
Sie wirken vor allem bei unentschlossenen Wählern mobilisierend oder verfestigen bestehende Meinungen durch emotionale Bestätigung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Die Bedeutung von Emotionen für die Rezeption der TV-Debatte 2017. Der Einfluss des TV-Duells auf die individuelle Wahlentscheidung im Bundestagswahlkampf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030590