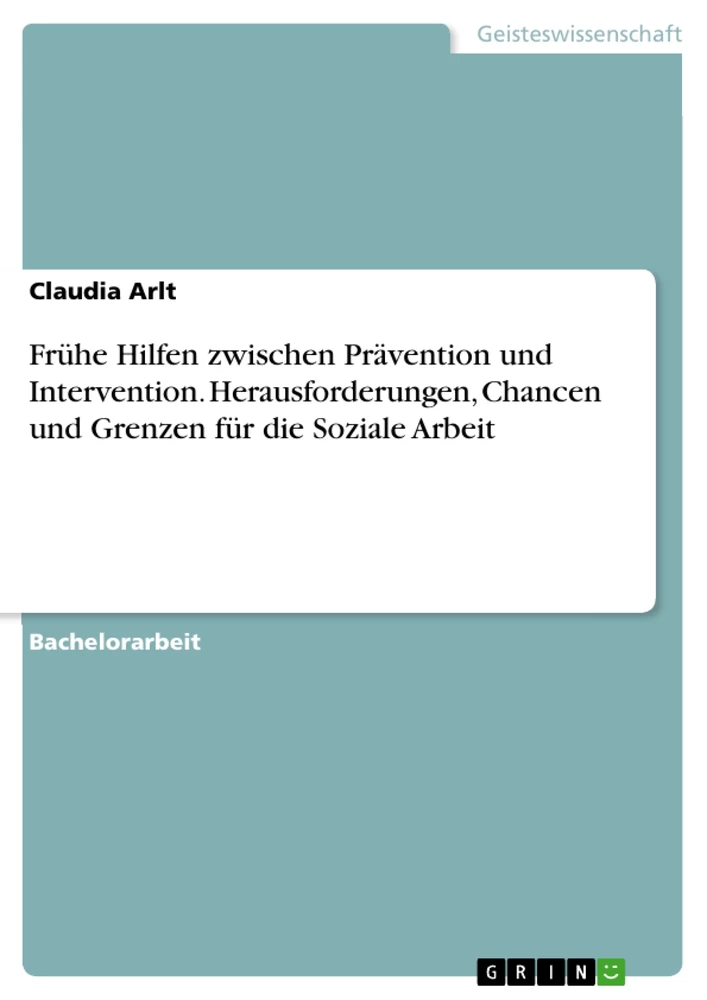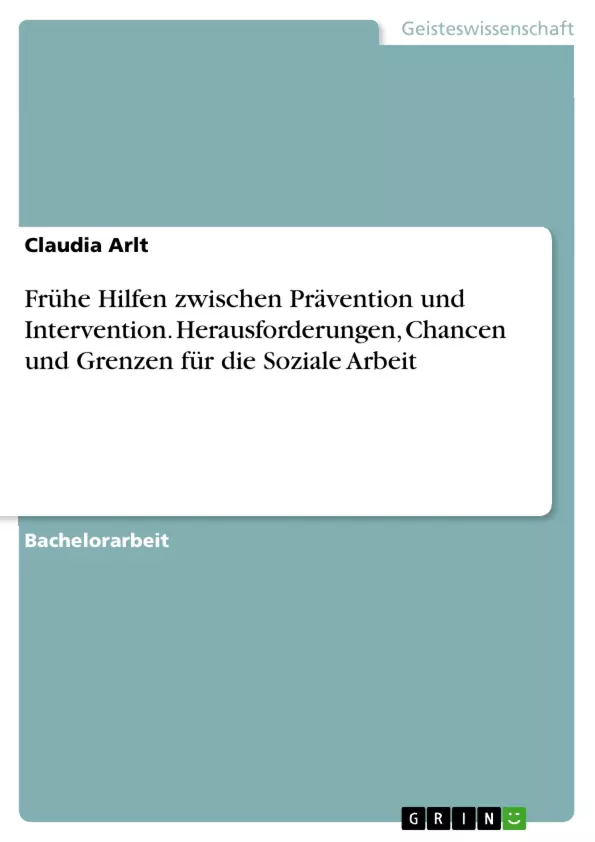Diese Bachelorthesis befasst sich mit dem Thema „Frühe Hilfen zwischen Prävention und Intervention“. Dabei widmet sie sich im Besonderen der Theorie der Lebensweltorientierung. Die Fragestellung zum Thema lautet: Wie kann ich als sozialpädagogische Fachkraft an der Schnittstelle zwischen Prävention und Intervention unter dem Aspekt der Lebensweltorientierung arbeiten und welche Herausforderungen, Chancen oder auch Grenzen ergeben sich daraus für die Soziale Arbeit?
Im ersten Teil meiner Bachelorthesis werde ich mich mit der Theorie der Lebensweltorientierung auseinandersetzen, um danach überzuleiten zur Entstehungsgeschichte der Frühen Hilfen. In diesem Kapitel werde ich darlegen, auf Grund welcher Sachlage die Frühen Hilfen entstanden sind und welche Zwischenschritte auf dem Weg zur Bundesinitiative genommen wurden.
Im dritten Kapitel werde ich mich zum einen den Definitionsbestimmungen von Frühen Hilfen und Prävention zuwenden und mich zum anderen dem Themenkomplex von Frühen Hilfen und dem Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung widmen.
Danach werde ich auf Grundlage der theoretischen Aspekte der Lebensweltorientierung und der Arbeitsweisen der Frühen Hilfen Verbindungen ziehen, um aufzuzeigen, wo und wie in den Frühen Hilfen lebensweltorientiert gearbeitet wird. Schlussendlich werde ich eine Zusammenfassung der gesammelten Erkenntnisse verfassen und meine handlungsleitende Frage für mich beantworten. Diese von mir untersuchte Frage kann dazu dienen, sich seines Arbeitsauftrages, unter Berücksichtigung einer in der Sozialen Arbeit relevanten Theorie, in den Frühen Hilfen, (noch) besser bewusst zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie und Lebensweltorientierte Soziale Arbeit
- Konzept und Menschenbild
- Theoretischer Hintergrund
- Lebenswelt als Bezugspunkt
- Die Struktur- und Handlungsmaxime
- Die Entwicklung der Frühen Hilfen in Deutschland
- Aktionsprogramm der Bundesregierung
- Kinderschutzgipfel 2007 und 2008
- Bundeskinderschutzgesetz
- Frühe Hilfen im Bundeskinderschutzgesetz
- Nationales Zentrum Frühe Hilfen
- Frühe Hilfen und Prävention
- Begriffsbestimmung „Frühe Hilfen“
- Definition, Frühe Hilfen“ des Nationalen Zentrums
- Begriffsbestimmung „Prävention“
- Das Präventionsverständnis von Frühen Hilfen und der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
- Lebensweltorientierte Soziale Arbeit in den Frühen Hilfen
- Lebensweltorientierte Soziale Arbeit in Familien
- Die Handlungsmaxime der Lebensweltorientierung bezogen auf die Arbeitsweisen der Frühen Hilfen
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle der Frühen Hilfen an der Schnittstelle von Prävention und Intervention aus der Perspektive der Lebensweltorientierung. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen der Lebensweltorientierung in Bezug auf die Praxis der Frühen Hilfen zu beleuchten und die Handlungsmöglichkeiten sozialpädagogischer Fachkräfte in diesem Kontext zu analysieren.
- Die Entwicklung der Frühen Hilfen in Deutschland
- Die Definition und Konzepte von Frühen Hilfen und Prävention
- Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung im Kontext der Frühen Hilfen
- Die Anwendung der Lebensweltorientierung in der Arbeit mit Familien
- Herausforderungen, Chancen und Grenzen der Lebensweltorientierung in den Frühen Hilfen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Motivation und den Hintergrund der Arbeit, die sich mit der Relevanz des Themas Frühe Hilfen auseinandersetzt. Das erste Kapitel widmet sich der Theorie der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit, inklusive des zugrundeliegenden Menschenbildes und der relevanten Handlungsmaxime.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Frühen Hilfen in Deutschland und stellt die wichtigsten Meilensteine, wie das Aktionsprogramm der Bundesregierung und das Bundeskinderschutzgesetz, vor.
Im dritten Kapitel werden die Begrifflichkeiten von Frühen Hilfen und Prävention definiert und die Verbindung zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung hergestellt.
Kapitel vier greift die Lebensweltorientierung auf und zeigt auf, wie diese in den Frühen Hilfen konkret angewendet werden kann.
Schlüsselwörter
Frühe Hilfen, Lebensweltorientierung, Prävention, Intervention, Sozialpädagogisches Handeln, Kindeswohlgefährdung, Familienhilfe, Handlungsmaxime, Schutzauftrag.
- Quote paper
- Claudia Arlt (Author), 2016, Frühe Hilfen zwischen Prävention und Intervention. Herausforderungen, Chancen und Grenzen für die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030662