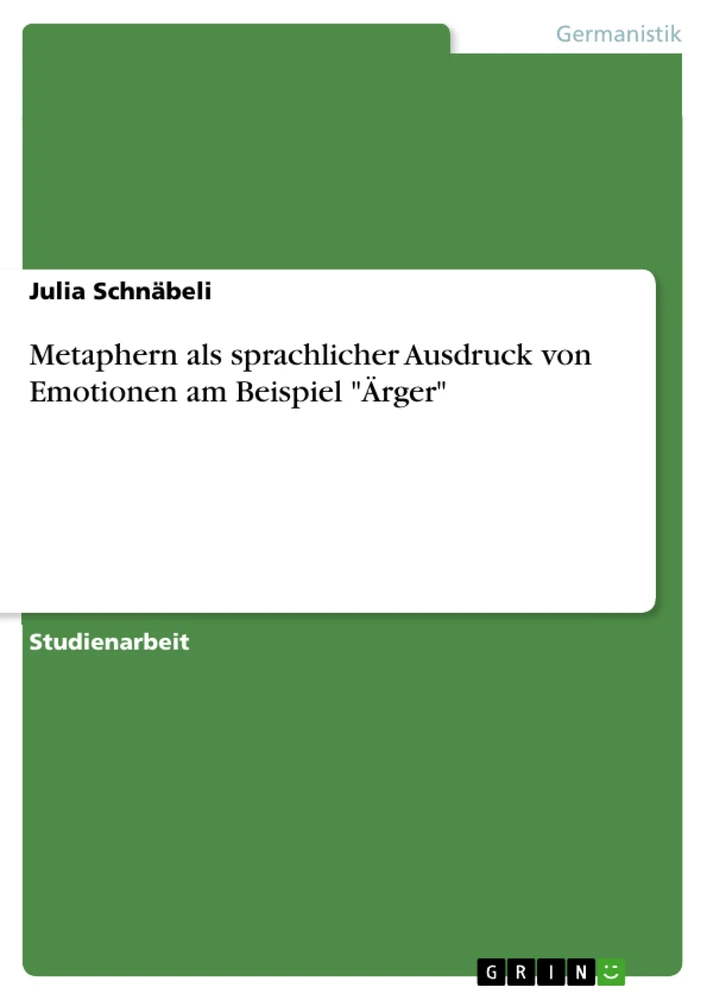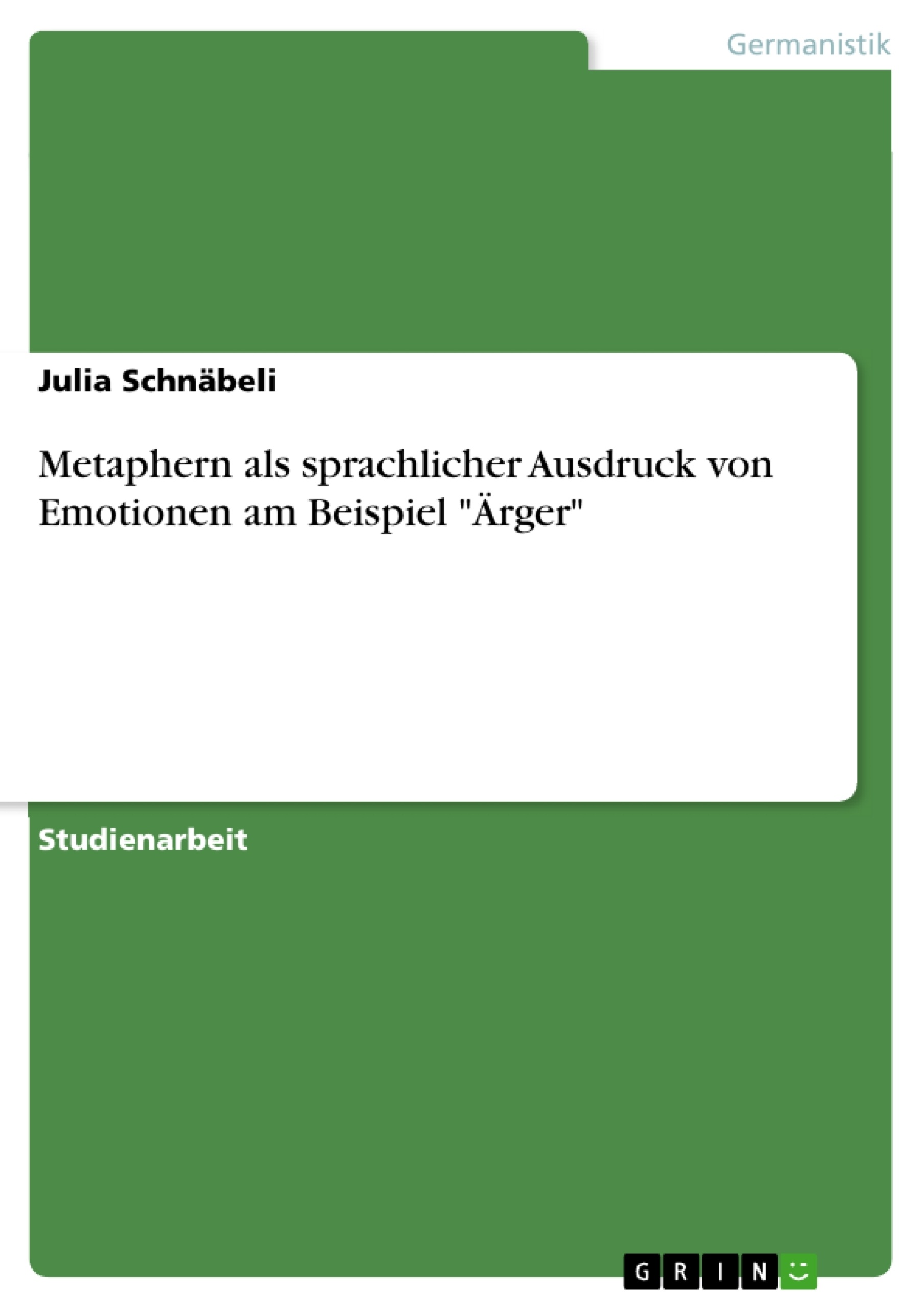Menschen sind in der Lage ihre Umwelt wahrzunehmen, diese Informationen weiterzuverarbeiten und sich mit anderen darüber auszutauschen. Dieser Austausch kann auch abstrakte Dinge betreffen wie Gefühle und dabei werden nicht einmal Worte benötigt. Ein Lächeln oder eine Träne der Trauer ist kulturunabhängig verständlich und vermittelbar, es löst beim Gegenüber sofort Assoziationen aus, doch gibt es nicht nur das eine Gefühl, welches von jedem Menschen gleich empfunden wird, da es subjektiv ist. Daher stellt sich die Frage, wie Gefühle, die ein internes, nicht greifbares Phänomen sind, versprachlicht werden. Jeder Mensch empfindet anders, trotzdem gibt es bestimmte verbale bildliche Ausdrucksvarianten wie "mir platzt der Kragen", die im Deutschen zur Kommunikation genutzt werden, ohne dass der Gegenüber je gesehen oder gehört hat, wie jemandem wirklich der Kragen geplatzt ist und trotzdem den beschriebenen Gefühlszustand einordnen kann. Dabei fällt auf, dass, wenn über Emotionen gesprochen wird, werden häufig Bilder und Assoziationen genutzt, um diese dem Gegenüber zu vermitteln.
Ziel dieser Arbeit soll sein, Strukturen und Konzepte, die zur Bildung solcher Ausdrucksformen dienen bzw. die bei der Entschlüsselung solcher Aussagen helfen, aufzuzeigen. Dazu soll nächst grundlagentheoretisch erläutert werden, was Gegenstand dieser Arbeit ist. Dabei werden zunächst die Begriffe Emotion, Gefühl, Stimmung und Affekt voneinander abgegrenzt und auf die Gruppe der Basisemotionen eingegangen, um daran anschließend die Charakteristika der Emotion Ärger aufzuzeigen. In Folge dessen wird auf die verbale Realisierungsformen von Emotionen anhand der Lexik und Satzsemantik in Form von bildlicher Sprache, insbesondere der Metaphern, Bezug genommen. Diese Schritte sind notwendig, um den darauf aufbauenden Hauptteil und das methodische Vorgehen in Bezug auf die hier skizzierte Emotion Ärger nachvollziehen zu können. Es werden Metaphern, die diese Emotion ausdrücken, den vier Klassen von Metaphern nach Baldauf zugeordnet und die zugrundeliegende Konzeptualisierungen erläutert. Abschließend werden die Merkmale Intensität und Kontrollverlust in Bezug auf Ärger beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Emotionen
- 3. Verbale Realisierungsformen
- 3.1 Emotionsbezeichnender und emotionsausdrückender Wortschatz
- 3.2 Metaphernverständnis
- 4. Die Emotion Ärger in der Metaphorik
- 4.1 Das Konzept der Intensität
- 4.2 Das Konzept des Kontrollverlusts
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachliche Darstellung von Emotionen, insbesondere von Ärger, mithilfe von Metaphern. Ziel ist es, die zugrundeliegenden Konzepte und Strukturen aufzuzeigen, die sowohl die Bildung als auch die Interpretation solcher metaphorischen Ausdrücke ermöglichen.
- Die sprachliche Realisierung von Emotionen
- Metaphern als Ausdrucksform von Emotionen
- Das Konzept von Ärger als Emotion
- Intensität und Kontrollverlust im Kontext von Ärgermetaphern
- Konzeptualisierungsprozesse und mentale Repräsentationen von Emotionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sprachlichen Darstellung von Emotionen ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Versprachlichung von Gefühlen, insbesondere der Emotion Ärger, in den Mittelpunkt und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Es wird hervorgehoben, dass metaphorische Ausdrücke häufig zur Beschreibung von Emotionen genutzt werden, obwohl diese ein internes, nicht direkt greifbares Phänomen darstellen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Strukturen und Konzepte aufzuzeigen, die der Bildung und Interpretation solcher metaphorischer Ausdrücke zugrunde liegen. Die folgenden Kapitel werden kurz vorgestellt und ihr Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage umrissen.
2. Emotionen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung von Emotionen, Gefühlen, Stimmungen und Affekten. Es wird auf die von Schwarz-Friesel (2007) vorgeschlagene Definition von Emotionen als mehrdimensionale, intern repräsentierte und subjektiv erfahrbare Syndromkategorien eingegangen. Die Abgrenzung zwischen Emotion und Gefühl wird diskutiert, wobei das Gefühl als Teilkomponente der Emotion, als subjektives Erleben, verstanden wird. Das Kapitel beleuchtet die kognitiv-linguistische Perspektive auf Emotionen und deren Verarbeitung im menschlichen Gehirn. Es werden verschiedene Perspektiven zur Klassifizierung von Emotionen präsentiert, darunter die Gruppierung nach Valenz und Erregung sowie die Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundäremotionen. Die Basisemotionen und ihre kulturübergreifende Verständlichkeit durch Mimik werden ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Emotionen, Ärger, Metaphern, sprachliche Darstellung, kognitive Linguistik, Konzeptualisierung, Intensität, Kontrollverlust, mentale Repräsentationen, verbale Realisierungsformen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachliche Darstellung von Emotionen, insbesondere Ärger, mithilfe von Metaphern
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die sprachliche Darstellung von Emotionen, insbesondere von Ärger, mithilfe von Metaphern. Das Hauptziel ist es, die zugrundeliegenden Konzepte und Strukturen aufzuzeigen, die sowohl die Bildung als auch die Interpretation metaphorischer Ausdrücke ermöglichen, die Emotionen beschreiben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über Emotionen im Allgemeinen, ein Kapitel über die verbalen Realisierungsformen von Emotionen (mit Fokus auf emotionsbezeichnenden Wortschatz und Metaphernverständnis), ein Kapitel zur Metaphorik des Ärgers (inkl. Intensität und Kontrollverlust) und ein Fazit.
Was wird im Kapitel "Emotionen" behandelt?
Dieses Kapitel definiert und grenzt Emotionen, Gefühle, Stimmungen und Affekte voneinander ab. Es beruft sich auf Schwarz-Friesel (2007) und diskutiert die kognitiv-linguistische Perspektive auf Emotionen, ihre Verarbeitung im Gehirn und verschiedene Klassifizierungsmöglichkeiten (z.B. nach Valenz und Erregung, Primär- und Sekundäremotionen). Die Basisemotionen und ihre kulturübergreifende Verständlichkeit werden ebenfalls thematisiert.
Wie werden im Kapitel zu verbalen Realisierungsformen Emotionen behandelt?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die sprachliche Darstellung von Emotionen. Es analysiert den emotionsbezeichnenden und emotionsausdrückenden Wortschatz und untersucht das Verständnis von Metaphern im Kontext emotionaler Ausdrücke.
Was ist der Fokus des Kapitels "Die Emotion Ärger in der Metaphorik"?
Dieses Kapitel untersucht die Metaphorik des Ärgers im Detail. Es analysiert die Konzepte der Intensität und des Kontrollverlusts, wie sie in metaphorischen Ausdrücken zum Ausdruck kommen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Emotionen, Ärger, Metaphern, sprachliche Darstellung, kognitive Linguistik, Konzeptualisierung, Intensität, Kontrollverlust, mentale Repräsentationen, verbale Realisierungsformen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte die sprachliche Realisierung von Emotionen, insbesondere die Verwendung von Metaphern zur Beschreibung von Ärger, untersuchen. Sie zielt darauf ab, die zugrundeliegenden Konzeptualisierungsprozesse und mentalen Repräsentationen aufzuzeigen, die der Bildung und Interpretation solcher Ausdrücke zugrunde liegen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die sprachliche Realisierung von Emotionen, die Verwendung von Metaphern als Ausdrucksform von Emotionen, das Konzept von Ärger als Emotion, die Aspekte Intensität und Kontrollverlust in Ärgermetaphern und die Konzeptualisierungsprozesse und mentalen Repräsentationen von Emotionen.
- Quote paper
- Julia Schnäbeli (Author), 2020, Metaphern als sprachlicher Ausdruck von Emotionen am Beispiel "Ärger", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030805