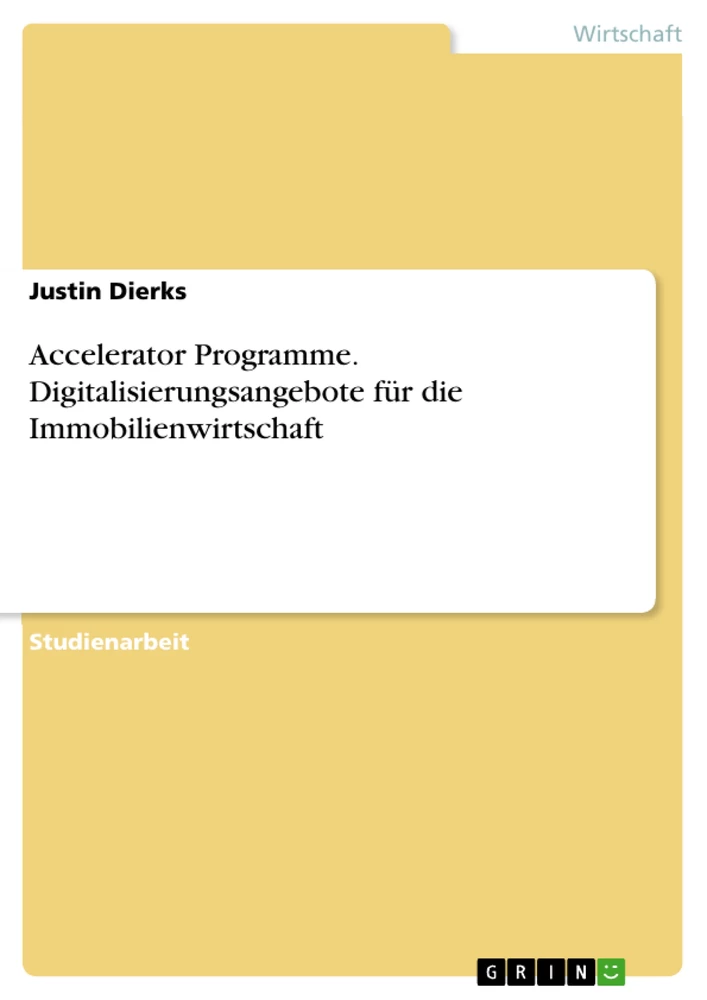Die Unterstützungsangebote für junge Unternehmen haben sich in den letzten Jahrzehnten auch in Deutschland kontinuierlich weiterentwickelt. Es hat sich eine Vielzahl an Programmen herausgebildet, welche Start-ups in unterschiedlichen Phasen der Gründung sowie während der Skalierung unterstützen. Eine besondere Position nehmen Accelerator-Programme ein. Sie erweitern das Angebot von Fördermöglichkeiten und zielen auf ein schnelles Wachstum von jungen Unternehmen ab. Die Motivation zum Aufbau entsprechender Accelerator-Programme ist unterschiedlich und hängt stark von der Trägerkonstellation ab. Während börsennotierte Konzerne in Acceleratoren eine gute Möglichkeit sehen, um neue Produkte oder Dienstleistungen im Markt zu etablieren respektive interne Innovationsprozesse voranzutreiben, verfolgen öffentlich finanzierte Acceleratoren in der Regel regionale Entwicklungsansätze.
Insbesondere auch in der deutschen Immobilienwirtschaft ist eine extrem hohe Dynamik hinsichtlich dieser Thematik zu beobachten. So öffnet sich die Branche gegenüber der Digitalisierung von Informationen, Prozessen und Immobilien euphorisch. PropTech-Unternehmen erwarten sich davon, Prozesse effizienter gestalten und auf Basis des vielfältigen Datenangebots effektivere Produkte entwickeln zu können. Durch das innovative Image von PropTech-Unternehmen ist das Thema stetig in den Medien präsent und gewinnt vor allem in Zeiten der digitalen Transformation zunehmend an Bedeutung.
Das primäre Ziel der Arbeit ist es, zu klären, welchen Nutzen Accelerator-Programme für PropTech-Unternehmen in der Immobilienbranche haben. Des Weiteren soll untersucht werden, welche Anbieter von Accelerator-Programmen es auf dem deutschen Immobilienmarkt gibt und wie deren Angebot aussieht. Die wissenschaftliche Arbeit wird hierzu eine Auswahl an vier Acceleratoren aufzeigen. Überdies wird ein Einblick in die theoretischen Grundlagen der Thematik gegeben.
Diese Arbeit stellt keinen Anspruch auf universelle Vollständigkeit oder Gültigkeit. Sie soll lediglich einen praxisnahen Einblick in die Thematik „Accelerator-Programme“ und den damit verbundenen Nutzen für PropTech-Unternehmen bieten. Für die Erarbeitung und Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine tiefgreifende Analyse der Literatur vorgenommen. Es wurden sowohl Internetquellen als auch klassische Buchquellen verwendet. Diese sollen sowohl die Aktualität, als auch die empirische Gültigkeit der erarbeiteten Thematik hervorheben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz des Themas
- Zielsetzung der Arbeit
- Aufbau
- Theoretischer Hintergrund
- Accelerator
- Begriffsdefinition und -abgrenzung
- Accelerator-Programme
- Property Technology
- Digitalisierungsangebote für die Immobilienwirtschaft
- Anbieter und Angebote von Accelerator-Programmen
- Blackprint Booster
- Hubitation
- Accelerator Frankfurt
- Creators
- Nutzen
- Schlussbetrachtung
- Limitationen der Arbeit
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, den Nutzen von Accelerator-Programmen für PropTech-Unternehmen in der Immobilienbranche zu beleuchten. Es werden zudem Anbieter und Angebote von Accelerator-Programmen auf dem deutschen Immobilienmarkt analysiert. Die Arbeit konzentriert sich auf vier ausgewählte Acceleratoren und bietet einen Einblick in die theoretischen Grundlagen der Thematik.
- Der Nutzen von Accelerator-Programmen für PropTech-Unternehmen.
- Die verschiedenen Anbieter von Accelerator-Programmen im deutschen Immobilienmarkt.
- Die Angebote und Besonderheiten der ausgewählten Accelerator-Programme.
- Theoretische Grundlagen der Accelerator-Programme und PropTech-Unternehmen.
- Die Entwicklung von PropTech-Unternehmen in Deutschland.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Accelerator-Programme für PropTech-Unternehmen" dar, definiert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Aufbau. Der erste Schwerpunkt befasst sich mit den theoretischen Grundlagen. Hier werden Accelerator-Programme und Property Technology (PropTech) umfassend definiert und abgegrenzt. Der zweite Schwerpunkt analysiert die Relevanz von Digitalisierungsangeboten für die Immobilienwirtschaft und stellt ausgewählte Accelerator-Programme vor, wobei der Fokus auf deren Nutzen für PropTech-Unternehmen liegt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Accelerator-Programme, PropTech, Digitalisierung, Immobilienwirtschaft, Start-ups, Geschäftsmodelle, Innovation und Wachstum. Im Fokus stehen die Analyse des Nutzens von Accelerator-Programmen für PropTech-Unternehmen sowie die Vorstellung von ausgewählten Anbietern und deren Angebote auf dem deutschen Immobilienmarkt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Accelerator-Programm?
Ein Programm, das Start-ups in kurzer Zeit durch Mentoring, Netzwerk und oft Kapital zu schnellem Wachstum (Skalierung) verhelfen soll.
Was bedeutet PropTech?
PropTech steht für "Property Technology" und bezeichnet innovative technologische Lösungen und digitale Geschäftsmodelle für die Immobilienwirtschaft.
Welchen Nutzen haben Acceleratoren für PropTechs?
Sie bieten Zugang zu Branchenexperten, potenziellen Kunden (Immobilienkonzernen) und helfen bei der Professionalisierung interner Prozesse.
Welche Anbieter gibt es auf dem deutschen Markt?
Die Arbeit nennt beispielhaft Blackprint Booster, Hubitation, Accelerator Frankfurt und Creators.
Warum bauen Konzerne eigene Acceleratoren auf?
Um interne Innovationsprozesse voranzutreiben, neue digitale Produkte frühzeitig zu entdecken und sich als modernes Unternehmen zu positionieren.
- Quote paper
- Justin Dierks (Author), 2021, Accelerator Programme. Digitalisierungsangebote für die Immobilienwirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030992