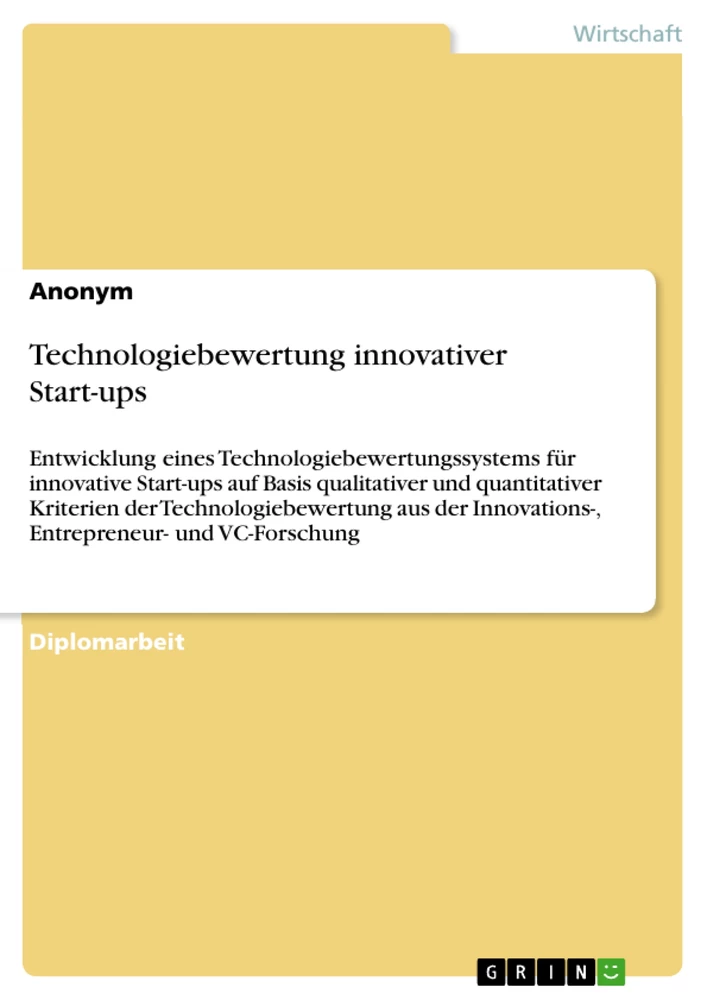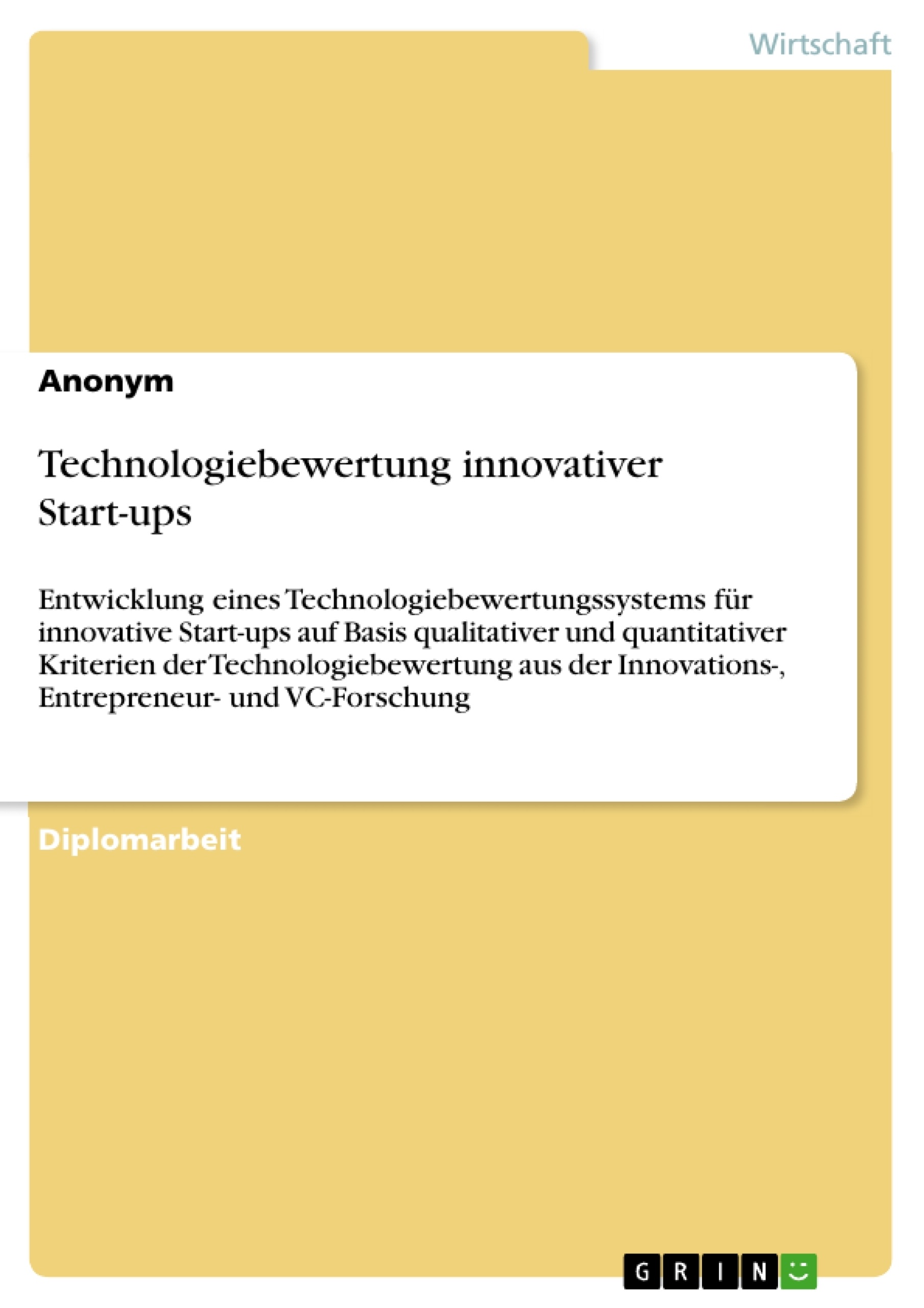Wie können Technologien innovativer Start-ups bewertet werden? Das Ziel der Arbeit ist es, eine systematische und praxistaugliche Methode zur Bewertung von Technologien innovativer Start-ups aus der Perspektive eines VC-Gebers zu erarbeiten. Zur Erreichung der Zielsetzung wurden verschiedene Studien über die Investitionskriterien innovativer Start-ups sowie deren Einfluss auf den zukünftigen Erfolg der Beteiligungsunternehmen analysiert. Die aus der Literatur identifizierten 18 Erfolgsfaktoren konnten in die Dimensionen Technologieattraktivität und Ressourcenstärke unterteilt werden und anhand der Scoring-Methode quantitativ bewertet und in einem Technologie-Portfolio integriert werden. Anschließend wurde das konzipierte Technologiebewertungssystem anhand von neun Experten aus der VC-Branche validiert. Ergebnis der Arbeit ist somit ein validiertes Modell zur Bewertung von Technologien innovativer Start-ups.
In der Literatur und Praxis besteht Einigkeit darüber, dass Technologien als wesentliche Innovations- und Wettbewerbstreiber sowie als Überlebensdeterminanten von Unternehmen betrachtet werden können. Haupttreiber dieser innovativen Technologien stellen Start-ups dar. Bedingt durch hohe Investitionen und erst zeitlich versetzten Einzahlungen benötigen vor allem Start-ups in der Seed- und Wachstumsphase Kapital von Investoren. Da der Wert dieser innovativen Start-ups sich allerdings zumeist ausschließlich in den Wachstumsmöglichkeiten dieser innovativen Technologie widerspiegelt und konventionelle Bewertungstechniken für Start-up Technologien aufgrund des innovativen Charakters der Technologien nicht verwendet werden können, stehen Unternehmensgründer sowie die VC-Finanziers vor der Herausforderung das Potential der Technologie zu evaluieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung in die Thematik
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Terminologie und Begriffsabgrenzung
- 2.1.1 Innovation
- 2.1.2 Technologie
- 2.1.3 Besonderheiten innovativer Start-ups
- 2.1.4 Venture Capital
- 2.1.4.1 Der idealtypische Verlauf einer Venture Capital Finanzierung
- 2.1.4.2 Venture Capital-Prozess
- 2.2 Strategische Analyseansätze
- 2.2.1 Portfolio-Methode als strategisches Instrument der Ressourcenallokation
- 2.2.2 Geschäftsmodell-Entwicklung nach dem Ansatz von Osterwalder und Pigneur
- 2.2.3 Das Fünf-Kräfte Modell nach Porter
- 3 Technologiebewertungsmodell
- 3.1 Überblick ausgewählter Technologie-Portfolio Ansätze
- 3.1.1 Grundlagen und historische Entwicklung von Technologie-Portfolios
- 3.1.2 Varianten zur Verbesserung der Portfolio-Analyse
- 3.1.3 Das Beschreibungsraster für die bestehenden Technologie-Portfolio-Ansätze
- 3.1.4 Technologie-Portfolio (Pfeiffer et al., 1982)
- 3.1.5 Technologie-Portfolio (McKinsey, 1982)
- 3.1.6 Technologie-Portfolio (Booz, Allen & Hamilton, 1983)
- 3.1.7 Technologie-Portfolio (Arthur D. Little, 1985)
- 3.1.8 Vergleichende Zusammenfassung der Ansätze
- 3.2 Stand der Forschung
- 3.2.1 Bewertungsprobleme innovativer Start-ups
- 3.2.2 Literaturanalyse zu Studien über qualitative Bewertungsfaktoren für die Beteiligungsentscheidung von VCG
- 3.2.2.1 Management
- 3.2.2.1.1 Vollständigkeit der erforderlichen Kompetenzen
- 3.2.2.1.2 Erfolgsbilanz/ Erfahrungen
- 3.2.2.1.3 Motivation und Incentivierung
- 3.2.2.1.4 Organisationsstruktur
- 3.2.2.1.5 Emotionale Intelligenz/ Sozialkompetenz
- 3.2.2.1.6 Besetzung des Aufsichtsrats/ wissenschaftlichen Beirats
- 3.2.2.2 Markt
- 3.2.2.2.1 Bedrohung durch neue Anbieter
- 3.2.2.2.2 Rivalität innerhalb der Branche
- 3.2.2.2.3 Bedrohung durch Ersatzprodukte
- 3.2.2.2.4 Verhandlungsmacht von Kunden
- 3.2.2.2.5 Verhandlungsmacht der Lieferanten
- 3.2.2.2.6 Marktpotential
- 3.2.2.2.7 Kunden
- 3.2.2.2.8 Politisch-rechtliches Umfeld
- 3.2.2.2.9 Kosten & Umsatzkalkulation
- 3.2.2.2.10 Marktakzeptanz
- 3.2.2.3 Produkt/ Technologie
- 3.2.2.3.1 Patentschutz o.Ä.
- 3.2.2.3.2 Unique Selling Proposition
- 3.2.2.3.3 Strategische Kooperationen & Allianzen
- 3.2.2.3.4 Innovationsmanagement
- 3.2.2.3.5 Produkteinführungszeit
- 3.2.2.3.6 Funktionierender Prototyp
- 3.2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 4 Entwicklung eines Technologiebewertungssystems für innovative Start-ups
- 4.1 Konzeption des Bewertungsmodells
- 4.1.1 Konzeptionelle und inhaltliche Anforderungen an das Bewertungsmodell
- 4.1.2 Ableitung relevanter Bestandteile eines Technologiebewertungssystems anhand des Technologie-Portfolios von Pfeiffer et al. (1982)
- 4.1.3 Ableitung relevanter Kriterien eines Technologiebewertungssystems anhand der Entscheidungskriterien von VCG
- 4.1.3.1 Markt
- 4.1.3.1.1 Marktpotential
- 4.1.3.1.2 Marktakzeptanz
- 4.1.3.1.3 Bedrohung durch neue Anbieter
- 4.1.3.1.4 Brancheninterne Rivalität
- 4.1.3.1.5 Bedrohung durch neue Ersatzprodukte
- 4.1.3.1.6 Verhandlungsmacht von Kunden
- 4.1.3.1.7 Verhandlungsmacht von Lieferanten
- 4.1.3.1.8 Strategische Kategorie der Technologie
- 4.1.3.2 Staat
- 4.1.3.2.1 Politisch-rechtliches Umfeld
- 4.1.3.3 Technologie
- 4.1.3.3.1 Schutzmöglichkeiten
- 4.1.3.4 Unique Selling Proposition
- 4.1.3.5 Strategische Kooperationen & Allianzen
- 4.1.3.6 Time-To-Market
- 4.1.3.6.1 Funktionierender Prototyp
- 4.1.3.7 Management
- 4.1.3.7.1 Vollständigkeit der erforderlichen Kompetenzen
- 4.1.3.7.2 Track Record/ Branchenerfahrung
- 4.1.3.7.3 Führungsqualität/ Emotionale Intelligenz
- 4.1.3.8 Commitment
- 4.1.4 Bewertungsmethodik
- 4.1.4.1 Das Scoring-Modell als Bewertungsverfahren
- 4.1.4.2 Bewertung von Technologien innovativer Start-ups
- 4.1.4.3 Auswertung des Technologie-Portfolios
- 4.2 Excel-Tool für eine rechnergestützte Anwendung
- 4.3 Darstellung des validierten Technologiebewertungssystems
- 5 Fazit und Ausblick
- Bewertung von Technologien innovativer Start-ups
- Identifizierung relevanter Bewertungskriterien aus der Innovations-, Entrepreneur- und VC-Forschung
- Entwicklung eines Technologiebewertungssystems auf Basis eines ausgewählten Technologie-Portfolios
- Operationalisierung der Bewertungskriterien durch die Scoring-Methode
- Validierung des Technologiebewertungssystems durch Experteninterviews
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der systematischen Bewertung von Technologien innovativer Start-ups aus der Perspektive eines Venture Capital-Gebers. Ziel ist es, ein praxistaugliches Bewertungsmodell zu entwickeln, welches die relevanten qualitativen und quantitativen Kriterien der Technologiebewertung aus der Innovations-, Entrepreneur- und VC-Forschung integriert.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik, die die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Anschließend werden in Kapitel zwei die theoretischen Grundlagen geschaffen, indem wichtige Begriffe wie Innovation, Technologie, Venture Capital und strategische Analyseansätze definiert und abgegrenzt werden. Kapitel drei beleuchtet verschiedene Technologie-Portfolio Ansätze und analysiert deren Stärken und Schwächen. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus den vorangegangenen Kapiteln wird in Kapitel vier ein Technologiebewertungssystem für innovative Start-ups entwickelt. Dabei werden die aus der Literatur identifizierten Bewertungskriterien in einem Strukturbaum systematisiert, operationalisiert und mit Hilfe der Scoring-Methode quantitativ bewertet. Das entwickelte Technologiebewertungssystem wird in einem Excel-Tool für eine rechnergestützte Anwendung umgesetzt und im Anschluss durch Experteninterviews aus der VC-Branche validiert. Kapitel fünf fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsbedarfe.
Schlüsselwörter
Technologiebewertung, innovative Start-ups, Venture Capital, Technologie-Portfolio, Scoring-Methode, Innovationsforschung, Entrepreneur-Forschung, VC-Forschung, Erfolgsfaktoren, Bewertungskriterien, Technologieattraktivität, Ressourcenstärke, Marktanalyse, Managementqualität, Schutzmöglichkeiten, Unique Selling Proposition.
Häufig gestellte Fragen
Wie können Technologien von innovativen Start-ups systematisch bewertet werden?
Die Bewertung erfolgt durch ein Modell, das 18 Erfolgsfaktoren in die Dimensionen Technologieattraktivität und Ressourcenstärke unterteilt und diese mittels einer Scoring-Methode quantifiziert.
Warum versagen konventionelle Bewertungstechniken bei Start-ups?
Da der Wert junger Unternehmen oft ausschließlich in den Wachstumsmöglichkeiten ihrer innovativen Technologien liegt und historische Finanzdaten fehlen, sind klassische Verfahren unzureichend.
Welche Rolle spielt die Perspektive des Venture Capital-Gebers?
VC-Geber benötigen praxistaugliche Methoden, um das technologische Potenzial vor einer Investition (z. B. in der Seed-Phase) objektiv einschätzen zu können.
Was sind die zentralen Dimensionen des Technologie-Portfolios?
Das Modell nutzt die Technologieattraktivität (Marktpotenzial, Schutzrechte) und die Ressourcenstärke (Managementqualität, technisches Know-how), um Start-ups zu positionieren.
Wie wurde das entwickelte Bewertungssystem validiert?
Das System wurde durch Interviews mit neun Experten aus der Venture-Capital-Branche auf seine Praxistauglichkeit geprüft und validiert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Technologiebewertung innovativer Start-ups, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1031362