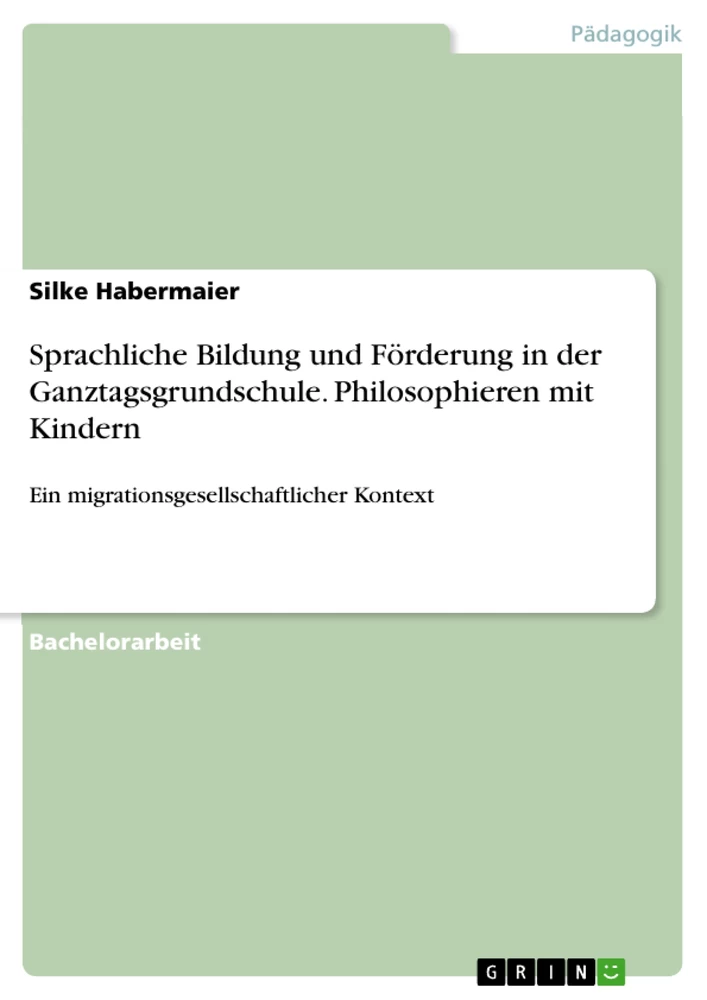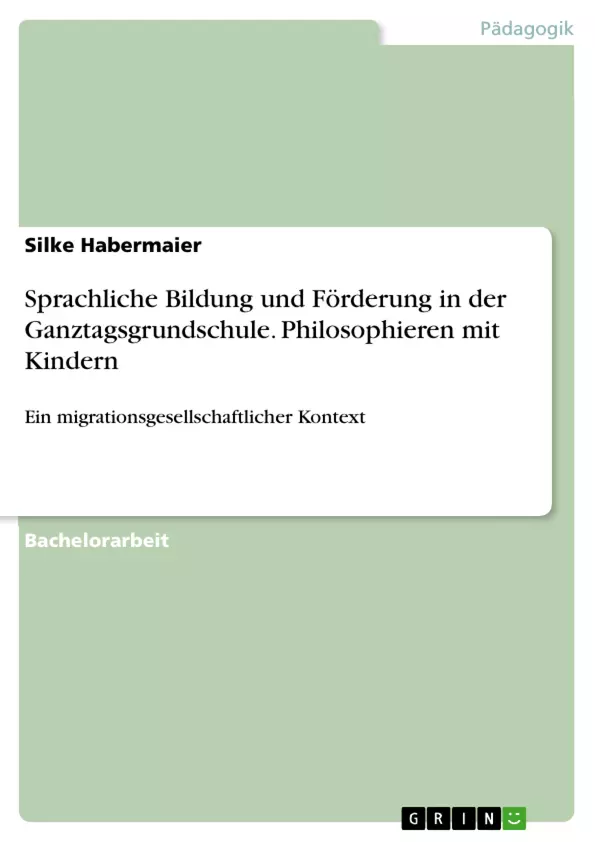Die Arbeit unternimmt den Versuch, Philosophieren mit Kindern als eine aussichtsvolle Methode der sprachlichen Bildung und Förderung im Setting der Ganztagsgrundschule zu begreifen. Im Zuge bildungspolitischer Diskurse stellt das derzeit im Fokus stehende Schulmodell nicht nur einen Bildungs- und Lernort für Schüler*innen dar, sondern versteht sich vor allem auch als ein Lebensort, der zahlreiche Dimensionen kindlicher Lebenswelten abbildet.
Da laut Statistiken von 2017 der Anteil der Kinder zwischen drei und sechs Jahren mit einem Migrationshintergrund in Deutschland bei 38 Prozent liegt, sind methodische Sprachbildungskonzepte in Einrichtungen wie der Ganztagsgrundschule angezeigt. Vor dem Hintergrund sprachlicher und kultureller Diversität an Grundschulen verdient das Philosophieren mit Kindern als eine Interaktionsform, die sprachliche Bildung als primärpräventive Aufgabe von Bildungseinrichtungen zu Gunsten von Chancengleichheit zu fördern vermag, besondere Beachtung.
Welche Wirkungen, Synergien und Chancen sie bereithält, soll in dieser Arbeit anhand einer Projektbetrachtung und Auswertung an einer Modellschule herausgestellt werden. Der Frage, wie sich das Format in den rhythmisierten Ganztag sinnvoll einbetten lässt und welche Bedeutung ihm im gesamten formalen wie auch non-formalen Spektrum des Schulalltags zukommt, soll ebenso nachgegangen werden wie der Fragestellung, ob über die sprachliche Bildung hinaus durch Philosophieren mit Kindern am Ort Ganztagsgrundschule auch Sprachförderung im Sinne einer Sekundärprävention möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Migrationsgesellschaftliche Entwicklung in Baden-Württemberg
- Ganztagsgrundschule als migrationsgesellschaftliches Mikrosystem
- Eine Hinführung
- Modell einer Karlsruher Ganztagsgrundschule
- Bedeutung der Sprache
- Philosophieren als Methode
- Philosophieren mit Kindern als Interaktionsform
- Begriffsklärung Philosophieren mit Kindern
- 5-Finger-Methode nach Martens
- Prinzip sustained shared thinking
- Aspekte der Sprachbildung/-förderung beim Philosophieren mit Kindern
- Vorstellung des Projektes "Kinder philosophieren - kleine und große Fragen an die Welt" im Rahmen des AG-Angebots an der Grundschule am Wasserturm
- Ausgangssituation und Setting
- Zielsetzung und Fragestellung
- Vorbereitungsphase
- Durchführung und Verlauf
- Abschluss: Exkursion - Dokumentation und Auswertung
- Untersuchung
- Design
- Analyse
- Qualitative Interpretation
- Auswertung des Projektes
- Chancen und Potentiale von PmK im Setting Ganztagsgrundschule - ein Fazit
- Aspekt des rhythmisierten Ganztags
- Aspekt des migrationsgesellschaftlichen Kontextes
- Aspekt der Sprache
- Interdisziplinäre Verknüpfung und Anschlussfähigkeit
- Soziale und gesellschaftliche Dimension
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, Philosophieren mit Kindern als Methode der sprachlichen Bildung und Förderung im Kontext der Ganztagsgrundschule zu untersuchen. Sie beleuchtet den Einfluss von Philosophieren mit Kindern auf die sprachliche Entwicklung von Kindern im migrationsgesellschaftlichen Kontext und analysiert die Möglichkeiten, diese Methode in den rhythmisierten Ganztagsunterricht einzubinden.
- Migrationsgesellschaftliche Entwicklung in Baden-Württemberg und deren Einfluss auf die Ganztagsgrundschule
- Philosophieren mit Kindern als Interaktionsform und seine Bedeutung für sprachliche Bildung und Förderung
- Die Rolle von Sprache im migrationsgesellschaftlichen Kontext und in der Ganztagsgrundschule
- Das Projekt "Kinder philosophieren - kleine und große Fragen an die Welt" als Beispiel für die Anwendung von Philosophieren mit Kindern in der Praxis
- Chancen und Potentiale von Philosophieren mit Kindern im Setting der Ganztagsgrundschule
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz von Philosophieren mit Kindern als Methode der sprachlichen Bildung und Förderung im Kontext der Ganztagsgrundschule heraus. Sie führt in die Thematik der migrationsgesellschaftlichen Entwicklung in Baden-Württemberg ein und beleuchtet die Bedeutung von Sprache in diesem Kontext.
- Migrationsgesellschaftliche Entwicklung in Baden-Württemberg: Dieses Kapitel analysiert die demografische Entwicklung in Baden-Württemberg im Hinblick auf Migration und die Bedeutung von Sprache in migrationsgesellschaftlichen Kontexten. Es untersucht, wie die Ganztagsgrundschule als ein migrationsgesellschaftliches Mikrosystem agiert.
- Philosophieren mit Kindern als Interaktionsform: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Einführung in die Methode des Philosophierens mit Kindern. Es beleuchtet verschiedene Ansätze und Methoden sowie deren Bedeutung für die Sprachbildung und Sprachförderung.
- Vorstellung des Projektes "Kinder philosophieren - kleine und große Fragen an die Welt": Dieses Kapitel stellt das Projekt, das im Rahmen des AG-Angebots an einer Karlsruher Ganztagsgrundschule durchgeführt wurde, vor. Es beschreibt die Planung, Durchführung und Auswertung des Projekts, wobei der Fokus auf der sprachlichen und sozialen Entwicklung der teilnehmenden Kinder liegt.
- Untersuchung: Dieses Kapitel präsentiert die qualitative Inhaltsanalyse des Projekts und interpretiert die Ergebnisse hinsichtlich der sprachlichen und sozialen Entwicklung der Kinder. Es analysiert die Auswirkungen von Philosophieren mit Kindern auf die Lern- und Entwicklungsprozesse im Rahmen des Projekts.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Philosophieren mit Kindern, Sprachbildung, Sprachförderung, Ganztagsgrundschule, migrationsgesellschaftlicher Kontext, Interaktion, Kommunikation, Chancengleichheit, Selbstwirksamkeit, inklusive Bildung und Pädagogik der Kindheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie fördert Philosophieren mit Kindern die Sprachentwicklung?
Durch das gemeinsame Nachdenken über komplexe Fragen werden Kinder angeregt, ihre Gedanken präzise zu formulieren, anderen zuzuhören und Argumente auszutauschen. Dies stärkt die Kommunikationsfähigkeit und den Wortschatz in einem geschützten Rahmen.
Warum eignet sich die Ganztagsgrundschule besonders für dieses Format?
Die Ganztagsgrundschule bietet durch ihren rhythmisierten Schulalltag Raum für non-formale Bildungsangebote. Philosophieren kann hier als Brücke zwischen Unterricht und Freizeitgestaltung fungieren und soziale Kompetenzen fördern.
Was ist die "5-Finger-Methode" nach Martens?
Es ist ein methodischer Ansatz im Philosophieren mit Kindern, der verschiedene Denkwege symbolisiert (z. B. Phänomenologie, Hermeneutik, Analytik, Dialektik und Spekulation), um ein Thema umfassend zu beleuchten.
Welche Rolle spielt der Migrationshintergrund bei der Sprachförderung durch Philosophieren?
In einer heterogenen Schülerschaft ermöglicht das Philosophieren eine wertschätzende Interaktion auf Augenhöhe. Es bietet Kindern mit Migrationshintergrund die Chance, sich aktiv am Diskurs zu beteiligen und Sprachbarrieren spielerisch abzubauen.
Was versteht man unter "Sustained Shared Thinking"?
Dies bezeichnet einen Prozess, bei dem zwei oder mehr Personen gemeinsam an der Lösung eines Problems arbeiten oder ein Konzept vertiefen. Im pädagogischen Kontext des Philosophierens führt dies zu tiefergehenden Lernprozessen.
- Arbeit zitieren
- Silke Habermaier (Autor:in), 2019, Sprachliche Bildung und Förderung in der Ganztagsgrundschule. Philosophieren mit Kindern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1031381