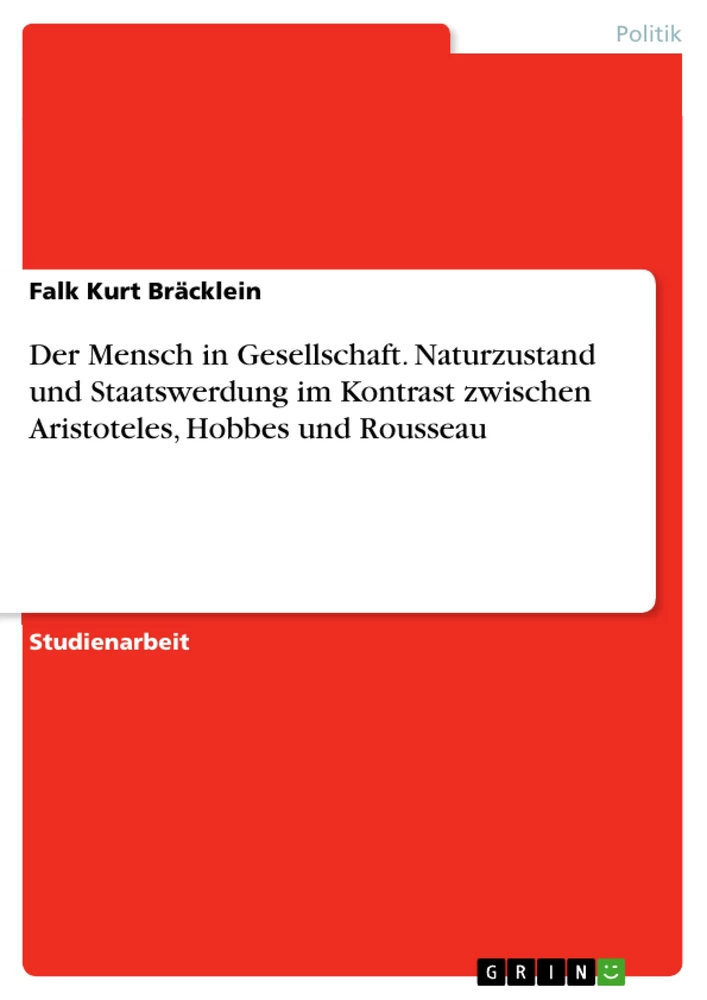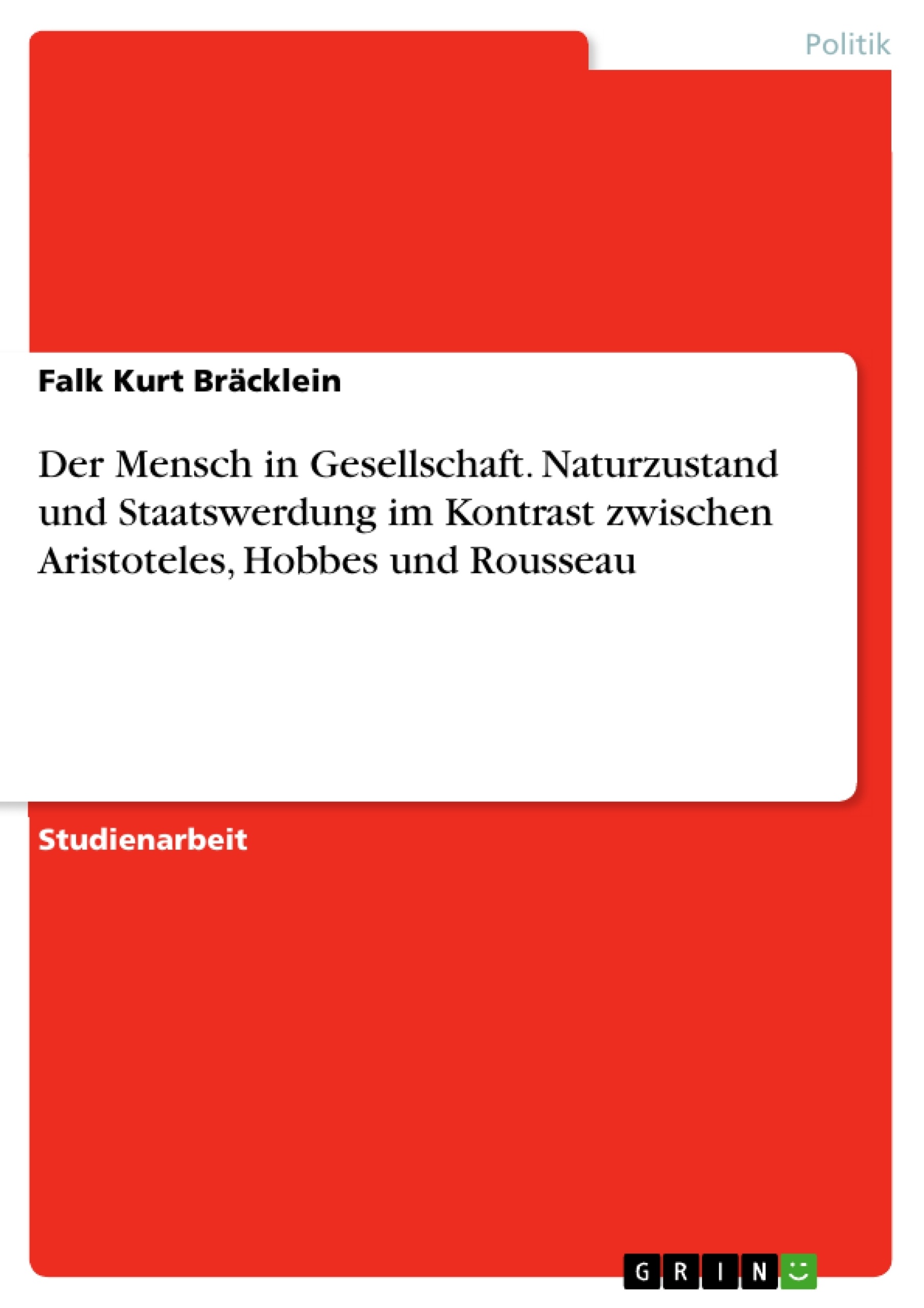Was ist das Wesen und die Natur des Menschen? Welches Gesellschaftsmodell und Herrschaftssystem sind dem Erreichen gemeinsamer Ziele am ehesten zuträglich?
Im Rahmen dieser Arbeit soll der Versuch unternommen werden, durch die Beschäftigung mit Werken der politischen Philosophen Aristoteles, Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau, deren Standpunkte in Bezug auf diese Fragen herauszuarbeiten und darzustellen.
Zu diesem Zweck wurden von Aristoteles die Standardwerke „Nikomachische Ethik“ sowie „Politik“ ausgewählt. Von Thomas Hobbes werden die Werke “Leviathan“ und „Vom Bürger“ herangezogen. Von Jean-Jacques Rousseau dient das Werk „Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts“ als Referenz.
Um die gebotene Kürze der Arbeit einhalten zu können, beschränkt sie sich in der Hauptsache darauf, die Positionen Rousseaus ausführlich darzulegen und an gegebener Stelle mit jenen von Aristoteles und Hobbes zu vergleichen. Zur ideengeschichtlichen Wirkung des Werkes von Rousseau werden zudem entsprechende Stellen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mensch in Gesellschaft
- Naturzustand und Menschenbild im Kontrast zwischen Aristoteles, Hobbes und Rousseau
- Staatswerdung im Kontrast zwischen Aristoteles, Hobbes und Rousseau
- Der Gesellschaftsvertrag
- Staatsziel und Widerstandsrecht
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Konzepte des Naturzustands und der Staatswerdung bei Aristoteles, Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau. Ziel ist es, die unterschiedlichen Standpunkte dieser drei Philosophen in Bezug auf die Natur des Menschen, die Entstehung von Gesellschaften und die Rechtfertigung von Herrschaft herauszuarbeiten und zu vergleichen.
- Das Menschenbild und der Naturzustand
- Der Gesellschaftsvertrag als Basis der Staatswerdung
- Die Rolle von Macht und Herrschaft in der Gesellschaft
- Die Bedeutung von Freiheit und Gleichheit in der politischen Theorie
- Die Frage nach dem Recht auf Widerstand gegen den Staat
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Frage der Arbeit vor: Wie erklärt man die Existenz von Gesellschaften aus der Sicht der politischen Philosophie? Der Autor erläutert, dass die Arbeit sich mit den Ansichten von Aristoteles, Hobbes und Rousseau zu diesem Thema auseinandersetzen wird. Er stellt die ausgewählten Werke der drei Denker vor und erläutert den Ansatz der Arbeit, die Positionen Rousseaus im Detail darzustellen und diese dann mit denen von Aristoteles und Hobbes zu vergleichen.
Der Mensch in Gesellschaft
Naturzustand und Menschenbild im Kontrast zwischen Aristoteles, Hobbes und Rousseau
Dieses Kapitel vergleicht die unterschiedlichen Auffassungen von Aristoteles, Hobbes und Rousseau zum Naturzustand und zum Menschenbild. Rousseau beginnt mit seinem bekannten Zitat „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten“, das als Ausgangspunkt für seine staatstheoretischen Überlegungen dient. Er beschreibt den Menschen im Naturzustand als autarken, selbstgenügsamen Einzelgänger, der von Natur aus gut und gütig sei und nicht nach Besitz und Herrschaft strebe. Im Gegensatz dazu argumentiert Aristoteles, dass es von Natur aus Herrschende und Beherrschte gibt und sich sowohl die Hausgemeinschaft als auch die Gesellschaft nach diesem Prinzip konstituieren. Hobbes hingegen sieht den Naturzustand als „Krieg aller gegen alle“, in dem der Mensch egoistisch und von der Angst vor dem Tod getrieben ist.
Staatswerdung im Kontrast zwischen Aristoteles, Hobbes und Rousseau
Der zweite Teil des Kapitels beschäftigt sich mit der Entstehung des Staates bei den drei Philosophen. Rousseau argumentiert, dass der Staat aus dem Gesellschaftsvertrag hervorgeht, in dem die Individuen ihre Freiheit zugunsten des Gemeinwohls aufgeben. Aristoteles sieht den Staat als natürliche Einheit, die der Mensch als „staatsbezogenes Lebewesen“ benötigt, um sein volles Potenzial zu entfalten. Hobbes hingegen sieht den Staat als Ergebnis einer rationalen Abmachung, in der die Individuen auf ihre Freiheit verzichten, um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der politischen Philosophie, wie Naturzustand, Gesellschaftsvertrag, Staatswerdung, Herrschaft, Freiheit, Gleichheit und Recht auf Widerstand. Sie analysiert die unterschiedlichen Ansätze von Aristoteles, Hobbes und Rousseau zu diesen Begriffen und setzt diese in einen historischen Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich die Menschenbilder von Hobbes und Rousseau?
Während Hobbes den Menschen im Naturzustand als egoistisch und gewalttätig sieht ("Krieg aller gegen alle"), betrachtet Rousseau ihn als von Natur aus gut und autark.
Was versteht Aristoteles unter dem "Zoon Politikon"?
Aristoteles definiert den Menschen als ein "staatsbezogenes Lebewesen", das erst in der Gemeinschaft und im Staat seine volle Bestimmung und Glückseligkeit finden kann.
Was ist der Zweck des Gesellschaftsvertrags bei Rousseau?
Der Vertrag dient dazu, die individuelle Freiheit in eine bürgerliche Freiheit zu überführen, die dem Gemeinwohl (Volonté Générale) untergeordnet ist.
Gibt es bei diesen Philosophen ein Widerstandsrecht?
Rousseau und die spätere amerikanische Unabhängigkeitserklärung bejahen das Recht, eine Regierung zu stürzen, wenn sie die natürlichen Rechte der Menschen verletzt.
Welche Werke werden in dieser Analyse herangezogen?
Herangezogen werden u. a. Aristoteles' "Politik", Hobbes' "Leviathan" und Rousseaus "Vom Gesellschaftsvertrag".
- Citation du texte
- Falk Kurt Bräcklein (Auteur), 2017, Der Mensch in Gesellschaft. Naturzustand und Staatswerdung im Kontrast zwischen Aristoteles, Hobbes und Rousseau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1032002