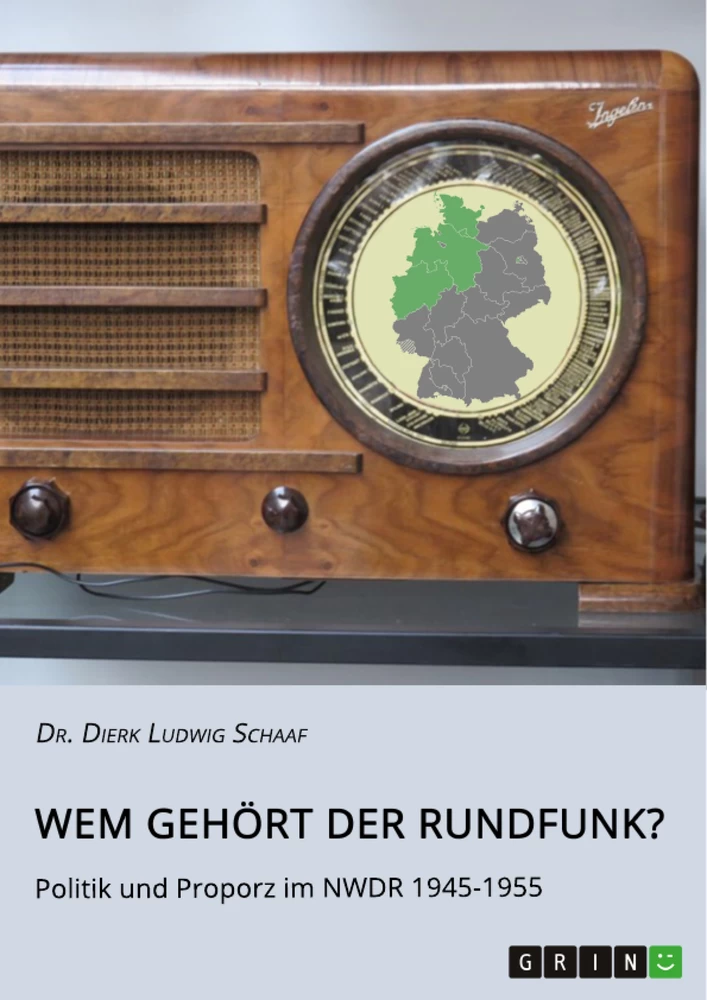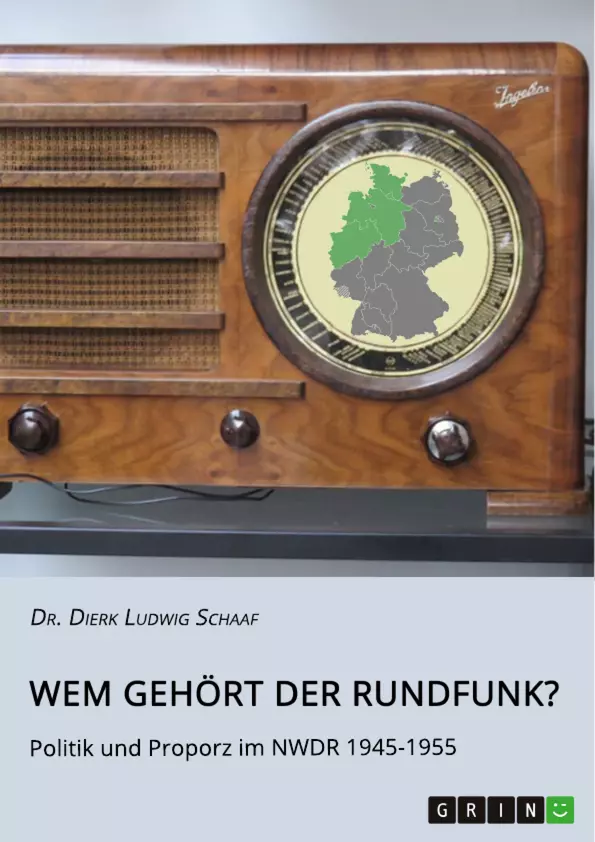Wem gehört der Rundfunk? Heute scheint das klar beantwortet: Den Hörern natürlich und den Fernseh-Zuschauern, die diese Medien bezahlen. 1945 war das nicht so klar.
Nach dem Untergang des Dritten Reiches planten die Briten in ihrer Zone einen Rundfunk wie die BBC. Den deutschen Politikern gefiel das nicht und als die Besatzungsmacht sich zurückzog und den Sender NWDR an die Deutschen übergab, da rissen die Politiker das Steuer an sich. Nach manchmal tumultartigen Konflikten bestimmten sie, wie viel Freiheit das Medium Rundfunk beanspruchen darf. Wie viel Wahrheit wollten sie dem Hörer zumuten? Und welche Wahrheit?
Was ist von den liberalen Grundsätzen der Briten geblieben? Was musste mühsam verteidigt oder später zurückerobert werden? Der Autor erkundete Archive, fragte viele damals Beteiligte und erzählt eine überraschend spannende Geschichte aus der Nachkriegszeit.
Dieses Buch ist eine überarbeitete, leicht gekürzte Version seiner Dissertation von 1970 an der Universität Hamburg ergänzt durch ein Nachwort von 2021.
Inhaltsverzeichnis
- 1 DER BESATZUNGSSENDER HAMBURG UND DIE GRÜNDUNG DES NWDR
- 1.1 Die Errichtung des Besatzungssenders
- 1.2 Aufbau von Technik und Programm
- 1.3 Entnazifizierung und Entlassung von Kommunisten
- 1.4 Erste Lizenzen für die Funkpresse
- 1.5 Die Verordnung 118
- 1.5.1 Beginn der deutsch-britischen Verhandlungen
- 1.5.2 Der Besitz der Sender
- 1.5.3 Die Stellung Nordrhein-Westfalens im NWDR
- 1.5.4 Die Zusammensetzung des Hauptausschusses
- 1.6 Die Konstituierung der Aufsichtsgremien
- 1.7 Die Postverträge
- 1.8 Neufassung von Statut und Satzung
- 1.9 Chronik
- 2. Der NWDR zwischen Macht und Programm
- 2.1 Die Interessen der Hörer
- 2.1.1 Hörerverbände
- 2.1.2 Die Rundfunkfachpresse
- 2.1.3 Hörerforschung
- 2.2 Disziplinierung der Redaktionen oder Eroberung der Bühne
- 2.2.1 Die Achse Raskop - Grimme
- 2.2.2 Aufstieg und Fall Herbert Blanks
- 2.2.3 Die Abberufung des Professors Raskop
- 2.2.4 Die Proportionierung des Programms
- 2.3 Parteisendungen im NWDR
- 2.3.1 Der Umgang mit den Radikalen
- 2.3.2 Rangfolge und Eifersucht
- 2.4 Ausbau und Regionalisierung
- 2.5 Chronik
- 2.1 Die Interessen der Hörer
- 3. Der NWDR und die Gründung des Senders Freies Berlin (SFB)
- 3.1 Erste partikulare Schritte
- 3.2 Das Konzept „Betriebsvertrag“
- 3.3 Die Gründung des SFB
- 3.4 Chronik
- 4 Die Teilung des NWDR
- 4.1 Entwurf eines NWDR-Staatsvertrages
- 4.2 Aspekte des Entwurfs eines Bundesrundfunk-Gesetzes
- 4.3 Die Gründung des Westdeutschen Rundfunks
- 4.3.1 Arnold stellt die Machtfrage
- 4.3.2 Das Gesetz über den WDR Köln
- 4.3.3 Reaktionen auf das WDR-Gesetz
- 4.3.4 Die Aufhebung der Verordnung 118
- 4.4 Die Liquidation des NWDR
- 4.4.1 Die Gründung des NDR
- 4.4.2 Die Gründung des NWRV
- 4.5 Chronik
- 4.6 Loccumer Leitsätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR) in der britischen Besatzungszone von 1945 bis 1955. Im Zentrum stehen die politischen Einflussnahmen auf den Rundfunk und die Frage, inwieweit der NWDR ein Instrument der Propaganda oder der Demokratieförderung war.
- Die Rolle der britischen Besatzungsmacht bei der Gründung und Gestaltung des NWDR
- Die Herausforderungen der Entnazifizierung und Entkommunisierung im Rundfunkbetrieb
- Die Auseinandersetzungen zwischen Politik und Rundfunkjournalismus im NWDR
- Die Bedeutung der Hörerinteressen und der Hörerforschung
- Die Teilung des NWDR und die Gründung der Nachfolgesender
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Der Besatzungssender Hamburg und die Gründung des NWDR
Dieses Kapitel schildert die Entstehung des Besatzungssenders Hamburg und seine Transformation zum NWDR. Es beleuchtet die Herausforderungen des Aufbaus von Technik und Programm, die Entnazifizierung und Entlassung von Kommunisten, die Verhandlung mit der britischen Besatzungsmacht über die Lizenzen für die Funkpresse und die Entstehung der Verordnung 118, die die Struktur und Organisation des NWDR festlegte.
Kapitel 2: Der NWDR zwischen Macht und Programm
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Interessen der Hörer, der Disziplinierung der Redaktionen und der Machtverhältnisse im NWDR. Es beleuchtet die Rolle von Hörerverbänden, der Rundfunkfachpresse und der Hörerforschung sowie die Auseinandersetzungen zwischen den Rundfunkmanagern und den Redakteuren. Weiterhin wird die Bedeutung der Parteisendungen im NWDR und die Regionalisierung des Programms behandelt.
Kapitel 3: Der NWDR und die Gründung des Senders Freies Berlin (SFB)
Dieses Kapitel behandelt die Entstehung des Senders Freies Berlin (SFB) aus dem NWDR und die politischen und organisatorischen Rahmenbedingungen dieser Entwicklung. Es beleuchtet die ersten Schritte zur Gründung eines Senders in Berlin, die Konzeption des „Betriebsvertrags“ und die finalen Schritte zur Gründung des SFB.
Kapitel 4: Die Teilung des NWDR
Dieses Kapitel analysiert die Prozesse der Teilung des NWDR und die Gründung der Nachfolgesender. Es beschäftigt sich mit dem Entwurf eines NWDR-Staatsvertrages und den Diskussionen um ein Bundesrundfunk-Gesetz. Weiterhin werden die Gründung des Westdeutschen Rundfunks (WDR) und die Liquidation des NWDR im Detail untersucht. Schließlich werden die Gründung des Norddeutschen Rundfunks (NDR) und die Gründung des Nordwestdeutschen Rundfunkverbandes (NWRV) beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf den politisch-historischen Aspekt des Rundfunks in der Nachkriegszeit. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Nordwestdeutscher Rundfunk (NWDR), britische Besatzungszone, Rundfunkpolitik, Propaganda, Demokratieförderung, Hörerinteressen, Hörerforschung, Parteisendungen, Regionalisierung, Teilung des NWDR, Gründung von Nachfolgesendern.
- Quote paper
- Dr. Dierk Ludwig Schaaf (Author), 1970, Wem gehört der Rundfunk? Politik und Proporz im NWDR 1945-1955, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1032045