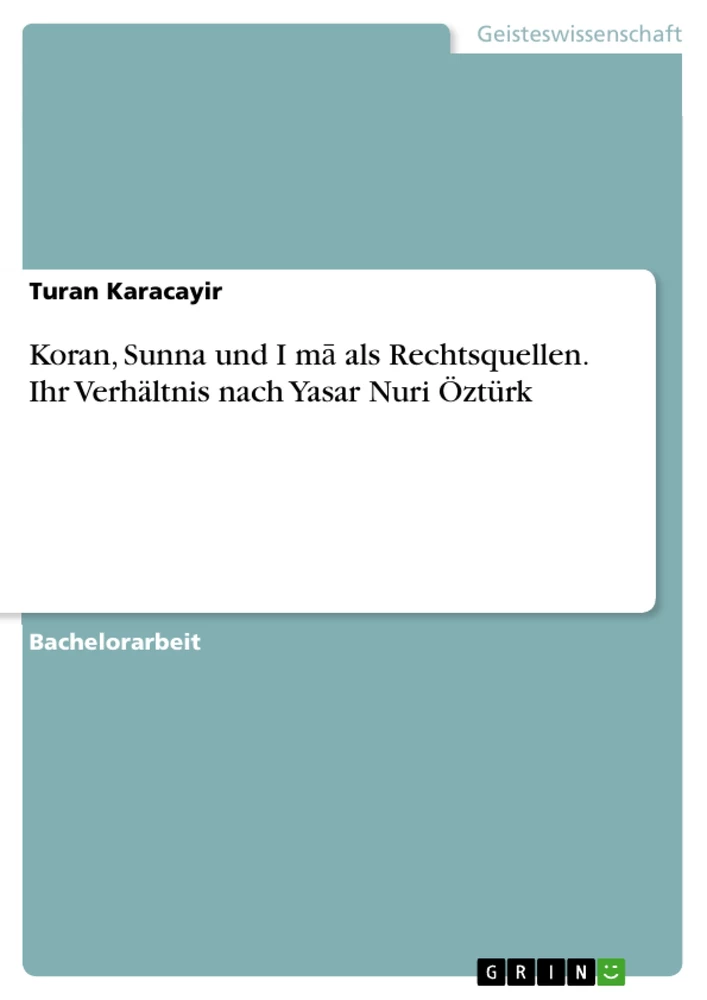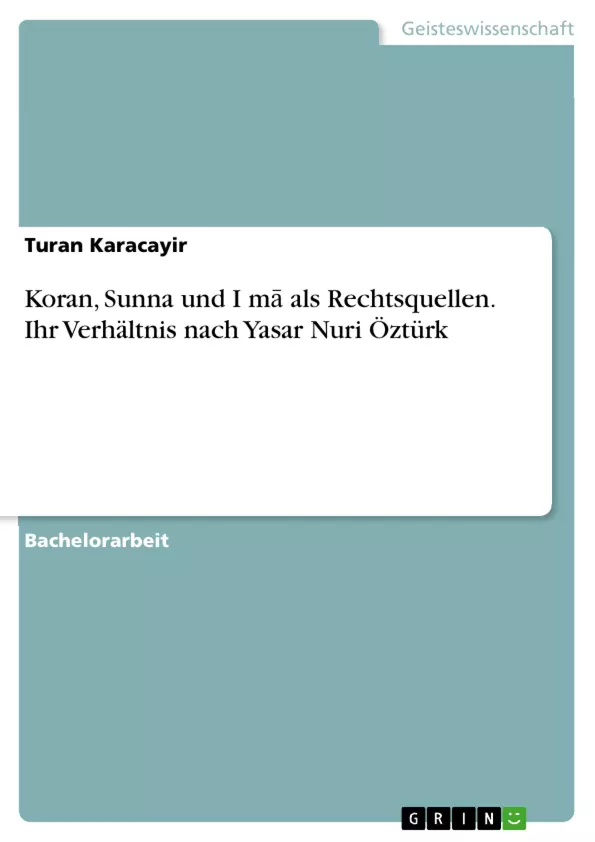Ziel und Zweck dieser vorliegenden Untersuchung ist die informative Darstellung der Positionen Öztürks im Verhältnis von Koran, Sunna und Iḡmā´ nach der traditionellen Auslegung des islamischen Rechts, sowie seine Art und Weise der Exegese des heiligen Buches. Deren eigentliche Wurzeln in Ägypten, beginnend mit Muhammad Abduh (1849-1905), und zeitgleich in Indien – bis 1948 gehörten Pakistan und Bangladesch zu Indien – mit Sayyid Ahmad Kahn (1817-1898) begannen. Diese beiden Länder erfuhren die Kolonisierung des Westens besonders bedrückend und suchten nach Erklärungen für den Rückschritt der islamischen Welt und den Fortschritt des Westens und haben nach Ansätze zu einem apologetischen Einschlag der Deutung der Quellentexte des Islams gesucht. Es müsste doch eine Erklärung dafür geben, weshalb die Muslime, die die unverfälschte Botschaft Gottes besaßen, wie in diese Unterlegenheit geraten könnten und was dagegen zu tun wäre. Auch Öztürk folgte fast hundert Jahre später dieser Fragestellung und beschäftigte sich mit der Frage und entwickelte seine eigenen Methoden der Exegese und der Gewinnung der eigenen Rechtsgutachten; vor allem widmete er sich den Frauen und deren Rechte im islamischen Kontext.
Öztürk zeigt Parallelen zu den iranischen Reformisten Abdolkarim Sorusch und Mo-hammad Mojtahad Shabestari, jene Reformtheologen, die als Luther des Islams betitelt werden. Ihre Äußerungen zum Strafrecht und Kleidervorschrift, sie wären nur Äußerlichkeiten des Islams aber nicht seine Essenz, stimmen überein. Sorush unterscheidet Werte im Koran des ersten Grades und des zweiten, und es käme auf den ersten Grad an und sucht nicht nach einer religiösen Legitimation in Menschenrechte. Wie wir sehen werden, geht Öztürk nicht so weit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Quellen des islamischen Rechts
- 2.1. Der Koran
- 2.2. Die Sunna
- 2.3. Iğmā
- 2.4. Iğtihād
- 3. Juristische Fallbeispiele
- 3.1. Polygamie
- 3.2. Züchtigungsrecht
- 3.3. Strafe für Diebstahl
- 3.4. Glaubensfragen
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Yaşar Nuri Öztürks Positionen zum Verhältnis von Koran, Sunna und Iğmā' als Rechtsquellen im islamischen Recht. Sie beleuchtet seine Hermeneutik des Korans im Kontext der islamischen Reformbewegung und vergleicht seine Ansätze mit traditionellen Interpretationen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Öztürks Verständnis und der traditionellen Auslegung.
- Öztürks Hermeneutik des Korans
- Vergleich mit traditionellen Rechtsauffassungen
- Öztürks Verständnis von Iğmā'
- Analyse juristischer Fallbeispiele nach Öztürk
- Öztürks Position zu Glaubensfragen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, welche darin besteht, Öztürks Positionen zum Verhältnis von Koran, Sunna und Iğmā' darzustellen und seine Hermeneutik des Korans zu analysieren. Sie verortet Öztürks Ansatz in der Geschichte der islamischen Reformbewegung, verweist auf Parallelen zu anderen Reformisten wie Abdolkarim Sorusch und Mohammad Mojtahad Shabestari, und hebt Öztürks Fokus auf Frauenrechte hervor. Die Einleitung skizziert die vier Lager der Koranexegese in der heutigen Türkei und benennt kritische Punkte von Öztürks Interpretation, wie z.B. seine geringe Berücksichtigung der Sunna und seine apologetische Herangehensweise.
2. Quellen des islamischen Rechts: Dieses Kapitel behandelt die traditionellen und Öztürkschen Ansichten zu den Hauptquellen des islamischen Rechts: Koran, Sunna und Iğmā'. Die traditionelle Sicht wird detailliert dargestellt, bevor Öztürks Interpretationen und deren Abweichungen von der Tradition erläutert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der unterschiedlichen Hermeneutiken und der Bewertung der jeweiligen Gewichtung der Quellen. Der Vergleich soll die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Perspektiven aufzeigen und ein umfassendes Bild der Debatte um die Rechtsquellen liefern.
3. Juristische Fallbeispiele: Dieses Kapitel untersucht Öztürks Interpretationen anhand konkreter Fallbeispiele wie Polygamie, Züchtigungsrecht und Diebstahl. Die Analyse konzentriert sich auf die Anwendung von Koran, Sunna und Iğmā' in diesen Fällen und zeigt, wie Öztürk die traditionellen Rechtsauffassungen interpretiert und gegebenenfalls modifiziert. Der Vergleich mit den traditionellen Ansichten wird genutzt, um Öztürks Hermeneutik und seine religiöse Philosophie zu verdeutlichen. Durch diese konkreten Beispiele wird das theoretische Verständnis der Rechtsquellen aus Kapitel 2 illustriert und veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Yaşar Nuri Öztürk, Koran, Sunna, Iğmā', islamisches Recht, Koranexegese, islamische Reformbewegung, Hermeneutik, Jurisprudenz, Frauenrechte, tafsīr 'ilmī, Traditionalismus, Modernismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Yaşar Nuri Öztürks Positionen im Islamischen Recht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Positionen von Yaşar Nuri Öztürk zum islamischen Recht, insbesondere sein Verständnis der Rechtsquellen Koran, Sunna und Iğmā'. Sie vergleicht seine Hermeneutik des Korans mit traditionellen Interpretationen und beleuchtet seine Ansätze im Kontext der islamischen Reformbewegung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die traditionellen und Öztürkschen Ansichten zu den Hauptquellen des islamischen Rechts. Sie untersucht Öztürks Hermeneutik des Korans, vergleicht sie mit traditionellen Rechtsauffassungen und analysiert seine Interpretationen anhand konkreter juristischer Fallbeispiele (Polygamie, Züchtigungsrecht, Diebstahl, Glaubensfragen). Ein besonderer Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen Öztürks Verständnis und der traditionellen Auslegung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, die die Zielsetzung und den Kontext der Arbeit beschreibt; ein Kapitel zu den Quellen des islamischen Rechts (Koran, Sunna, Iğmā' nach traditioneller und Öztürkscher Sicht); ein Kapitel mit juristischen Fallbeispielen, die Öztürks Interpretationen illustrieren; und abschließend eine Zusammenfassung.
Welche Rolle spielt die islamische Reformbewegung?
Die Arbeit verortet Öztürks Ansatz innerhalb der islamischen Reformbewegung und verweist auf Parallelen zu anderen Reformisten. Sie betrachtet seine Interpretationen im Kontext dieser Bewegung und analysiert deren Auswirkungen auf sein Verständnis des islamischen Rechts.
Wie wird Öztürks Hermeneutik des Korans behandelt?
Die Arbeit analysiert Öztürks Hermeneutik des Korans ausführlich. Sie untersucht seine Methoden der Koraninterpretation und vergleicht sie mit traditionellen Ansätzen. Dabei werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet und kritisch bewertet.
Welche Fallbeispiele werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Fallbeispiele wie Polygamie, Züchtigungsrecht und Diebstahl, um Öztürks Interpretationen der Rechtsquellen in konkreten Situationen zu analysieren und mit traditionellen Ansichten zu vergleichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Yaşar Nuri Öztürk, Koran, Sunna, Iğmā', islamisches Recht, Koranexegese, islamische Reformbewegung, Hermeneutik, Jurisprudenz, Frauenrechte, tafsīr 'ilmī, Traditionalismus, Modernismus.
Wo findet man Parallelen zu anderen Reformisten?
Die Einleitung verweist auf Parallelen zwischen Öztürks Ansatz und dem anderer Reformisten wie Abdolkarim Sorusch und Mohammad Mojtahad Shabestari. Diese Parallelen werden jedoch nicht im Detail untersucht.
Welche Kritikpunkte an Öztürks Interpretation werden genannt?
Die Einleitung nennt als kritische Punkte Öztürks geringe Berücksichtigung der Sunna und seine apologetische Herangehensweise.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten gedacht, die sich mit dem islamischen Recht, der Koranexegese und der islamischen Reformbewegung auseinandersetzen.
- Quote paper
- Turan Karacayir (Author), 2017, Koran, Sunna und Iḡmā als Rechtsquellen. Ihr Verhältnis nach Yasar Nuri Öztürk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1032472