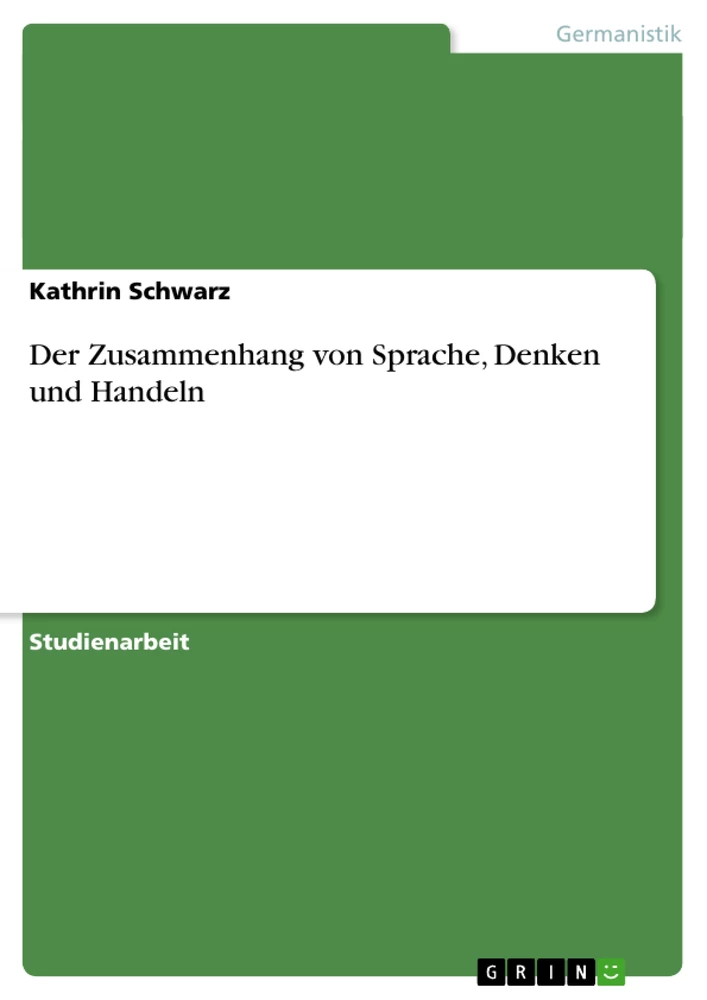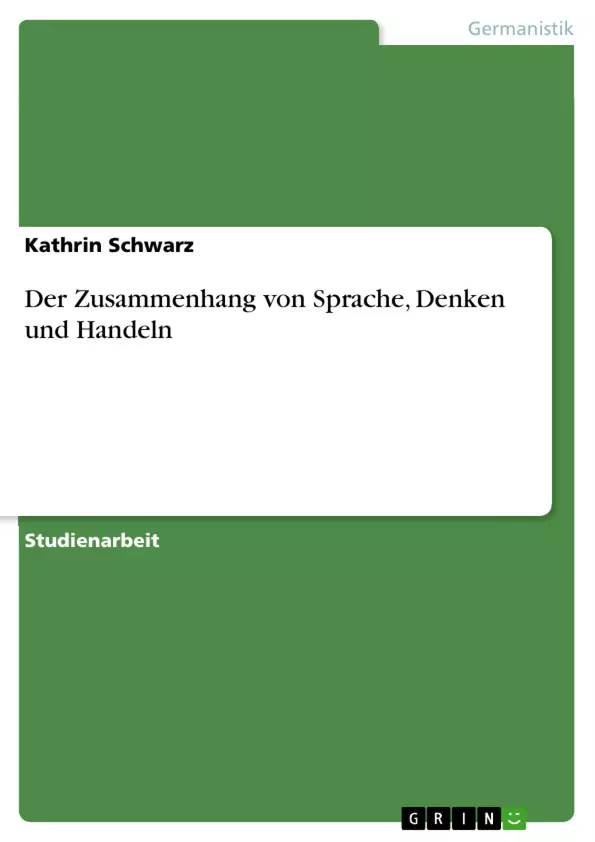In dieser Hausarbeit soll der Zusammenhang von Sprache, Denken und Handeln erörtert werden. Dazu werden Thesen verschiedener Linguisten wiedergegeben und verglichen. Am Ende wird ein eigenes Urteil hinzugefügt.
Wohl eine der bekanntesten Thesen zu diesem Thema ist die sogenannte „Sapir-Whorf-These“.
Nach ihr ist die Sprache für die Gesellschaft ein Medium des Ausdrucks, welches bestimmte Interpretationen der Welt vorgibt. Somit werden Bedeutungen nicht so sehr von den Menschen entdeckt, sondern sie werden ihnen eher aufgezwungen durch den Einfluß, den die sprachliche Form auf ihre Orientierung in der Welt ausübt, ohne daß sie dies selbst wahrnehmen.
B.L. Whorf erweiterte diese These noch radikal: Nach ihm gibt uns die Sprache jegliche Auffassungen der alltäglichen Dinge vor. Sie hat Einfluß auf jegliche kulturellen sowie persönlichen Aktivitäten. Ohne Sprache ist kein Denken möglich.
Wir können nur in Termini unserer Einzelsprache sprechen und nehmen die Welt auch nur in diesen Termini wahr („Gefängnis unserer Sprache“). Man kann sprechen ohne zu denken, aber nicht denken ohne zu sprechen.
Inhaltsverzeichnis
- Der Zusammenhang von Sprache, Denken und Handeln
- Die Sapir-Whorf-These
- Whorfs Vergleich der Hopi-Sprache mit SAE-Sprachen
- Die These von Slobin
- Die Thesen von Merten und Levi-Strauss
- Der Farbtest
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Sprache, Denken und Handeln. Sie analysiert und vergleicht verschiedene linguistische Thesen zu diesem Thema und mündet in einer eigenen Bewertung.
- Die Sapir-Whorf-These und ihre Auswirkungen auf Weltanschauung
- Der Einfluss sprachlicher Strukturen auf das Denken
- Vergleichende Analyse verschiedener linguistischer Positionen
- Die Rolle von grammatischen Kategorien im Denkprozess
- Die Frage nach universellen Denkstrukturen trotz sprachlicher Diversität
Zusammenfassung der Kapitel
Der Zusammenhang von Sprache, Denken und Handeln: Diese Arbeit untersucht den komplexen Zusammenhang zwischen Sprache, Denken und Handeln. Sie analysiert verschiedene Theorien, um zu verstehen, wie Sprache unsere Wahrnehmung der Welt formt und unser Denken und Handeln beeinflusst. Der Fokus liegt auf dem Vergleich verschiedener linguistischer Perspektiven und der Entwicklung einer eigenen Position zu diesem Thema. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob Sprache unser Denken determiniert oder ob sie lediglich einen Rahmen für die Ausdrucksweise bereits vorhandener Denkstrukturen bietet.
Die Sapir-Whorf-These: Die Arbeit präsentiert die Sapir-Whorf-These als eine zentrale Theorie zum Thema. Diese These postuliert einen starken Einfluss der Sprache auf Denken und Wahrnehmung. Die Sprache prägt demnach nicht nur die Art und Weise, wie wir über die Welt sprechen, sondern auch, wie wir die Welt verstehen und erleben. Die Bedeutung dieser These für das Verständnis interkultureller Kommunikation wird hervorgehoben. Die Arbeit legt dar, wie die sprachliche Form unsere Orientierung in der Welt beeinflusst, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.
Whorfs Vergleich der Hopi-Sprache mit SAE-Sprachen: Dieser Abschnitt vertieft die Sapir-Whorf-These anhand eines Vergleichs zwischen der Hopi-Sprache und den Standard Average European (SAE)-Sprachen. Whorf argumentiert, dass die unterschiedlichen sprachlichen Strukturen zu fundamental verschiedenen Weltansichten führen. Er hebt insbesondere die unterschiedliche Behandlung von Zeit und Raum in den beiden Sprachfamilien hervor. Die Beispiele verdeutlichen, wie grammatische Kategorien unbewusst bestimmte Charaktere der Dinge voraussetzen und somit unser Verständnis der Realität prägen.
Die These von Slobin: Im Gegensatz zu Whorf argumentiert Slobin, dass Menschen grundlegende mentale Konzepte besitzen, die unabhängig von der Sprache sind. Sprachen setzen lediglich Schwerpunkte und legen bestimmte Sichtweisen nahe. Die Arbeit erläutert Slobins Konzept des "Denkenlernens für das Sprechen", wonach sprachliche Strukturen einen interpretativen Rahmen für die Strukturierung von Erfahrungen bieten. Dieser Ansatz schwächt die deterministische Sichtweise der Sapir-Whorf-These ab.
Die Thesen von Merten und Levi-Strauss: Dieser Abschnitt stellt die Thesen von Merten und Levi-Strauss vor, die die Annahme teilen, dass alle Menschen gleich denken, aber unterschiedlich ausdrücken. Merten bezieht sich auf Kants Theorie der "Dinge an sich", um die subjektive Natur unserer Welterfahrung zu betonen. Levi-Strauss stützt seine These durch Analysen von Verwandtschaftssystemen und Mythen, die seiner Meinung nach universelle Ordnungsprinzipien des menschlichen Denkens aufzeigen.
Der Farbtest: Der Farbtest wird als empirisches Beispiel für die These der gleichartigen Denkstrukturen trotz sprachlicher Diversität angeführt. Obwohl die Benennung von Farben stark variiert, zeigt der Test, dass die Wahrnehmung von Farben weitgehend universell ist. Die Sprache kodiert somit bereits visuell klassifizierte Aspekte, anstatt diese zu schaffen. Dies unterstützt die These, dass Denkstrukturen universell sind, während die sprachliche Ausdrucksweise kulturell geprägt ist.
Schlüsselwörter
Sapir-Whorf-These, Sprache, Denken, Handeln, interkulturelle Kommunikation, Sprachstruktur, Weltanschauung, grammatische Kategorien, Hopi-Sprache, SAE-Sprachen, Slobin, Merten, Levi-Strauss, Farbtest, kognitive Linguistik.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Sprache, Denken und Handeln
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den komplexen Zusammenhang zwischen Sprache, Denken und Handeln. Sie analysiert verschiedene linguistische Theorien und vergleicht sie, um den Einfluss von Sprache auf unsere Wahrnehmung, unser Denken und Handeln zu verstehen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich verschiedener Perspektiven und der Entwicklung einer eigenen Position zu diesem Thema.
Welche Theorien werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Theorien wie die Sapir-Whorf-Hypothese, Slobins Theorie des "Denkenlernens für das Sprechen", sowie die Ansichten von Merten und Levi-Strauss zum Verhältnis von Sprache, Denken und Handeln. Die Theorien werden analysiert und verglichen, um die verschiedenen Positionen zum Thema zu beleuchten.
Was ist die Sapir-Whorf-Hypothese und wie wird sie in der Arbeit behandelt?
Die Sapir-Whorf-Hypothese postuliert einen starken Einfluss der Sprache auf Denken und Wahrnehmung. Die Arbeit präsentiert diese These als eine zentrale Theorie und analysiert ihre Bedeutung für das Verständnis interkultureller Kommunikation. Der Vergleich der Hopi-Sprache mit SAE-Sprachen dient als Beispiel für die unterschiedlichen sprachlichen Strukturen und deren Auswirkungen auf die Weltanschauung.
Wie unterscheidet sich Slobin's Ansatz von der Sapir-Whorf-Hypothese?
Im Gegensatz zur deterministischen Sichtweise der Sapir-Whorf-Hypothese argumentiert Slobin, dass Menschen grundlegende mentale Konzepte besitzen, die unabhängig von der Sprache sind. Sprachen setzen lediglich Schwerpunkte und bieten einen interpretativen Rahmen für die Strukturierung von Erfahrungen. Seine Theorie des "Denkenlernens für das Sprechen" schwächt die deterministische Interpretation der Sapir-Whorf-Hypothese ab.
Welche Position vertreten Merten und Levi-Strauss?
Merten und Levi-Strauss vertreten die These, dass alle Menschen gleich denken, aber unterschiedlich ausdrücken. Merten bezieht sich auf Kants Theorie der "Dinge an sich", während Levi-Strauss seine These durch Analysen von Verwandtschaftssystemen und Mythen untermauert, um universelle Ordnungsprinzipien des menschlichen Denkens aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt der Farbtest in der Arbeit?
Der Farbtest dient als empirisches Beispiel, um die These von universellen Denkstrukturen trotz sprachlicher Diversität zu unterstützen. Obwohl die Benennung von Farben kulturell variiert, zeigt der Test, dass die Wahrnehmung von Farben weitgehend universell ist. Dies deutet darauf hin, dass Sprache bereits visuell klassifizierte Aspekte kodiert, anstatt diese zu schaffen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit umfasst Kapitel zum Zusammenhang von Sprache, Denken und Handeln; zur Sapir-Whorf-These; zu Whorfs Vergleich von Hopi und SAE-Sprachen; zu Slobin's These; zu den Thesen von Merten und Levi-Strauss; und schließlich zum Farbtest als empirisches Beispiel.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sapir-Whorf-These, Sprache, Denken, Handeln, interkulturelle Kommunikation, Sprachstruktur, Weltanschauung, grammatische Kategorien, Hopi-Sprache, SAE-Sprachen, Slobin, Merten, Levi-Strauss, Farbtest, kognitive Linguistik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert und vergleicht verschiedene linguistische Thesen zum Zusammenhang von Sprache, Denken und Handeln und mündet in einer eigenen Bewertung dieser Theorien. Sie untersucht den Einfluss sprachlicher Strukturen auf das Denken und die Frage nach universellen Denkstrukturen trotz sprachlicher Diversität.
- Quote paper
- Kathrin Schwarz (Author), 1999, Der Zusammenhang von Sprache, Denken und Handeln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10328