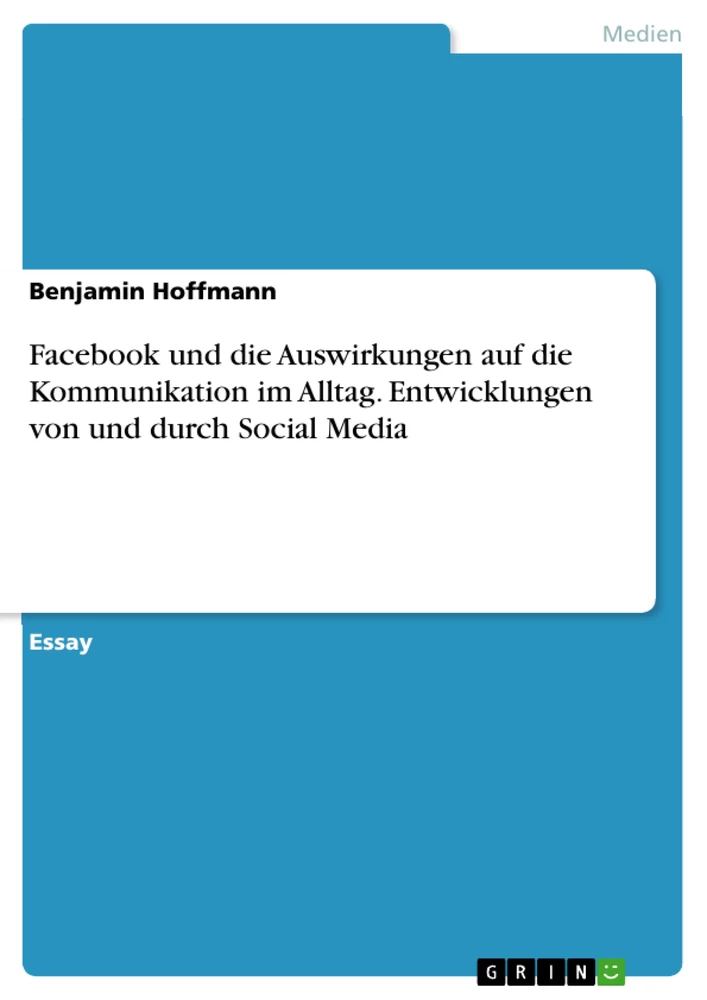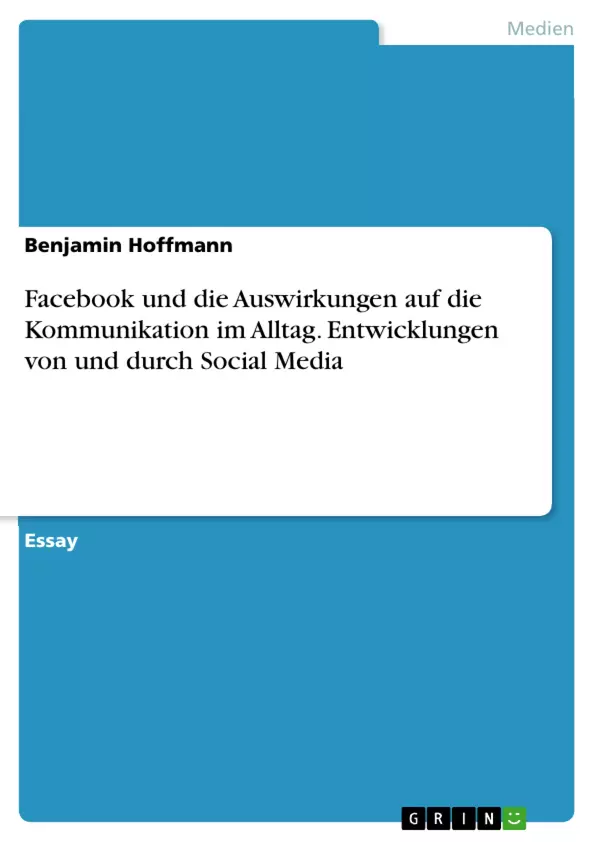In dieser Arbeit soll durch die Plattform Facebook aufgezeigt werden, wie sich die Kommunikation seit der Nutzung von sozialen Medien im Alltag entwickelt hat. Zudem soll anhand einer Fallstudie deren mögliche negative Entwicklung aufgezeigt und anhand von zwei Kommunikationsmodellen erläutert werden.
Zunächst werden grundlegende Begriffe definiert und der Unterschied zwischen den sozialen Medien und der Entwicklung des Web 2.0 dargestellt. Im Kapitel drei wird die Plattform Facebook und deren Funktionen kurz erläutert, um auf Vor- und Nachteile einzugehen, die bei der Beantwortung der Frage relevant sind. Anschließend werden die verschiedenen Motive zur Nutzung von sozialen Medien erläutert sowie die verschiedenen Beziehungsarten in den sozialen Medien analysiert. Im darauffolgenden Kapitel wird die Fallstudie kurz erzählt, um mithilfe der anschließenden Darstellung der Schweigespirale von Elisabeth Noelle-Neumann und der Theorie der kognitiven Dissonanz von Leon Festinger die Handlung der zwei Akteure zu analysieren.
Soziale Medien haben sich etabliert. Ihre Bedeutung hat durch das Internet ab Mitte der neunziger Jahre, gerade auch im kommunikationswissenschaftlichen Sektor, enorm zugenommen. Die individuelle Kommunikation wird geprägt und die zwischenmenschliche Kommunikation entwickelt sich immer mehr auf digitaler Ebene. Facebook, Instagram, WhatsApp und Snapchat sind nur ein paar Beispiele, wie vielfältig der Social Media Sektor ist, wie rasant er sich entwickeln kann und noch weiter entwickeln wird. Es existiert eine enorme Bandbreite an Angeboten hinsichtlich ihrer Verbreitung und Funktion. Übergeordnet ist es aber das Ziel jeder Social Media Plattform Informationen aller Nutzer für andere Nutzer leicht zugänglich zu machen sowie soziale Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konzeptionelle Grundlagen
- 2.1 Kommunikation
- 2.2 Neue Medien
- 2.3 Soziale Medien
- 2.4 Netzwerkplattformen
- 2.5 Web 2.0
- 3. Facebook
- 4. Motive zur Nutzung von sozialen Medien
- 5. Beziehungen in den sozialen Medien
- 6. Fallstudie
- 7. Vorliegende Modelle
- 7.1 Schweigespirale nach Noelle Neumann (ca. 1970)
- 7.2 Kognitive Dissonanz nach Leon Festinger (1957)
- 8. Übertragung der Theorien auf die Fallstudie
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen der Nutzung von Facebook auf die Kommunikation im Alltag. Sie analysiert, wie sich die Kommunikation durch soziale Medien entwickelt hat und beleuchtet mögliche negative Entwicklungen mithilfe einer Fallstudie und zwei Kommunikationsmodellen.
- Definition grundlegender Begriffe und Erklärung des Web 2.0
- Analyse der Plattform Facebook und ihrer Funktionen
- Untersuchung der Motive zur Nutzung von sozialen Medien
- Beziehungsformen in sozialen Medien
- Anwendung der Schweigespirale und kognitiven Dissonanz auf eine Fallstudie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der sozialen Medien ein und erläutert deren wachsende Bedeutung für die Kommunikation. Es stellt die Plattform Facebook als Untersuchungsgegenstand vor und skizziert die Zielsetzung der Arbeit.
Kapitel 2 definiert grundlegende Begriffe wie Kommunikation, neue Medien, soziale Medien und Web 2.0, um eine gemeinsame Basis für die Analyse zu schaffen.
Kapitel 3 beschreibt Facebook und seine Funktionen, um die Vor- und Nachteile der Plattform im Hinblick auf die Fragestellung der Arbeit aufzuzeigen.
Kapitel 4 behandelt verschiedene Motive zur Nutzung von sozialen Medien und analysiert die unterschiedlichen Beziehungsarten in diesem Kontext.
Kapitel 5 stellt eine aus dem Seminar stammende Fallstudie von Rebecca und Martin vor, die im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden soll.
Kapitel 6 präsentiert die Schweigespirale von Elisabeth Noelle-Neumann und die Theorie der kognitiven Dissonanz von Leon Festinger als theoretische Grundlagen für die Analyse der Fallstudie.
Kapitel 7 überträgt die in Kapitel 6 vorgestellten Theorien auf die Fallstudie von Rebecca und Martin.
Schlüsselwörter
Soziale Medien, Facebook, Kommunikation, Web 2.0, Schweigespirale, kognitive Dissonanz, Fallstudie, Interaktion, Beziehungen, Informationsüberlastung.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Hoffmann (Autor:in), 2017, Facebook und die Auswirkungen auf die Kommunikation im Alltag. Entwicklungen von und durch Social Media, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1033506