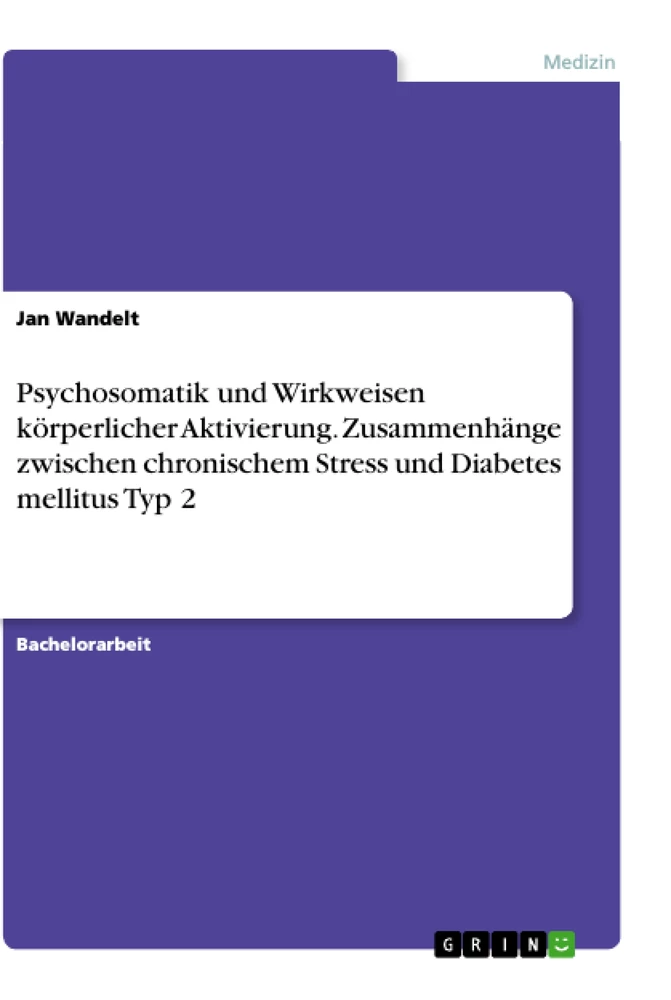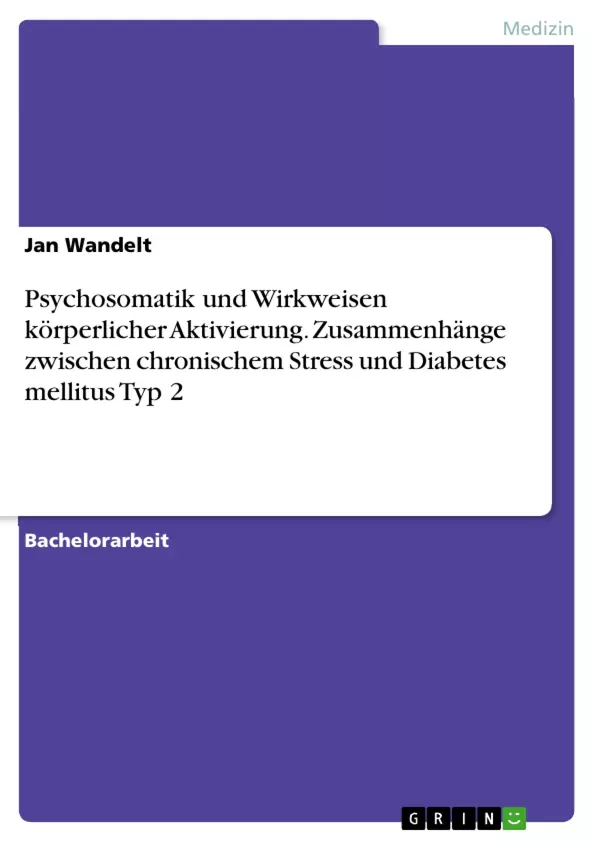Ziel dieser narrativen Übersichtsarbeit ist die Darlegung des aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstands bezüglich chronischen Stresses und dessen psychosomatischer Zusammenhänge. Schwerpunktmäßig mit dem Auftreten Diabetes mellitus Typ 2, dem metabolischen Syndrom und Depressionen. In diesem Zusammenhang wird die psychosomatische Wirksamkeit körperlicher Aktivierung, hauptsächlich in Form von aerobem Ausdauertraining, auf die erläuterten Krankheiten dargestellt. Anschließend wird durch die Ableitung der Studienergebnisse eine Empfehlung für einen bio-psycho-sozialen Handlungsansatz hinsichtlich Prävention und Gesundheitsförderung formuliert. Zur Eruierung der psychosomatischen Wirksamkeit und Angriffspunkte körperlicher Aktivierung werden jeweils drei Studien zum Thema "Körperlicher Aktivierung und Depressionen" und drei Studien zum Thema "Körperliche Aktivierung und Diabetes mellitus Typ2/Metabolisches Syndrom" extrahiert und analysiert.
Chronische Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2, das Metabolische Syndrom oder Depressionen stellen das deutsche Gesundheitssystem vor eine große Herausforderung. Die Prävalenzen sowie die Gesamtkosten für das Gesundheitswesen wachsen stetig. Übergewicht und Adipositas stehen oft im Zusammenhang mit diesen Krankheiten. Die Gründe für die Entstehung und Manifestation dieser Krankheiten liegen nach dem bio-medizinischen Modell und dem Alltagsverständnis unter anderem bei genetischen Dispositionen, mangelnder körperlicher Aktivität und hochkalorischer Ernährung. Die mittlerweile gut belegten Zusammenhänge zwischen diesen chronischen Krankheitsbildern und das gehäufte Auftreten stressassoziierter Erkrankungen wie Depressionen, lassen diesen vereinfachenden Rückschlüsse fragwürdig erscheinen. Nach dem bio-psycho-sozialem Modell von Krankheit und Gesundheit zeigt sich eine andere Blickweise auf die Entstehungsursachen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Problemstellung
- 2 Zielsetzung
- 3 Gegenwärtiger Kenntnisstand
- 3.1 Metabolisches Syndrom & Diabetes Mellitus Typ 2
- 3.1.1 Metabolisches Syndrom
- 3.1.2 Diabetes Mellitus Typ 2
- 3.2 Chronischer Stress und Depressionen
- 3.2.1 Chronischer Stress
- 3.2.2 Depressionen
- 3.2.3 Körperliche Reaktionen auf chronischen Stress
- 3.2.4 Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse und Allostatic Load
- 3.3 Psychosomatische Zusammenhänge
- 3.3.1 Zusammenhänge chronischer Stress und Depressionen, Frühkindlichen Prägung
- 3.3.2 Zusammenhänge chronischer Stress & Metabolisches Syndrom/Diabetes Mellitus Typ 2
- 3.3.3 Zusammenhänge Depressionen und Metabolisches Syndrom/Diabetes Mellitus Typ 2
- 3.3.4 Die „selfish-brain“-Theorie
- 3.4 Epidemiologische Daten & Ökonomische Auswirkungen
- 3.4.1 Epidemiologie Metabolisches Syndrom, Diabetes mellitus Typ 2, Depressionen
- 3.4.1.1 Metabolisches Syndrom
- 3.4.1.2 Diabetes mellitus Typ 2
- 3.4.1.3 Depressionen
- 3.4.2 Ökonomische Auswirkungen Metabolisches Syndrom, Diabetes mellitus Typ-2, Depressionen
- 3.4.1 Epidemiologie Metabolisches Syndrom, Diabetes mellitus Typ 2, Depressionen
- 3.5 Körperliche Aktivierung – Sport- & Bewegungstherapie in der Prävention und Therapie psychosomatischer Erkrankungen
- 3.1 Metabolisches Syndrom & Diabetes Mellitus Typ 2
- 4 Methodik
- 4.1.1 Ein- und Ausschlusskriterien & Suchmethodik
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Tabellarische Darstellung einbezogener Studien
- 5.1.1 Körperliche Aktivität und Depressionen
- 5.1.2 Körperliche Aktivität und Diabetes Mellitus Typ 2/ Metabolisches Syndrom
- 5.2 Wirkwege körperlicher Aktivität und Depressionen
- 5.3 Wirkwege körperlicher Aktivität und Diabetes Mellitus Typ 2/Metabolisches Syndrom
- 5.1 Tabellarische Darstellung einbezogener Studien
- 6 Diskussion
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Bachelor-Arbeit ist die narrative Darstellung des aktuellen Forschungsstands zu chronischem Stress und seinen Auswirkungen auf Depressionen, metabolisches Syndrom und Diabetes Typ 2. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Wirkung körperlicher Aktivität im psychosomatischen Kontext dieser Erkrankungen. Die Arbeit zielt auf die Ableitung eines praktikablen Handlungsansatzes für Gesundheitsförderung und Prävention ab.
- Chronischer Stress als Risikofaktor für Depressionen, metabolisches Syndrom und Diabetes Typ 2
- Psychosomatische Zusammenhänge zwischen chronischem Stress und den genannten Erkrankungen
- Wirkmechanismen körperlicher Aktivität auf die genannten Erkrankungen
- Epidemiologische Daten und ökonomische Auswirkungen der Erkrankungen
- Entwicklung eines multimodalen Handlungsansatzes zur Prävention und Gesundheitsförderung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung beschreibt die steigende Prävalenz chronischer Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 und metabolisches Syndrom in Industrieländern, trotz hoher Investitionen in Prävention und Behandlung. Sie hinterfragt vereinfachende Erklärungsmodelle, die auf Disziplinlosigkeit oder Willensschwäche fokussieren, und verweist auf komplexere bio-psycho-soziale Zusammenhänge, insbesondere die Rolle von chronischem Stress. Die Arbeit argumentiert für ein bio-psycho-soziales Krankheitsmodell und die Bedeutung der Psychosomatik, um diese komplexen Krankheitsbilder besser zu verstehen und zu behandeln.
2 Zielsetzung: Dieses Kapitel beschreibt das Ziel der Arbeit: die Darstellung des aktuellen Wissensstandes zu chronischem Stress und seinen Auswirkungen (physisch und psychisch) auf Depressionen, metabolisches Syndrom und Diabetes Typ 2. Es wird die Rolle körperlicher Aktivität im psychosomatischen Kontext untersucht, und ein praktikabler Handlungsansatz für Prävention und Gesundheitsförderung soll abgeleitet werden.
3 Gegenwärtiger Kenntnisstand: Dieser Abschnitt bietet einen umfassenden Überblick über das metabolische Syndrom und Diabetes Typ 2, chronischen Stress und Depressionen, sowie die körperlichen Reaktionen auf chronischen Stress, inklusive der HPA-Achse und Allostatic Load. Er beleuchtet die psychosomatischen Zusammenhänge zwischen chronischem Stress, Depressionen und den Stoffwechselerkrankungen, einschließlich der „selfish-brain“-Theorie. Epidemiologische Daten und ökonomische Auswirkungen werden ebenfalls präsentiert, gefolgt von einer Diskussion der Rolle körperlicher Aktivität in Prävention und Therapie.
4 Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit, einschließlich der Ein- und Ausschlusskriterien und der Suchmethodik, die für die Literaturrecherche verwendet wurde. (Details fehlen im Auszug)
5 Ergebnisse: Dieser Abschnitt präsentiert die Ergebnisse der Literaturrecherche, die in tabellarischer Form die einbezogenen Studien zeigen und die Wirkwege körperlicher Aktivität bei Depressionen und Diabetes Typ 2/metabolischem Syndrom detailliert darstellen. (Details fehlen im Auszug)
6 Diskussion: (Zusammenfassung fehlt, da im Auszug nicht enthalten)
Schlüsselwörter
Chronischer Stress, Diabetes Mellitus Typ 2, Metabolisches Syndrom, Depressionen, Psychosomatik, Körperliche Aktivität, Sport- und Bewegungstherapie, Prävention, Gesundheitsförderung, bio-psycho-soziales Modell, „selfish-brain“-Theorie, HPA-Achse, Allostatic Load.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Chronischer Stress, Metabolische Erkrankungen und Depressionen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen chronischem Stress, Depressionen, metabolischem Syndrom und Diabetes Typ 2. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle körperlicher Aktivität in der Prävention und Therapie dieser Erkrankungen. Es wird ein bio-psycho-soziales Modell angewendet und ein praktikabler Handlungsansatz für Gesundheitsförderung abgeleitet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Chronischer Stress als Risikofaktor, psychosomatische Zusammenhänge zwischen den genannten Erkrankungen, Wirkmechanismen körperlicher Aktivität, epidemiologische Daten und ökonomische Auswirkungen, sowie die Entwicklung eines multimodalen Handlungsansatzes zur Prävention und Gesundheitsförderung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung und Problemstellung, Zielsetzung, Gegenwärtiger Kenntnisstand (mit Unterkapiteln zu metabolischem Syndrom, Diabetes Typ 2, Depressionen, chronischem Stress, psychosomatischen Zusammenhängen, epidemiologischen Daten und körperlicher Aktivität), Methodik, Ergebnisse (inklusive tabellarischer Darstellung der Studien und Wirkwege körperlicher Aktivität), Diskussion und Zusammenfassung. Der aktuelle Kenntnisstand umfasst auch die „selfish-brain“-Theorie, die HPA-Achse und Allostatic Load.
Welche Methodik wurde angewendet?
Das Kapitel "Methodik" beschreibt detailliert die Ein- und Ausschlusskriterien und die Suchmethodik für die Literaturrecherche (genaue Details fehlen im vorliegenden Auszug).
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Literaturrecherche werden tabellarisch dargestellt und zeigen die einbezogenen Studien. Es werden die Wirkwege körperlicher Aktivität bei Depressionen und Diabetes Typ 2/metabolischem Syndrom detailliert beschrieben (genaue Details fehlen im vorliegenden Auszug).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Chronischer Stress, Diabetes Mellitus Typ 2, Metabolisches Syndrom, Depressionen, Psychosomatik, Körperliche Aktivität, Sport- und Bewegungstherapie, Prävention, Gesundheitsförderung, bio-psycho-soziales Modell, „selfish-brain“-Theorie, HPA-Achse, Allostatic Load.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den aktuellen Forschungsstand zu chronischem Stress und seinen Auswirkungen auf Depressionen, metabolisches Syndrom und Diabetes Typ 2 darzustellen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Wirkung körperlicher Aktivität und der Ableitung eines praktikablen Handlungsansatzes für Gesundheitsförderung und Prävention.
Was ist die Kernaussage der Einleitung?
Die Einleitung hebt die steigende Prävalenz chronischer Erkrankungen trotz hoher Investitionen in Prävention und Behandlung hervor. Sie kritisiert vereinfachende Erklärungsmodelle und plädiert für ein bio-psycho-soziales Krankheitsmodell und die Berücksichtigung der Psychosomatik.
Was wird im Kapitel "Gegenwärtiger Kenntnisstand" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das metabolische Syndrom, Diabetes Typ 2, chronischen Stress, Depressionen, die körperlichen Reaktionen auf Stress (HPA-Achse, Allostatic Load), psychosomatische Zusammenhänge (inklusive der „selfish-brain“-Theorie), epidemiologische Daten, ökonomische Auswirkungen und die Rolle körperlicher Aktivität.
- Quote paper
- Jan Wandelt (Author), 2021, Psychosomatik und Wirkweisen körperlicher Aktivierung. Zusammenhänge zwischen chronischem Stress und Diabetes mellitus Typ 2, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1033533