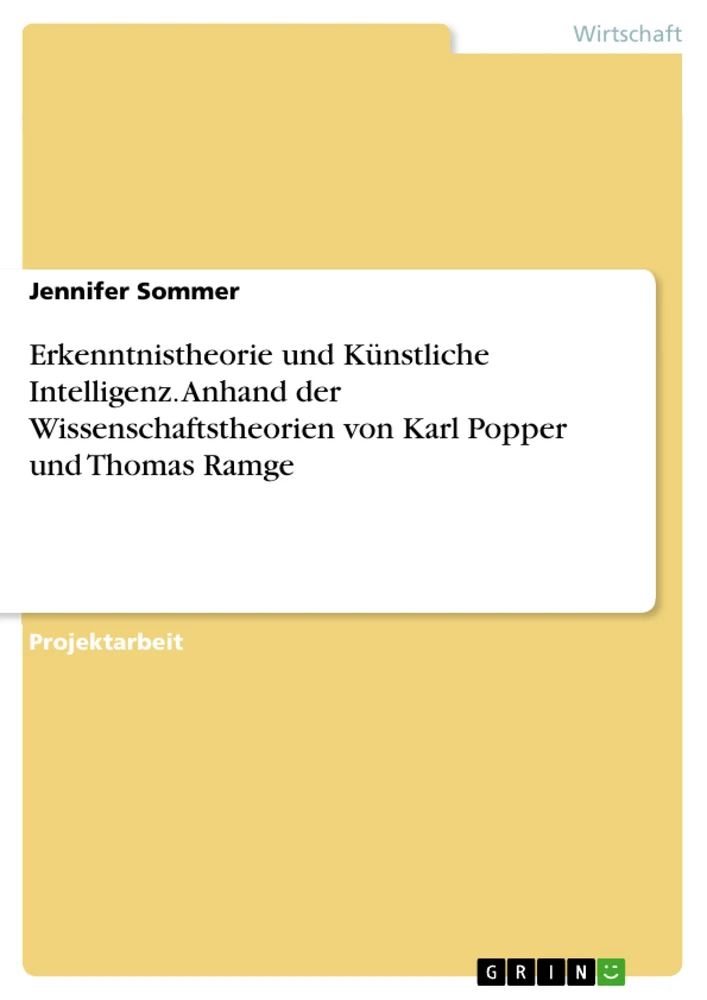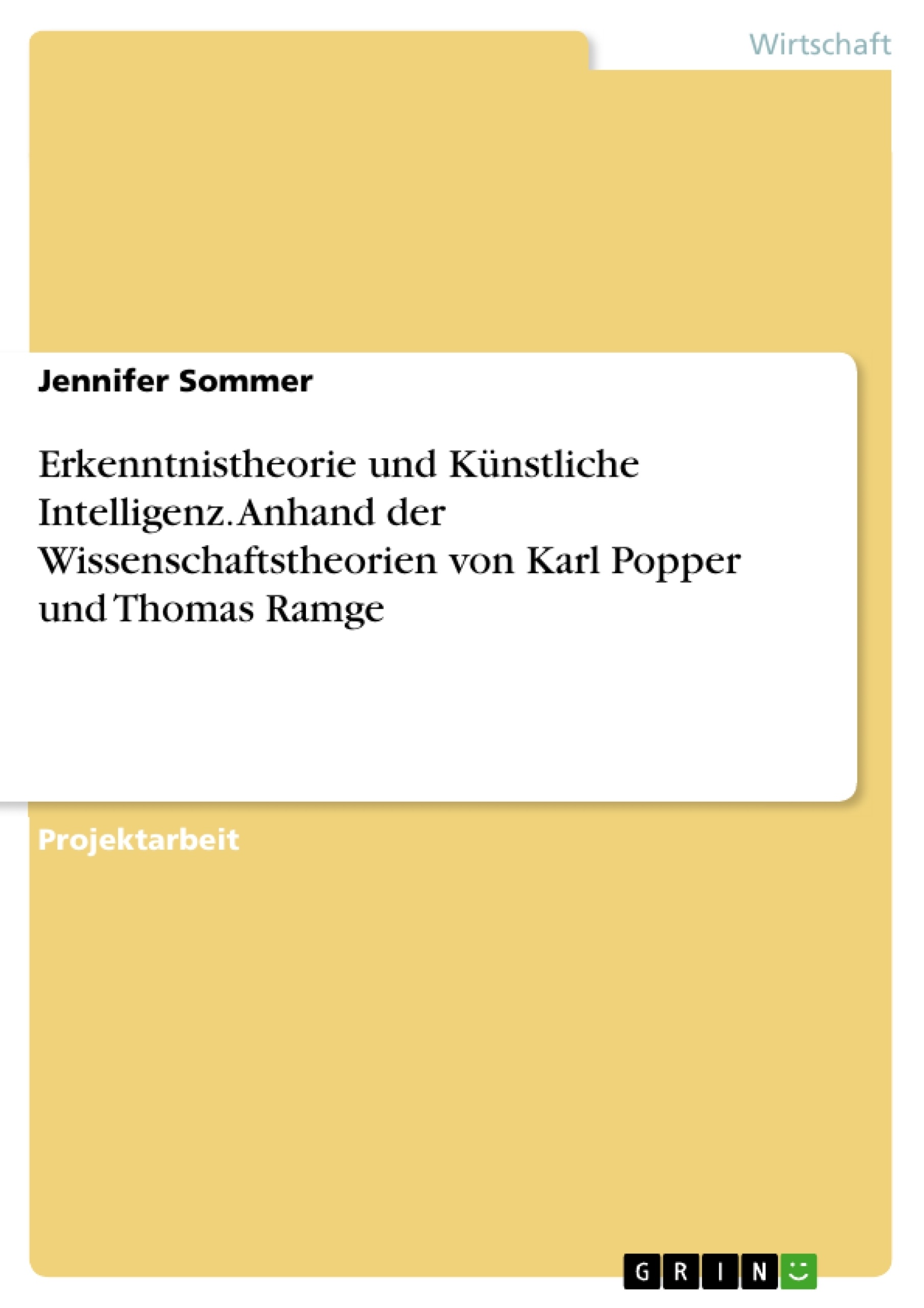Die Projektarbeit zielt darauf ab, anhand der Wissenschaftstheorie von Karl Popper sowie der Entwicklungsperspektive künstlicher Intelligenz die erlernten theoretischen Erkenntnisse durch eigenständige Überlegungen zu reflektieren.
Die Lektüre von Karl Poppers Aufsatz „Conjectures and Refutations“ sowie des Buchs „Mensch und Maschine“ von Thomas Ramge bildet den Ausgangspunkt zur Ausarbeitung konkreter Fragestellungen. Diese beschäftigen sich mit der Theorie der Entwicklung einer Superintelligenz sowie mit den Einwänden Poppers zu den Theorien von Siegmund Freud, Alfred Adler und Karl Marx. Im Rahmen der Projektarbeit soll ferner eine mögliche Verbindung zwischen dem von Popper dargelegten Prinzip der Falsifikation und den für die Künstliche Intelligenz (KI) essentiellen Feedbackdaten diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- AUFGABENSTELLUNG
- ZIELSETZUNG, NUTZEN
- EINFÜHRUNG
- MENSCH UND MASCHINE
- Entwicklung der KI nach Ramge
- Feedbackdaten
- Entwicklung einer Superintelligenz?
- POPPERS FALSIFIKATION
- Poppers Einwand gegen den wissenschaftlichen Anspruch der Theorien von Freud, Adler und Marx
- Unterschied zu den Theorien von Einstein
- Popper’sche Feedbackdaten oder ein Algorithmus falsifiziert sich selbst
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit befasst sich mit der Verbindung von Erkenntnistheorie und Künstlicher Intelligenz. Sie analysiert die Wissenschaftstheorie von Karl Popper und ihre Relevanz im Kontext der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Die Arbeit zielt darauf ab, theoretische Erkenntnisse durch eigene Überlegungen zu reflektieren und die Verbindung zwischen Poppers Falsifikationsprinzip und den für KI essentiellen Feedbackdaten zu diskutieren.
- Der wissenschaftliche Anspruch von Theorien und die Rolle der Falsifikation
- Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz und die Frage der Superintelligenz
- Die Bedeutung von Feedbackdaten für die Weiterentwicklung von KI-Systemen
- Die Chancen und Risiken der KI-Entwicklung
- Die ethischen und gesellschaftlichen Implikationen der Künstlichen Intelligenz
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Aufgabenstellung und Zielsetzung vor.
- Einführung: Dieses Kapitel thematisiert die Beziehung zwischen Mensch und Maschine im Kontext der Künstlichen Intelligenz. Die Entwicklung der KI nach Ramge wird beleuchtet, wobei die Rolle von Feedbackdaten und die Debatte um eine Superintelligenz im Zentrum stehen.
- Poppers Falsifikation: Dieses Kapitel erläutert Poppers Falsifikationsprinzip und seine Kritik an den Theorien von Freud, Adler und Marx. Der Unterschied zu den Theorien von Einstein wird aufgezeigt. Der Zusammenhang zwischen Poppers Falsifikation und Feedbackdaten wird anhand des Beispiels von Spamfiltern illustriert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Erkenntnistheorie, Künstliche Intelligenz, Falsifikation, Feedbackdaten, Superintelligenz, Wissenschaftstheorie, Mensch-Maschine-Interaktion und ethische Implikationen.
- Quote paper
- Jennifer Sommer (Author), 2021, Erkenntnistheorie und Künstliche Intelligenz. Anhand der Wissenschaftstheorien von Karl Popper und Thomas Ramge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1033757