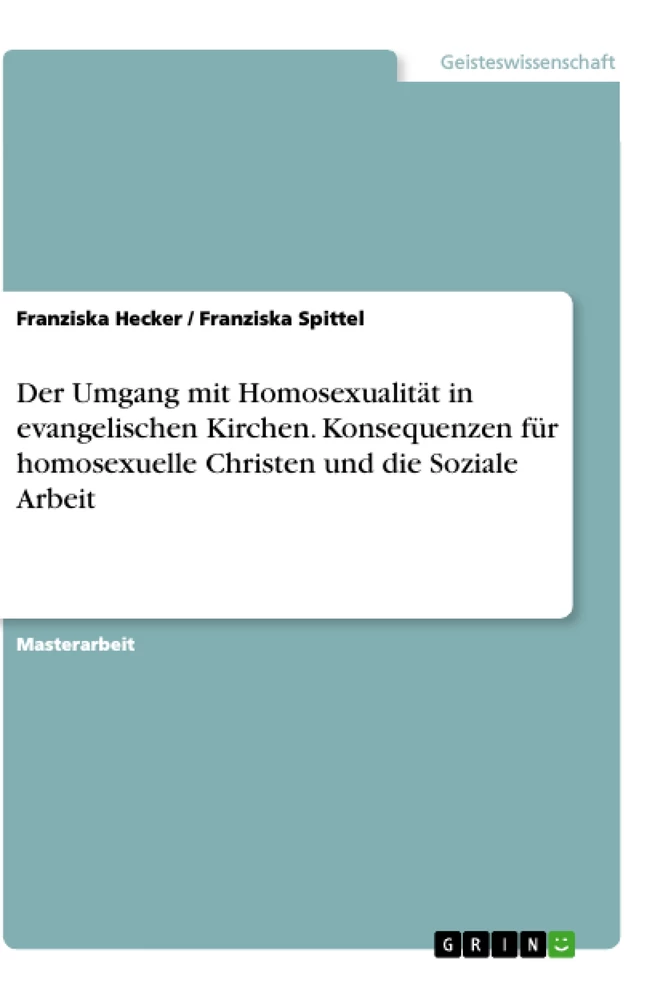Das Ziel der vorliegenden Ausarbeitung liegt darin, einen Überblick über die in evangelischen Kirchen/Gemeinden bestehenden Einstellungen gegenüber Homosexualität sowie den Umgang mit Homosexualität und homosexuellen Christ*innen zu geben.
Um zielführende Ergebnisse zu erlangen, werden im zweiten Kapitel dieser Arbeit zunächst die begrifflichen Einordnungen von Homosexualität und der Evangelischen Kirche vorgenommen sowie die Haltungen der Evangelischen Kirche zur Homosexualität dargestellt.
Darauffolgend werden in Kapitel 3 die methodischen Vorgehensweisen erläutert. Nach der Einordnung des Forschungsgegenstandes und der vorgenommenen Fragestellungen wird die qualitative Methodenwahl begründet. Des Weiteren werden die Erhebungsmethode und der Feldzugang beschrieben sowie ein Überblick über die Untersuchungsgruppe gegeben. Schließlich werden die Auswertungsmethode erläutert und die Grenzen der Aussagefähigkeit dieser aufgezeigt.
Im vierten Kapitel erfolgt unter Einbeziehung aussagekräftiger Antworten der Umfrageteilnehmenden die Darstellung der Umfrageergebnisse. Diese beziehen sich zunächst auf die familiäre und persönliche Rolle des christlichen Glaubens, die in evangelischen Kirchen/Gemeinden vorherrschenden Einstellungen gegenüber Homosexualität sowie den Umgang mit dem Thema der Homosexualität und homosexuellen Christ*innen. Des Weiteren werden die verschiedenen Konsequenzen für homosexuelle Christ*innen, welche aus den Einstellungen und Formen des Umgangs resultieren, aufgezeigt. Abschließend wird auf die Wünsche der Befragten eingegangen, um darauf basierend die Konsequenzen für die Soziale Arbeit abzuleiten.
Im Anschluss an die Darstellung der Ergebnisse werden im fünften Kapitel die Aufgaben Sozialer Arbeit im Kontext von Homosexualität und Religion aufgezeigt sowie ein Ausblick für sozialarbeiterische Unterstützungsangebote gegeben.
Die Masterarbeit schließt letztendlich mit einem Fazit ab, in welchem die Fragestellungen zusammengefasst beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffliche Einordnung und Haltung der Evangelischen Kirche zur Homosexualität
- 2.1 Begriffliche Einordnung von Homosexualität
- 2.2 Begriffliche Einordnung der Evangelischen Kirche
- 2.3 Haltung der Evangelischen Kirche zur Homosexualität
- 3 Methoden (diskussion)
- 3.1 Gegenstand und Fragestellung
- 3.2 Begründung der Methodenwahl
- 3.3 Erhebungsmethode und Feldzugang
- 3.4 Überblick über die Untersuchungsgruppe
- 3.5 Auswertungsmethode
- 3.6 Grenzen der Aussagefähigkeit
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Familiäre und persönliche Rolle des christlichen Glaubens
- 4.2 Einstellungen gegenüber Homosexualität und Homosexuellen
- 4.2.1 Ablehnende Einstellung
- 4.2.2 Akzeptierende Einstellung
- 4.2.3 Ambivalente Einstellung
- 4.2.4 Homosexualität ist Sünde
- 4.2.5 Homosexualität entspricht nicht der Bibel/Gottes Willen
- 4.2.6 Veränderung von Einstellungen
- 4.2.7 Keine Veränderung von Einstellungen
- 4.3 Umgang mit Homosexualität und homosexuellen Christ*innen
- 4.3.1 Thematisierung der Homosexualität
- 4.3.2 Vermeidung der Thematisierung von Homosexualität
- 4.3.3 Unklarer Umgang
- 4.3.4 Ablehnender Umgang
- 4.3.5 Offener Umgang
- 4.3.6 ,,Helfender“ Umgang
- 4.3.7 Persönlicher Umgang von homosexuellen Christ*innen
- 4.4 Konsequenzen für homosexuelle Christ*innen
- 4.4.1 Zunehmende Rechte homosexueller Christ*innen
- 4.4.2 Konsequenzen für homosexuelle Christ*innen in Gemeinden
- 4.4.3 Persönliche Konsequenzen für homosexuelle Christ*innen
- 4.5 Konsequenzen für die Soziale Arbeit
- 4.5.1 Bekanntheit und Nutzung von bestehenden Angeboten
- 4.5.2 Wunsch nach Austausch
- 4.5.3 Wunsch nach Unterstützung
- 4.5.4 Wunsch nach Aufklärung
- 5 Soziale Arbeit im Kontext von Homosexualität und Religion
- 5.1 Soziale Arbeit im Kontext von Homosexualität
- 5.2 Soziale Arbeit im Kontext von Religion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit dem Umgang mit Homosexualität in evangelischen Kirchen und den daraus resultierenden Konsequenzen für homosexuelle Christ*innen und die Soziale Arbeit. Die Arbeit analysiert die Haltung der Evangelischen Kirche gegenüber Homosexualität, untersucht die Erfahrungen homosexueller Christ*innen im Kontext ihrer Gemeinde und beleuchtet die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Zusammenhang.
- Haltung der Evangelischen Kirche zur Homosexualität
- Erfahrungen homosexueller Christ*innen in Gemeinden
- Konsequenzen für homosexuelle Christ*innen
- Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext von Homosexualität und Religion
- Mögliche Handlungsansätze für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Masterarbeit führt in das Thema ein und erläutert den Forschungsstand und die Relevanz der Thematik. Kapitel 2 beleuchtet die begriffliche Einordnung von Homosexualität und der Haltung der Evangelischen Kirche gegenüber Homosexualität. Im dritten Kapitel werden die angewandten Methoden und der methodische Zugang zur Untersuchung erläutert. Die Ergebnisse der Untersuchung werden im vierten Kapitel vorgestellt und in verschiedene Kategorien eingeteilt. Kapitel 5 befasst sich mit der Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext von Homosexualität und Religion.
Schlüsselwörter
Homosexualität, Evangelische Kirche, Christ*innen, Soziale Arbeit, Diskriminierung, Akzeptanz, Gemeinde, Religion, Handlungsansätze, Inklusion, Exklusion.
- Quote paper
- Franziska Hecker (Author), Franziska Spittel (Author), 2021, Der Umgang mit Homosexualität in evangelischen Kirchen. Konsequenzen für homosexuelle Christen und die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1033772