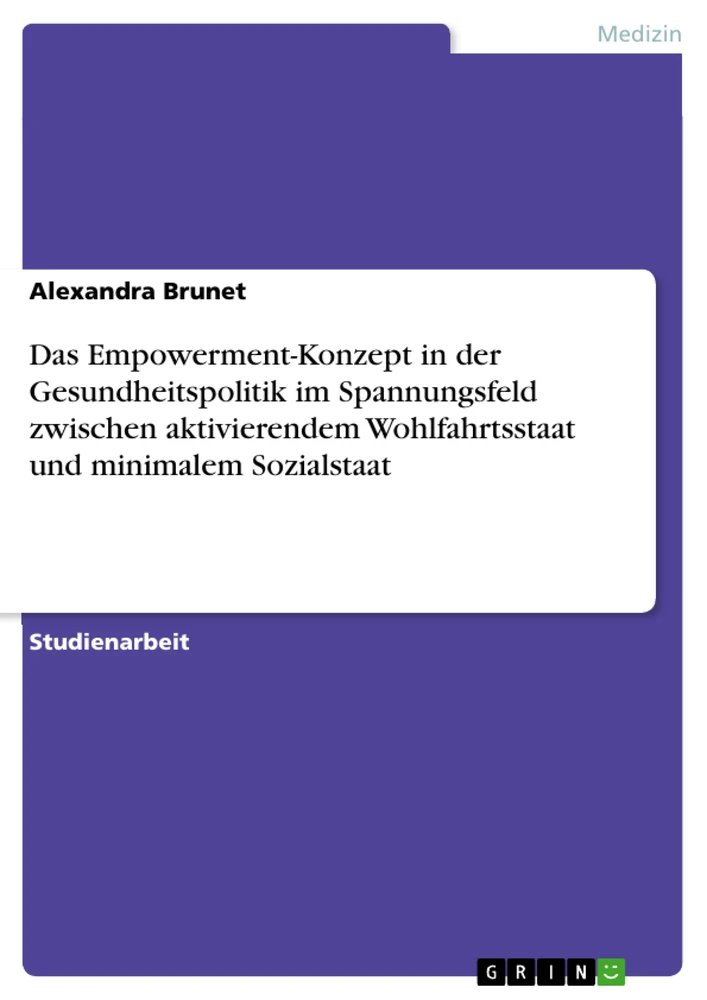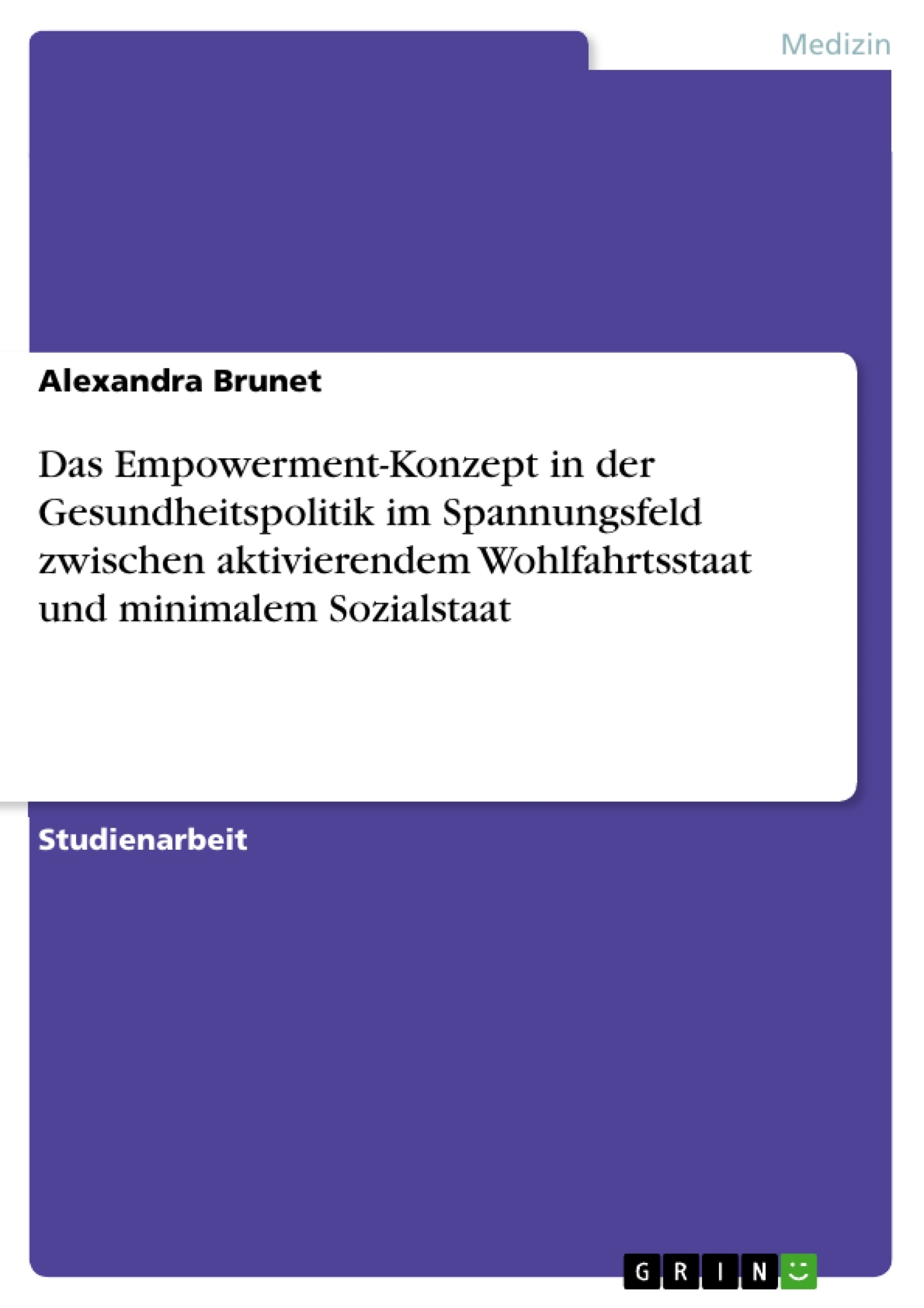Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen groben Überblick über die aktuelle gesundheitspolitische Debatte zu verschaffen und die darauffolgenden Implikationen für die Soziale Arbeit im Gesundheitswesen darzustellen sowie kritisch zu reflektieren.
Durch Begriffe wie ‚Partizipation‘, ‚Ressourcenorientierung‘, ‚Selbsthilfe‘ und ‚Aktivierung‘ dominiert das Empowerment-Konzept seit den 1990er-Jahren den theoretischen Diskurs und die Praxis der Sozialen Arbeit. Das Konzept ist ein handlungsleitendes Plädoyer für einen aktivierenden Sozialstaat und eine aktivierende Sozialpolitik sowie für eine partizipative, aktivierende Soziale Arbeit fernab von defizitorientierten Ansichten und der „Vorherrschaft der Experten, die zu einer Erosion alltagsweltlicher Fähigkeiten führt“ (Galuske 2005).
Aber gerade in der sozialpolitischen Diskussion sorgt Empowerment für mehrere Kontroversen und widersprüchliche Auslegungen seiner Prinzipien. Aufgrund seiner begrifflichen Unschärfe wird Empowerment vorgeworfen, dass es zur Usurpation des traditionellen Wohlfahrtsstaates beitrage, indem es der neoliberalen Politik eine theoretische Grundlage anbietet. Diese hat das Konzept in ihrer Agenda und als Argumentation für einen minimal schlanken Sozialstaat übernommen und die entsprechende Semantik für sich genutzt. Trotzdem wird Empowerment weiterhin sowohl innerhalb als auch außerhalb
der Sozialen Arbeit verbreitet genutzt und von mehreren Organisationen des Sozialbereichs in ihrem Leitbild integriert. Fachkräfte werden ständig ermutigt, durch verschiedene Projekte und Vorträge in ihrer Praxis Empowerment-orientiert zu handeln.
Soziale Arbeit steht mit dem Gesundheitswesen in starker Verbindung, was in all ihren Bereichen zum Ausdruck kommt – seien es ambulante, teilstationäre oder stationäre Einrichtungen. Sie wird hauptsächlich dann tätig, wenn die Menschen krankheitsbedingt ihr lebensweltliches Gleichgewicht verlieren oder zu verlieren drohen. Durch gezielte sozialarbeiterische gesundheitsfördernde, präventive oder rehabilitative Interventionen wird aktiv dagegen kämpft, solchen ungünstigen Zuständen vorzubeugen. In diesem Zusammenhang stellt sich in Hinblick auf die Soziale Arbeit im Gesundheitswesen die Frage, welche Rolle das Empowerment in dem Spannungsfeld zwischen dem aktivierenden Wohlfahrtsstaat und dem minimalen Sozialstaat einnimmt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Begriffserklärung
- 2.1 Das Empowerment-Konzept
- 2.2 Der aktivierende Wohlfahrtsstaat
- 3 Das Empowerment-Konzept im Rahmen der aktivierenden Gesundheitspolitik
- 4 Der minimale Sozialstaat
- 5 Die Rolle der Sozialen Arbeit in einem aktivierenden Sozialstaat und in der Gesundheitspolitik
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Empowerment-Konzept im Kontext der Gesundheitspolitik und analysiert dessen Relevanz im Spannungsfeld zwischen aktivierenden Wohlfahrtsstaat und minimalem Sozialstaat.
- Die Bedeutung des Empowerment-Konzepts in der Sozialen Arbeit
- Die Kontroversen und widersprüchlichen Auslegungen des Empowerment-Konzepts
- Die Rolle des Empowerments in der aktivierenden Gesundheitspolitik
- Der Einfluss des minimalen Sozialstaates auf die Anwendung des Empowerment-Konzepts
- Die Implikationen des Empowerment-Konzepts für die Soziale Arbeit im Gesundheitswesen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung - Die Einführung stellt das Empowerment-Konzept als zentrales Thema der Arbeit vor und beleuchtet seine Bedeutung im Diskurs der Sozialen Arbeit. Sie verdeutlicht den Spannungsfeld zwischen aktivierenden Wohlfahrtsstaat und minimalem Sozialstaat sowie die relevanten Implikationen für die Soziale Arbeit im Gesundheitswesen.
- Kapitel 2: Begriffserklärung - In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffe der Arbeit, insbesondere das Empowerment-Konzept und der aktivierende Wohlfahrtsstaat, definiert und ihre theoretischen Grundlagen erläutert.
- Kapitel 3: Das Empowerment-Konzept im Rahmen der aktivierenden Gesundheitspolitik - Dieses Kapitel analysiert die Anwendung des Empowerment-Konzepts in der Gesundheitspolitik und untersucht die Potenziale und Herausforderungen dieses Ansatzes.
- Kapitel 4: Der minimale Sozialstaat - Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Einfluss des minimalen Sozialstaates auf die Anwendung des Empowerment-Konzepts in der Sozialen Arbeit und Gesundheitspolitik.
- Kapitel 5: Die Rolle der Sozialen Arbeit in einem aktivierenden Sozialstaat und in der Gesundheitspolitik - Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Sozialen Arbeit im Kontext des aktivierenden Sozialstaates und der Gesundheitspolitik, insbesondere im Hinblick auf die Rolle des Empowerments.
Schlüsselwörter
Empowerment, aktivierender Wohlfahrtsstaat, minimaler Sozialstaat, Gesundheitspolitik, Soziale Arbeit, Partizipation, Ressourcenorientierung, Selbsthilfe, Aktivierung, Gesundheitsförderung, Prävention, Rehabilitation, Inklusion, soziale Benachteiligung.
- Arbeit zitieren
- Alexandra Brunet (Autor:in), 2020, Das Empowerment-Konzept in der Gesundheitspolitik im Spannungsfeld zwischen aktivierendem Wohlfahrtsstaat und minimalem Sozialstaat, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1033807