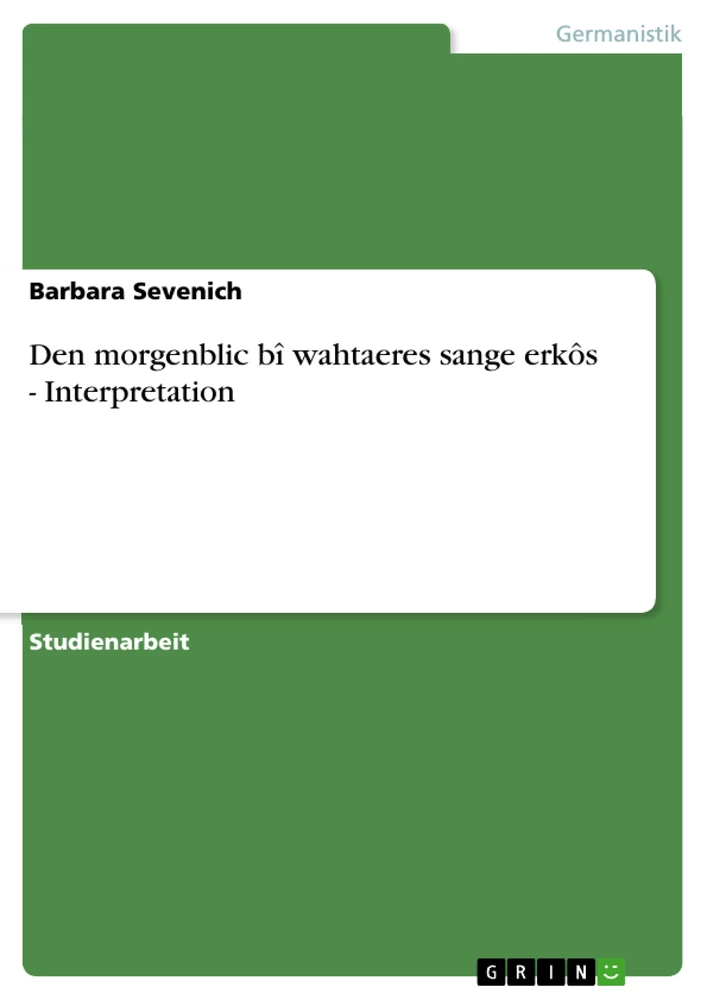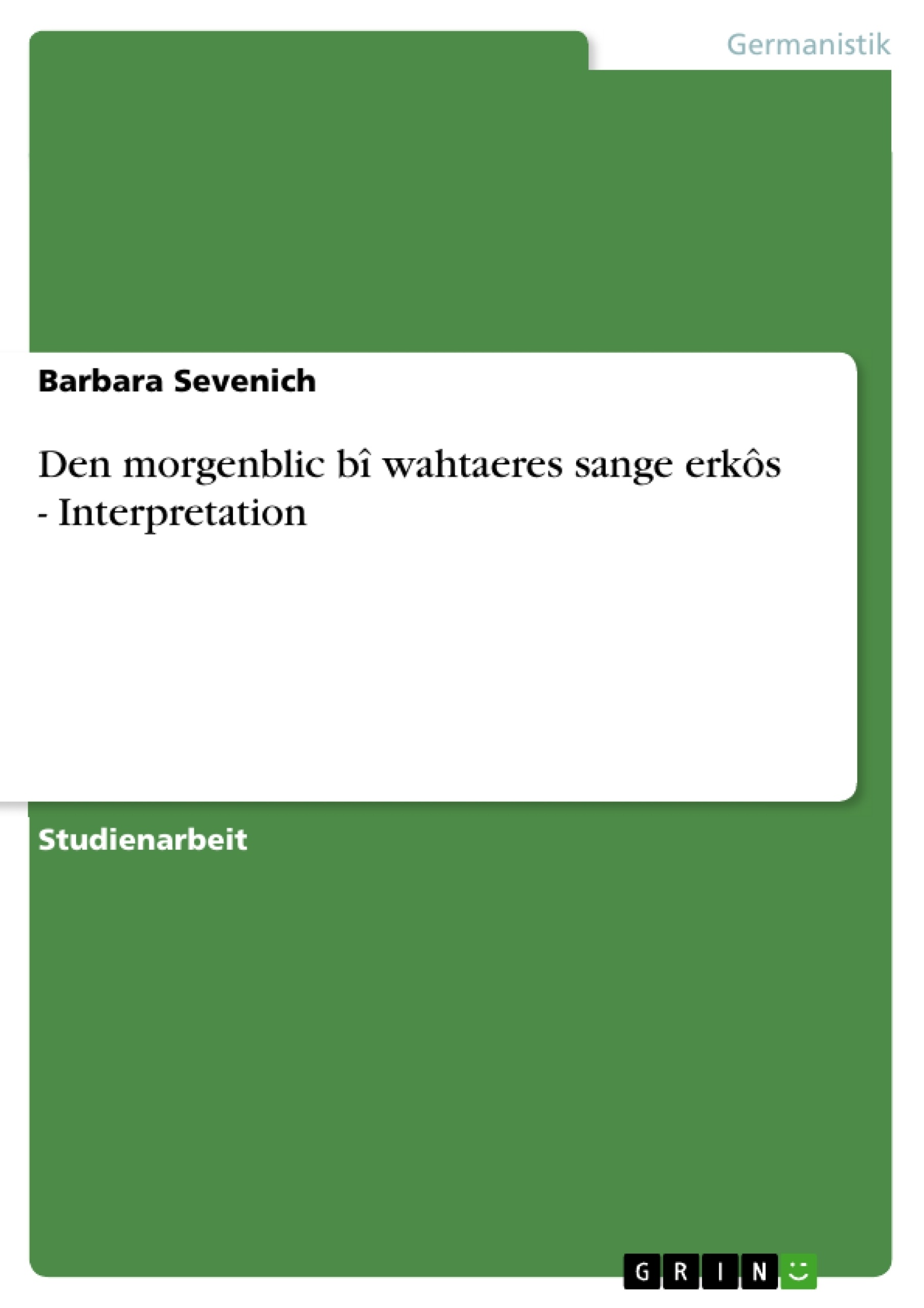1. Einleitung
Wolfram von Eschenbach, ursprünglich ein fränkischer Ritter, zählt zu den größten Dichtern und Lyrikern des Mittelalters. Seine Lebenszeit, die in Wolframs-Eschenbach begann und endete, wird mit ca. 1170 bis 1220 angegeben.
Stationen seines Lebens waren die Burg Wildenberg im Odenwald und der Hof des Land- grafen Hermann von Thüringen. Seine letzte Ruhestätte befindet sich in der Frauenkirche seines Geburtsortes, wo ihm die Ehre eines Gastgrabes zuteil wurde. Wolframs größtem Werk „Parzival“ folgten die Epen „Titurel“ und „Willehalm“. Des weite- ren sind noch acht Minnelieder, davon fünf Tagelieder, bekannt. Das von mir gewählte Lied, „Den morgenblic bî wahtaeres sange erkôs“, gehört in die Gruppe der letztgenannten Gattung, die den Abschied und die Trennung zweier Liebender im Morgengrauen nach der Liebesnacht thematisiert.
Im Folgenden soll nun dieses Lied hinsichtlich seines Inhaltes interpretiert werden. Dabei möchte ich zum einen darauf eingehen, inwieweit Wolframs Lied wirklich der allgemeinen Definition des Tageliedes folgt. Außerdem werden die Ausführungen Wapnewskis zu der Idee der Leitmotive, die eine besondere Verbindung zwischen den einzelnen Strophen dar- stellen1, Beachtung finden.
2. Interpretation
Wolframs von Eschenbach Lied beschreibt in drei Strophen die Situation des Abschied- nehmens zweier Liebender, nachdem der Tag sich zum ersten Mal bemerkbar gemacht hat.
Die erste Strophe zeigt zunächst ein Liebespaar in heimlichem Beisammensein. Dabei handelt es sich um eine Frau hohen Standes, die vrouwe, die in den Armen ihres vriundes liegt, der durch das Attribut ‘ wert ’ ihrer gesellschaftlichen Position angepaßt wird. Wenngleich dieses auch ohne Konsequenz für die Akzeptanz dieser Beziehung bleibt, da sie in den Augen der Gesellschaft Ehebruch bedeutet und somit unrecht ist. Deswegen muß im Morgengrauen auch die Trennung erfolgen, die direkt im ersten Vers sanft, aber bestimmt, vom ersten Lichtstrahl des Tages angemahnt wird. Dieser stellt außerdem von Beginn an eine immense Gefahr dar, da Licht auch die Aufdeckung der Affäre bedeuten könnte. Spätestens ab dem sechsten Vers wird einem dies deutlich, da dort die Herrin zu ihrem Klagelied anhebt. Sie soll auch die einzige bleiben, die in dieser ersten Strophe in Aktion tritt. Der Tag und ihr Geliebter sind lediglich Figuren in ihrem leid- vollen Monolog.
Sie sieht in dem Tag eine so große Macht, daß sie sogar ihre gesamte Existenz bedroht sieht. Alle Lebewesen können sich am Tag erfreuen, nur ihr und ihrem Geliebten bleibt dies vorenthalten. Sie müssen ihre Erfüllung in der Nacht finden, die in Zeiten des Mittelalters für das Unheilvolle, das Gefährliche stand. Was soll also aus ihr werden, wenn ihrem Glück nicht nur durch gesellschaftliche Konventionen , sondern sogar von der Natur Einhalt gebo- ten wird? Wapnewski bezeichnet dieses Klagen als „Tageshaß“2, was, wie schon ange- merkt, eine befremdliche Einstellung war, da mit dem Tag die furchterregende Nacht abge- schlossen wurde.
Des weiteren fällt als untypisch die nur beiläufige Nennung des Wächters auf. Diese eigentlich zentrale Figur des Tageliedes, die die Rolle des Gegenspielers zu der die Liebe repräsentierenden Frau einnimmt, wird sogar ihrer Aufgabe des Weckens und Warnens entledigt, da dies der Tag übernommen hat.
In der zweiten Strophe nimmt der Tag nun deutlich mehr Raum ein. Was in der ersten Strophe als dünner Lichtstrahl nur Vorbote des Tages war, hat nun „bestialische Züge“ angenommen, wie der „Prankengriff al durch diu venster “ zeigt.3 Die Gefährdung von außen wird immer greifbarer, was auch die konkrete Gegenmaßnahme, das Verschließen der Fenster, erklärt.4 Da dies jedoch eine unsinnige Form der Rebellion darstellt, was auch von den Liebenden erkannt wird, setzen sie dem eine Geste der Liebe, die innige Umar- mung, entgegen.
Trotz des Plurals, der in dieser Strophe zum ersten Mal benutzt wird, geht diese Geste von Seiten der Frau aus. Das Zusammengehörigkeitsgefühl wird von ihr betont, aber noch nicht aktiv mit seinem Dazutun bestätigt. Dies zeigt sich zum einen im erzählenden Teil, wo sie ihn fest an sich drückt und ihre Augen ihrer beider Wangen benetzen. Zum anderen findet man einen weiteren Anhaltspunkt in ihrer Rede, in der ein Leib-Seele-Dualismus verwendet wird. Dieses Bild der zwei Herzen und des einen Leibes stellt eine Gemeinschaft zwischen Geist und Seele dar, die zwei empfindende Gefühls- orte in einem materiellen, greifbaren Ort vereint.
Dieser starke Ausdruck für Einheit, der mit der Treue des einen für den anderen dramatisch zur grôzen liebe gesteigert wird, endet in dem relativ schlichten „... du kumest und ich zuo dir. “
Die dritte Strophe beginnt mit der einzigen direkten Aktion des Mannes, die sein aktives Auftreten mit dem Tun selber wieder zu einem Abtritt werden läßt. Er nam nämlich urloup balde alsus.
Dem Kontrast des sich Entfernens und des sich Näherkommens in den ersten drei Versen der dritten Strophe folgt ein sinnliches Bild der Gemeinsamkeit, das durch ir,sî und ir bei- der in Worte gefaßt wird. Dabei wird auch die Tatsache, daß der zuvor als Bedrohung empfundene Tag nun absolut ‘da’ ist, zur Nebensache. Man könnte es höchstens als An- passung bezeichnen, daß nun, da der Tag sich den Liebenden genähert hat, diese sich auch einander annähern.
Dieses Näherkommen schildert Wolfram anhand einer Liebesszene, die zum Sinnbild der Liebe wird. Er entwirft ein höchst erotisches Bild zweier Körper, die sich in dem Wissen der nahenden Trennung verzweifelt ineinander schlingen. Interessant ist dabei, wie Wolfram es vermeidet, nach mittelalterlichem Verständnis anstößig zu werden. Durch die Einführung der Figur des Malers „entmaterialisiert“ er das Körperliche und läßt somit keine Dreidimen- sionalität zu. D.h., er läßt seine Beschreibung nicht auf die Ebene des Naturalistischen und Wirklichen aufsteigen, sondern malt mit ihr ein Bild, das ohne voyeuristischen Beige- schmack auskommt.5
Spätestens in den letzten beiden Versen wird deutlich, daß Voyeurismus kein Thema ist, da Wolfram hier das wahrhaft Gute der Liebe durch das Handeln der Liebenden ausdrückt. Denn obwohl ir beider liebe doch vil sorgen truoc, si pfl â gen minne â n allen haz. Trotz der immensen Gefahr, derer sich das Paar deutlich bewußt ist, geben sie sich einander hin und erlauben sich, die Last und das Leid zu mißachten.
Dieser dramatische Schluß zeigt nur das Ende einer sich verdichtenden Kette und erinnert somit an die in der Einleitung benannte Idee der vier Leitmotive, die sich als roter Faden durch die Strophen ziehen.
Mit der ‘Last der Sorgen’ beendet Wolfram in der dritten Strophe das stetig gesteigerte Bild des Leidens, das in der ersten Strophe damit beginnt, daß die Herrin ihr Glück einbüßen muß. In der zweiten Strophe dann realisiert sie, daß sie und ihr Geliebter sich in ernsthafter Gefahr befinden. Der ernsthafte Aspekt wird insbesondere in Vers neun deutlich, wo zu der psychischen Bedrohung die physische kommt. Wapnewski bezeichnet diesen Aufbau vom Verlust des Glücks über den Schmerz, die Traurigkeit bis hin zur bedrückenden, allumfassenden Belastung als das „Sorge-Motiv“.
Im „Tränen-Motiv“ findet die Sorge einen Weg, Energien freizusetzen. Zunächst füllen sich die Augen der Herrin mit Tränen, sie weint aber noch nicht, da das nicht zu der eher sanften Stimmung der ersten Strophe passen würde. Dies passiert erst in der zweiten Strophe, in der ihre Augen ihrer beiden Wangen sogar beguzzen. In der dritten Strophe spricht Wolfram dann ganz schlicht von weind [ en ] ougen, was vielleicht die einfachste, dadurch aber auch die ausdrucksstärkste Wortwahl ist.
Auslöser dieses Leidens ist der Tag, der konsequent beim Namen genannt wird, um das sowieso schon um eine Figur reduzierte Tagelied - den Wächter - nicht noch einer Figur zu berauben. Dabei erfährt auch der Tag eine Steigerung in der Form seines Erscheinens. In der ersten Strophe noch der morgenblic, der in passiver Position angeklagt und geschmäht werden kann, drängt er in der zweiten Strophe schon weitaus fordernder in das Gemach der Liebenden. In der dritten Strophe ist er dann vollkommen präsent, ohne noch die Möglichkeit zu bieten, ihn wieder ausschließen zu können.
Dieser wachsenden Bedrohung ausgesetzt, steigert auch das Paar seine Zuwendungen. Je näher der Augenblick der Trennung rückt, desto inniger werden die Liebesbekundungen. Liegt die vrouwe in der ersten Strophe noch passiv in den Armen ihres werden vriundes, ergreift sie in der folgenden Strophe die Initiative und zieht ihn fest an sich heran. Die auch schon angeführte Liebesszene stellt natürlich den Höhepunkt dieses „Vereinigungs- Motives“ dar.
Bisher wurde als einziger Nachweis für die untypische Form dieses Tageliedes die Demon- tierung der Position des Wächters angeführt. Bestätigt findet sich dieses übrigens auch in den Worten der Frau. Üblich ist, daß „die Frau die Gefühle, die sie bei der Trennung emp- findet, mit spürbarem Attachement, ja zuweilen mit aggressiver Ungerechtigkeit gegenüber dem Wächter ausspricht“.6 Hier aber wird dem Tag die Aggression entgegengebracht. Er wird am Unglück des Liebespaares beschuldigt, denn er ist es schließlich, der die schützen- de Nacht zwingt zu weichen. In den Augen der Frau trifft also nicht den Wächter die Schuld; er ist uninteressant.
Des weiteren möchte ich nun aber das Augenmerk auf die Sprechrollen-Verteilung lenken, die ebenfalls Anhaltspunkt für eine untypische Gestaltung dieses Liedes ist. Die Frau ist die einzige Sprecherin; sie führt den Monolog. Vergleicht man jedoch „Den morgenblic“ mit den anderen Tageliedern bei Wapnewski7, fällt auf, daß es mit dieser einseitigen Textver- gabe eine Ausnahme ist. Auch im Vergleich mit Dietmar von Aist8, Heinrich von Morun- gen9, Otto von Botenlauben10 und Hugo von Montfort11 findet dies Bestätigung.
3. Abschluß
Abschließend läßt sich sagen, daß Wolfram von Eschenbach mit seinem Lied „Den mor- genblic bî wahtaeres sange erkôs“ ein Werk geschaffen hat, das bis heute nicht an Aktuali- tät verloren hat.
Er läßt der Frau viel Raum, was zwar nicht ungewöhnlich für den Minnesang war, jedoch nur selten so konsequent umgesetzt wurde. Wenngleich der Frau als der edlen Herrin auch bei anderen Dichtern die Rolle der Angebeten zufällt, so wird ihr doch selten quantitativ so viel Platz eingeräumt. Zumeist durften in einem Lied mehrere Figuren nebeneinander existie- ren und agieren. Hier finden die anderen Schlüsselfiguren des Tageliedes nur Beachtung, weil sie in den Gedanken und Überlegungen der Frau von zentraler Bedeutung sind.
So gesehen eine recht fortschrittliche Art der Textgestaltung, wenn man bedenkt, daß der Frau eigentlich emotionale und repräsentative Eigenschaften zugewiesen wurden.