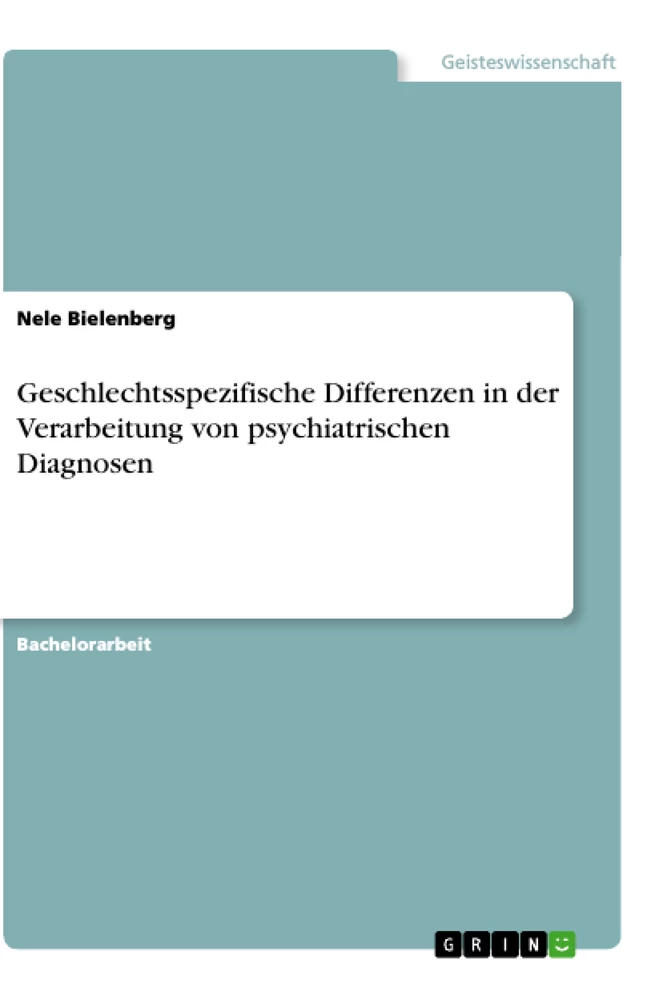Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, Unterschiede in der Verarbeitung psychiatrischer Diagnosen zwischen Männern und Frauen empirisch zu untersuchen. Die Haupthypothese lautet dementsprechend: Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede in der Verarbeitung von psychiatrischen Diagnosen. Dazu wurden Daten von 400 Probanden in einer quantitativen Studie erhoben. Als Erhebungsinstrument wurde der Hamburger Fragebogen zur Aufklärungssituation und Verarbeitung psychiatrischer Diagnosen eingesetzt (HAVD), mit dem sechs Dimensionen der Verarbeitung gemessen werden (Empowerment, positive Klärung und Selbstakzeptanz, Sinngebung und inneres Wachstum, Überidentifikation, Selbststigmatisierung und Funktionalisierung). Die Ergebnisse wurden mithilfe des Datenverarbeitungsprogramms IBM SPSS Statistics 25 ausgewertet. Dazu wurden mit der einfaktoriellen Varianzanalyse und Kontrasttests signifikante Unterschiede ermittelt. Die Ergebnisse zeigen einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Verarbeitung einer psychiatrischen Diagnose. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Frauen ihre Diagnosen eher funktional verarbeiten, Männer hingegen eher dysfunktional. Die Bachelorarbeit ist sowohl hinsichtlich der Geschlechterforschung und der Verarbeitungsmechanismen, als auch im psychotherapeutischen Kontext interessant.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Psychiatrische Diagnosen
- 2.2 Folgen einer psychiatrischen Diagnose
- 2.2.1 Selbststigmatisierung
- 2.2.2 Überidentifikation
- 2.2.3 Funktionalisierung
- 2.2.4 Empowerment
- 2.2.5 Positive Klärung und Selbstakzeptanz
- 2.2.6 Sinngebung und inneres Wachstum
- 2.3 Geschlechtsspezifische Differenzen
- 2.3.1 Der Ursprung der Geschlechtsunterschiede
- 2.3.2 Geschlechterdifferenzen in Bezug auf psychische Erkrankungen
- 2.4 Stand der Forschung
- 2.5 Hypothesen
- 3 Methoden
- 3.1 Stichprobe
- 3.2 Erhebungsinstrument
- 3.2.1 HAVD
- 3.2.2 Bewertung des HAVD
- 3.3 Durchführung
- 3.4 Untersuchungsdesign und angewandte statistische Verfahren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit zielt darauf ab, empirisch zu untersuchen, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Verarbeitung von psychiatrischen Diagnosen gibt.
- Untersuchung geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Verarbeitung psychiatrischer Diagnosen.
- Analyse von sechs Dimensionen der Verarbeitung: Empowerment, positive Klärung und Selbstakzeptanz, Sinngebung und inneres Wachstum, Überidentifikation, Selbststigmatisierung und Funktionalisierung.
- Einbezug der Theorie der Selbststigmatisierung und deren Einfluss auf die Verarbeitung psychiatrischer Diagnosen.
- Bedeutung der Funktionalisierung und Dysfunktionalisierung von Diagnosen im Kontext von Geschlechtsspezifischen Unterschieden.
- Relevanz der Forschungsergebnisse für die psychotherapeutische Praxis und die Geschlechterforschung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Verarbeitung psychiatrischer Diagnosen ein und erläutert die Relevanz des Forschungsfeldes. Das zweite Kapitel bietet einen theoretischen Hintergrund mit einer umfassenden Beschreibung von psychiatrischen Diagnosen, ihren Folgen, insbesondere der Selbststigmatisierung, Überidentifikation, Funktionalisierung, Empowerment, positiven Klärung und Selbstakzeptanz sowie Sinngebung und innerem Wachstum. Darüber hinaus beleuchtet es den Ursprung der Geschlechtsunterschiede und diskutiert Geschlechterdifferenzen in Bezug auf psychische Erkrankungen.
Das dritte Kapitel beschreibt die Methodik der Studie, die Stichprobe, das Erhebungsinstrument, die Durchführung und das Untersuchungsdesign, einschließlich der angewandten statistischen Verfahren.
Schlüsselwörter
Psychiatrische Diagnosen, Geschlechtsspezifische Unterschiede, Verarbeitung, Selbststigmatisierung, Überidentifikation, Funktionalisierung, Empowerment, positive Klärung, Selbstakzeptanz, Sinngebung, inneres Wachstum, Geschlechterforschung, Psychotherapie.
- Quote paper
- Nele Bielenberg (Author), 2019, Geschlechtsspezifische Differenzen in der Verarbeitung von psychiatrischen Diagnosen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1034927