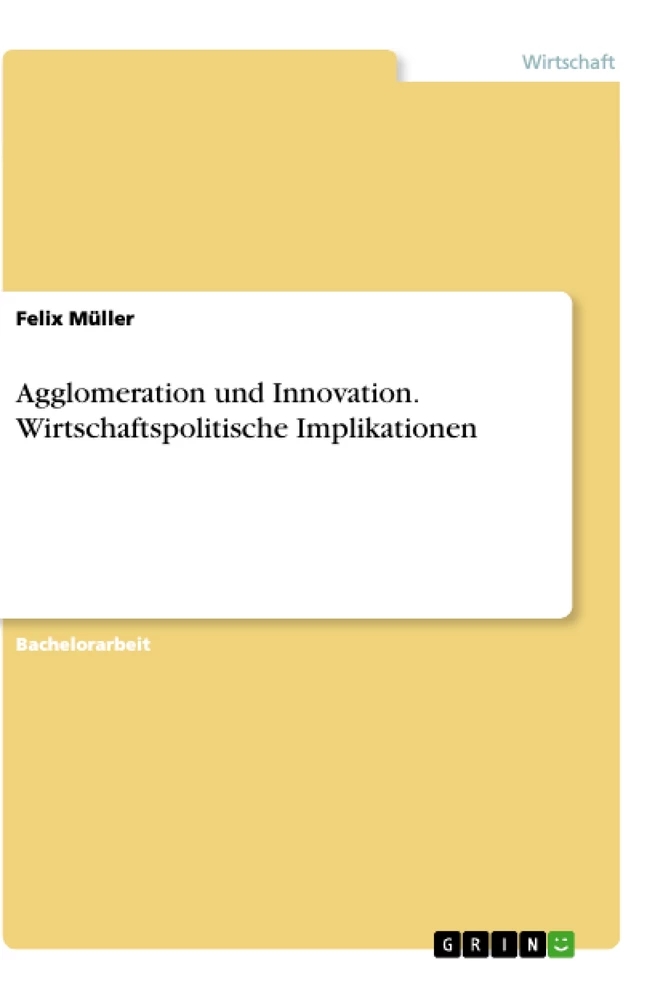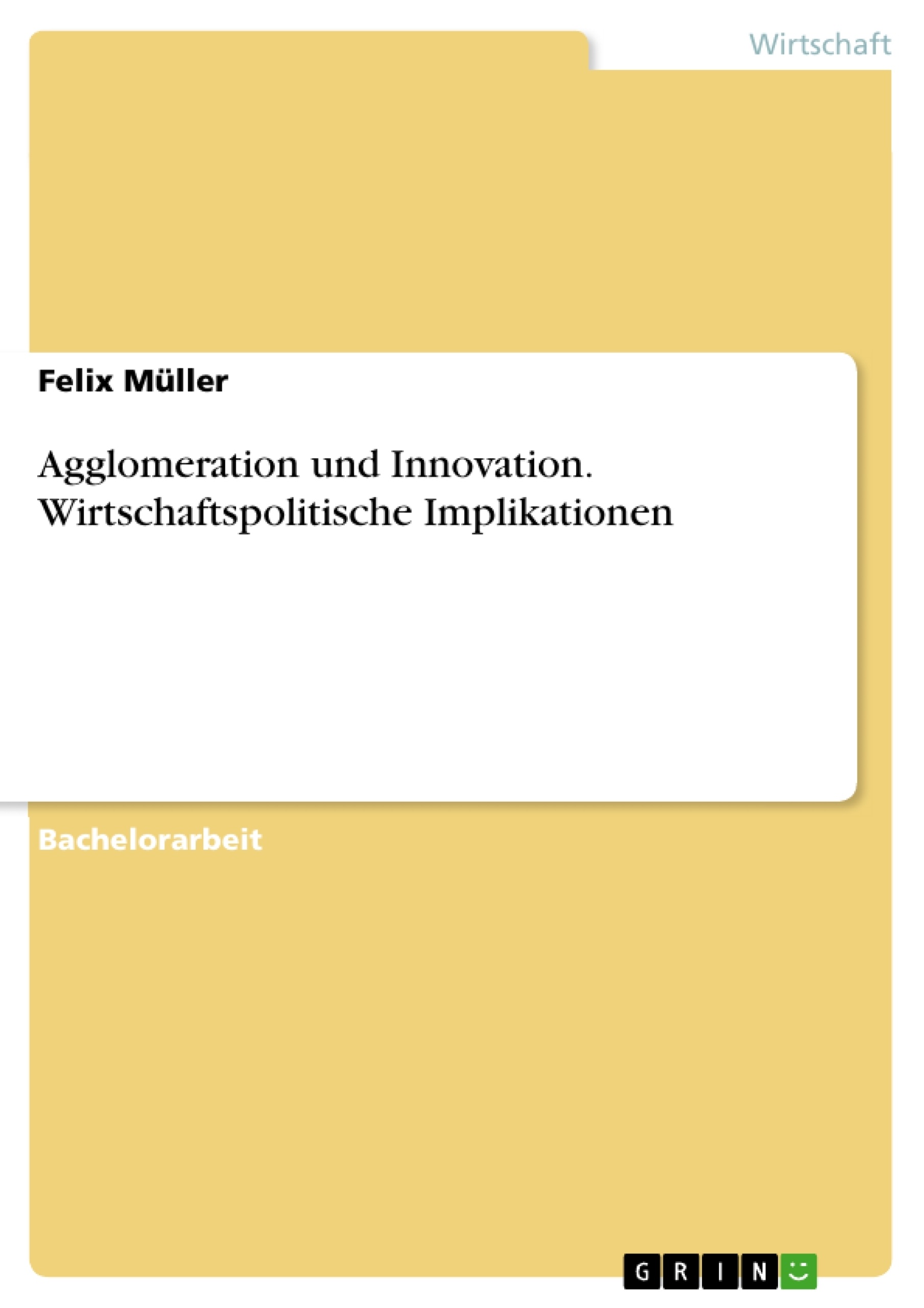Die theoretischen und empirischen Forschungsansätze über die Beziehung zwischen Agglomeration und Innovation werden in dieser Arbeit betrachtet. Mehrere Studien haben gezeigt, dass eine geographische Konzentration die Produktivität fördert und letztendlich Wirtschaftswachstum stimuliert. Das wohl bekannteste Beispiel hierzu ist Silicon Valley. Doch wie genau laufen diese Prozesse ab? Bis heute wird versucht, diese „black box“ zu entschlüsseln, doch bisher scheint dies nicht vollständig gelungen zu sein. Generell haben sich ein paar grundlegende Determinanten der Agglomeration herauskristallisiert. Die bedeutendsten sind dabei die sogenannten Wissens-Spillover. Dabei spielen auch Pooling-Prozesse auf Arbeitsmärkten und Input-Sharing eine entscheidende Rolle. Weiter scheinen Quellen natürlicher Ressourcen ebenso einen Beitrag zu leisten. Agglomeration bringt zudem auch negative Effekte mit sich. So zeigen aktuellere Studien, dass eine Überauslastung letztendlich den Nutzen der geographischen Konzentration schmälern kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Literatur
- 3. Agglomeration und Innovation
- 3.1 Was sind Innovationen?
- 3.2 Messung von Innovationen
- 3.2.1 Investitionen im Innovationsprozess
- 3.2.2 Patente
- 3.2.3 Weitere Indikatoren
- 3.3 Bestimmungsfaktoren der Agglomeration
- 3.3.1 First-nature Causes
- 3.3.2 Second-nature Causes
- 3.3.2.1 Pekuniäre Effekte
- 3.3.2.1.1 Innerbetriebliche Skaleneffekte
- 3.3.2.1.2 Lokalisierungseffekte
- 3.3.2.1.3 Urbanisierungseffekte
- 3.3.2.2 Nicht-pekuniäre Effekte
- 3.3.2.2.1 MAR-Externalitäten
- 3.3.2.2.2 Porter-Externalitäten
- 3.3.2.2.3 Jacob-Externalitäten
- 3.3.2.1 Pekuniäre Effekte
- 3.4 Datengrundlage und Regressionsstrategien
- 3.5 Empirische Ergebnisse
- 3.5.1 Welche Industrien weisen eine räumliche Konzentration auf?
- 3.5.2 Bestimmungsfaktoren
- 3.5.2.1 Beschäftigungsdichte und Stadtgröße
- 3.5.2.1.1 Konzept der pekuniären Wissens-Spillover
- 3.5.2.1.1.1 Das Modell
- 3.5.2.1.1.2 Ergebnisse
- 3.5.2.1.1 Konzept der pekuniären Wissens-Spillover
- 3.5.2.2 Lokale Forschungsinputs
- 3.5.2.3 Schutz von Betriebsgeheimnissen
- 3.5.2.3.1 Ein Zwei-Perioden-Modell
- 3.5.2.3.1.1 Die erste Periode
- 3.5.2.3.1.2 Die zweite Periode
- 3.5.2.3.1.3 Ergebnisse
- 3.5.2.3.1 Ein Zwei-Perioden-Modell
- 3.5.2.4 Entrepreneurship und Firmengröße
- 3.5.2.5 Natürliche Vorteile
- 3.5.2.6 Lokaler Wettbewerb und Vielfalt
- 3.5.2.7 Input-Sharing und Matching
- 3.5.2.1 Beschäftigungsdichte und Stadtgröße
- 3.5.3 Geographische Konzentration als dynamischer Prozess
- 4. Wirtschaftspolitische Implikationen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Agglomeration und Innovation. Ziel ist es, die Bestimmungsfaktoren räumlicher Konzentrationen innovativer Industrien zu identifizieren und empirisch zu analysieren. Die Arbeit trägt zum Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen räumlicher Struktur und Innovation bei.
- Messung und Definition von Innovation
- Pekuniäre und nicht-pekuniäre Effekte der Agglomeration
- Empirische Analyse der räumlichen Konzentration innovativer Industrien
- Wirtschaftspolitische Implikationen der Ergebnisse
- Geographische Konzentration als dynamischer Prozess
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Agglomeration und Innovation ein und skizziert den Forschungsstand. Es definiert die zentralen Begriffe und erläutert die Forschungsfrage der Arbeit. Die Einleitung begründet die Relevanz der Untersuchung und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
3. Agglomeration und Innovation: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es beginnt mit einer Definition von Innovation und der Darstellung verschiedener Messmethoden. Anschließend werden die Bestimmungsfaktoren von Agglomeration detailliert untersucht, wobei zwischen "first-nature" und "second-nature" Ursachen unterschieden wird. Die "second-nature" Ursachen werden weiter in pekuniäre und nicht-pekuniäre Effekte unterteilt, die jeweils mit Unterpunkten ausführlich behandelt werden. Die empirischen Ergebnisse werden mittels Regressionsanalysen präsentiert und interpretiert. Die Analyse betrachtet verschiedene Industrien und Faktoren wie Beschäftigungsdichte, lokale Forschungsinputs, Schutz von Betriebsgeheimnissen, Entrepreneurship, natürliche Vorteile, lokalen Wettbewerb und Input-Sharing. Schließlich wird die geographische Konzentration als dynamischer Prozess diskutiert, der sich im Zeitverlauf entwickelt.
4. Wirtschaftspolitische Implikationen: Dieses Kapitel diskutiert die wirtschaftspolitischen Konsequenzen der im vorherigen Kapitel gewonnenen Ergebnisse. Es werden mögliche wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Förderung von Innovation und Agglomeration abgeleitet und deren Wirksamkeit bewertet. Das Kapitel analysiert wie die Ergebnisse der Arbeit für die Gestaltung einer innovationsfreundlichen Wirtschaftspolitik genutzt werden können.
Schlüsselwörter
Agglomeration, Innovation, räumliche Konzentration, Wissens-Spillover, Pekuniäre Externalitäten, Nicht-pekuniäre Externalitäten, Empirische Analyse, Regressionsanalyse, Wirtschaftspolitik.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Agglomeration und Innovation
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Agglomeration und Innovation. Das zentrale Thema ist die Identifizierung und empirische Analyse der Bestimmungsfaktoren räumlicher Konzentrationen innovativer Industrien. Ziel ist es, das komplexe Zusammenspiel von räumlicher Struktur und Innovation besser zu verstehen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Messung und Definition von Innovation, pekuniäre und nicht-pekuniäre Effekte der Agglomeration, empirische Analyse der räumlichen Konzentration innovativer Industrien, wirtschaftspolitische Implikationen der Ergebnisse und die Betrachtung der geographischen Konzentration als dynamischen Prozess.
Wie wird Innovation in der Arbeit gemessen und definiert?
Die Arbeit definiert zunächst den Begriff „Innovation“ und beschreibt verschiedene Messmethoden. Dazu gehören Investitionen im Innovationsprozess, Patente und weitere relevante Indikatoren. Die genaue Vorgehensweise wird im Kapitel 3 detailliert erläutert.
Welche Faktoren beeinflussen die Agglomeration von innovativen Industrien?
Die Arbeit unterscheidet zwischen „first-nature“ und „second-nature“ Ursachen der Agglomeration. Die „second-nature“ Ursachen werden weiter in pekuniäre (z.B. innerbetriebliche Skaleneffekte, Lokalisierungseffekte, Urbanisierungseffekte) und nicht-pekuniäre Effekte (z.B. MAR-, Porter- und Jacob-Externalitäten) unterteilt. Diese Faktoren werden im Detail analysiert.
Welche Methoden werden zur empirischen Analyse verwendet?
Die empirische Analyse basiert auf Regressionsanalysen. Die Arbeit untersucht verschiedene Industrien und Faktoren wie Beschäftigungsdichte, Stadtgröße, lokale Forschungsinputs, Schutz von Betriebsgeheimnissen, Entrepreneurship, natürliche Vorteile, lokalen Wettbewerb und Input-Sharing. Ein Zwei-Perioden-Modell wird verwendet, um den Einfluss des Schutzes von Betriebsgeheimnissen zu analysieren.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Analyse?
Die empirischen Ergebnisse zeigen, welche Industrien eine räumliche Konzentration aufweisen und welche Faktoren diese Konzentration beeinflussen. Die Arbeit analysiert den Einfluss von pekuniären Wissens-Spillover-Effekten, lokalen Forschungsinputs und anderen Faktoren auf die räumliche Verteilung innovativer Aktivitäten. Die Ergebnisse werden im Detail im Kapitel 3.5 präsentiert.
Welche wirtschaftspolitischen Implikationen ergeben sich aus den Ergebnissen?
Das Kapitel 4 diskutiert die wirtschaftspolitischen Konsequenzen der empirischen Ergebnisse. Es werden mögliche wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Förderung von Innovation und Agglomeration abgeleitet und deren Wirksamkeit bewertet. Die Arbeit analysiert, wie die Ergebnisse für die Gestaltung einer innovationsfreundlichen Wirtschaftspolitik genutzt werden können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Agglomeration, Innovation, räumliche Konzentration, Wissens-Spillover, Pekuniäre Externalitäten, Nicht-pekuniäre Externalitäten, Empirische Analyse, Regressionsanalyse und Wirtschaftspolitik.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Literatur, ein zentrales Kapitel zur Agglomeration und Innovation, ein Kapitel zu wirtschaftspolitischen Implikationen und ein Fazit. Das Kapitel zur Agglomeration und Innovation ist in mehrere Unterkapitel unterteilt, die die verschiedenen Aspekte der Thematik detailliert behandeln.
- Quote paper
- Felix Müller (Author), 2015, Agglomeration und Innovation. Wirtschaftspolitische Implikationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1035019