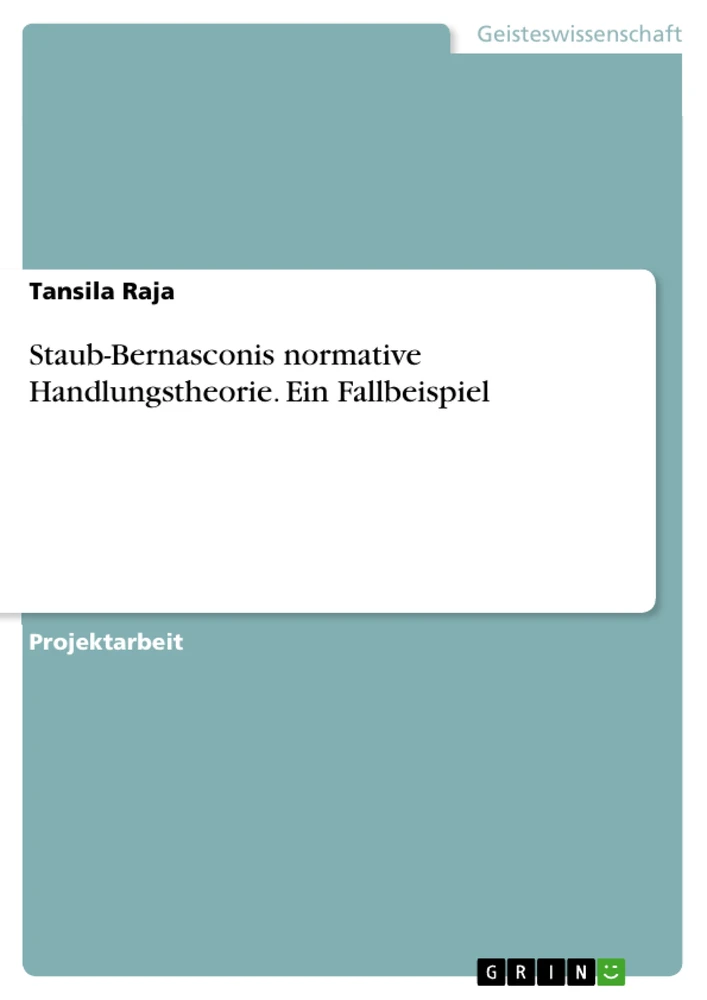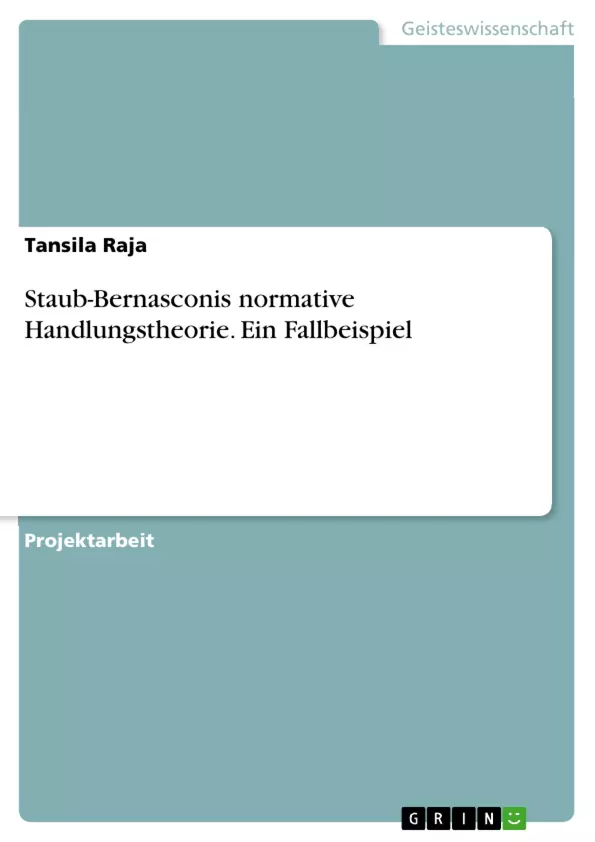Für meine Projektarbeit habe ich mir einen Fall aus meiner Tätigkeit als Schulbegleitung herausgesucht. Die Komplexität und Widersprüchlichkeit der Wirklichkeit erfordert eine wissenschaftliche Metatheorie, die mehrere Wissensformen miteinander verknüpft, welche ich unten aufführend in Klammern nennen werde. Um einen besseren Einblick in den Fall zu ermöglichen werde ich meine Ausarbeitung anhand der normativen Handlungstheorie von Silvia Staub-Bernasconi bearbeiten, welche sich in drei Schritte zusammenfassen lässt: 1) Kenntnisnahme des Forschungsgegenstandes und hierzu möglicher ,,nomologischer Aussagen‘‘ zu einem sozialen Problem (1. Gegenstandswissen- oder Zustandswissen (Was ist los?) und 2. Erklärungswissen (Warum?)), 2) Formulierung ,,nomopragmatischer, handlungsorientierter Hypothesen‘‘ der zu erreichenden Zielzustände (3. Werte- oder Kriterienwissen (Woraufhin soll verändert werden?)) und 3) Formulierung professioneller Handlungsregeln und ihrer abschließenden Wirkungsbewertung (4. Verfahrenswissen (Wie?) und 5. Evaluationswissen (Was ist geschehen?)).
- Quote paper
- Tansila Raja (Author), 2019, Staub-Bernasconis normative Handlungstheorie. Ein Fallbeispiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1035251