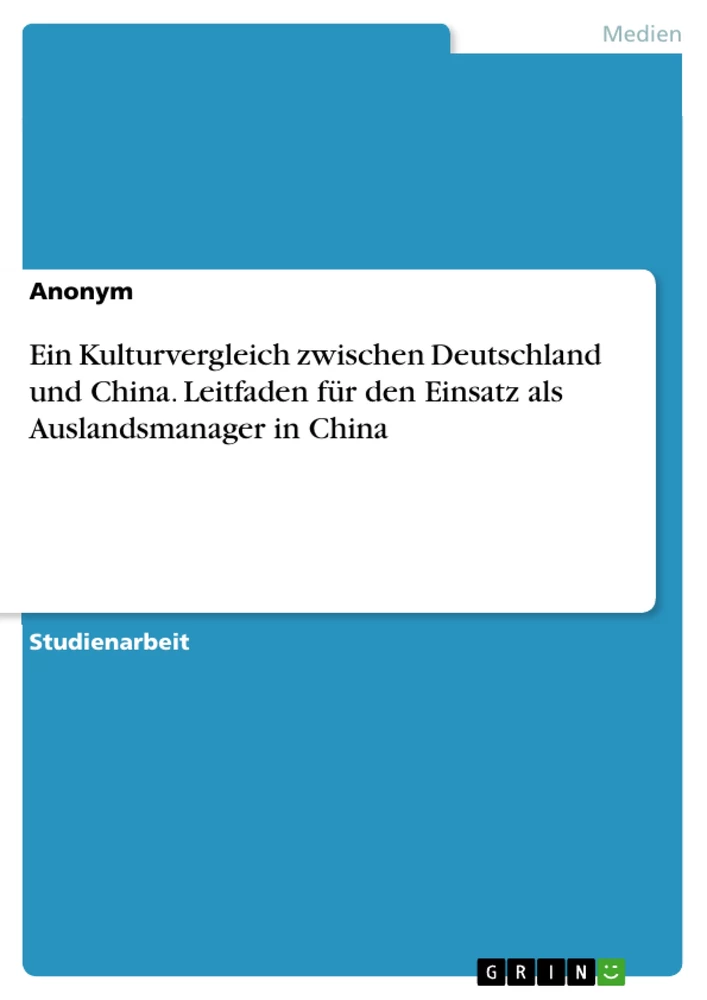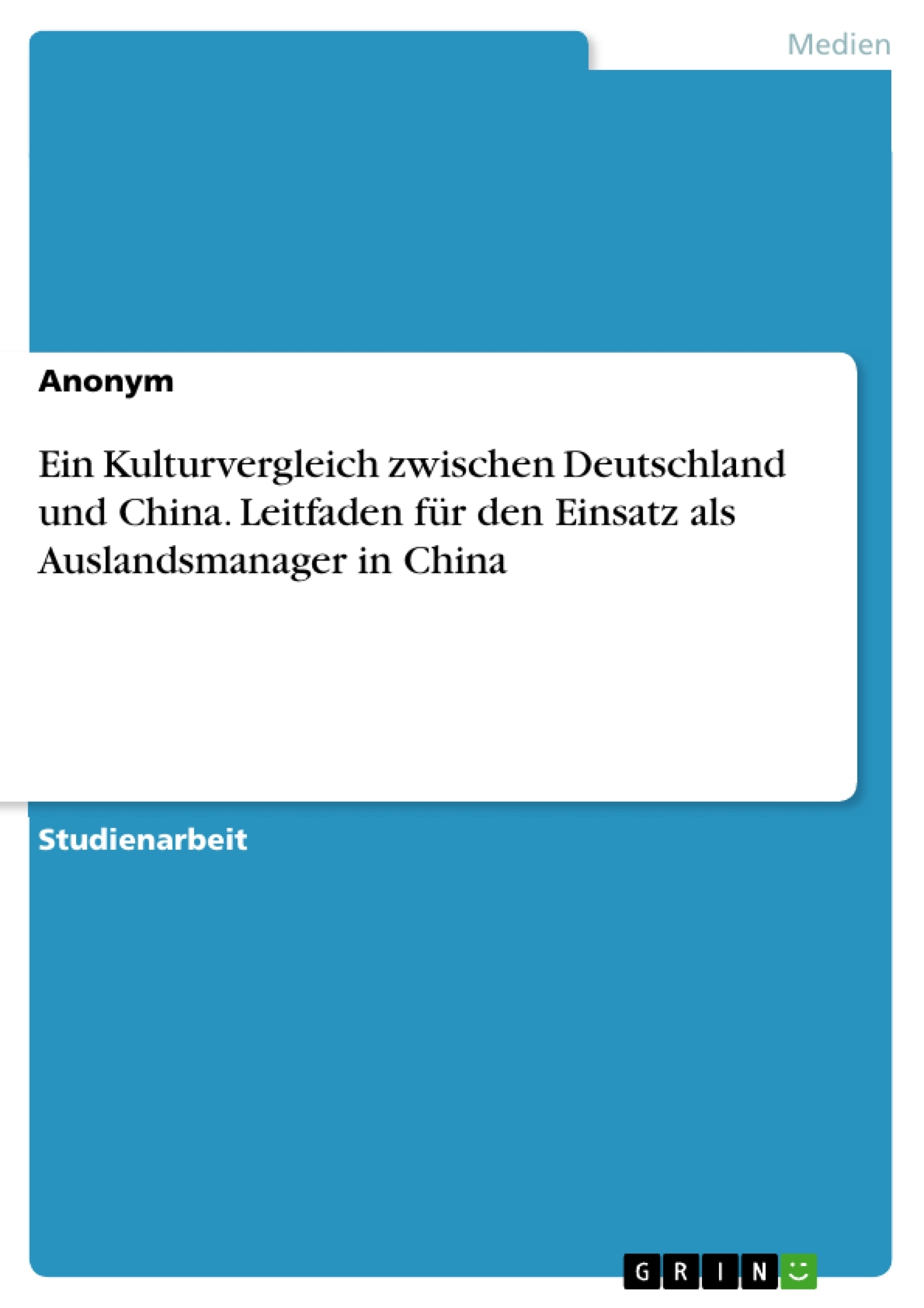Diese Projektarbeit wurde aus Sicht eines Unternehmens geschrieben, das einen neuen Standort in Beijing aufbaut und nun Mitarbeiter dorthin entsendet. Deren Aufgaben umfassen die Mitarbeiterführung vor Ort, den Kontakt mit Zulieferern und Kunden sowie mit den chinesischen Behörden. Die Mitarbeiter fungieren als Vermittler zwischen diesen beiden Kulturen. Dafür bedarf es eines besonderen Maßes an interkultureller Sensibilität, um ein erfolgreiches Miteinander verschiedener Kulturen zu schaffen. Das Ziel dieses Leitfadens ist, die entsendeten Mitarbeiter bestmöglich auf den Aufenthalt in China vorzubereiten. Zu diesem Zweck werden die Unterschiede der chinesischen Kultur im Vergleich zur deutschen Kultur aufgezeigt und konkrete Handlungsempfehlungen mitgegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Chinesische Kultur
- Was ist eine Kultur?
- Kulturdimensionen nach Hofstede
- Machtdistanz
- Individualismus/Kollektivismus
- Unsicherheitsvermeidung
- Maskulinität/Femininität
- Zeitorientierung
- Nachgiebigkeit
- Kulturdimensionen nach Hall
- Raumorientierung
- Kontextbezug in der Kommunikation
- Zeitorientierung
- Informationsgeschwindigkeit
- Kulturdimension nach Rotter
- Handlungsempfehlungen
- Die Begrüßung
- Teamarbeit und Feedback Runden
- Vertragsabschluss
- Fazit und Ausblick
- Anhang zum Leitfaden
- Kalender
- Weitere Kurse
- Hilfreiche Links
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Leitfaden zielt darauf ab, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihren Einsatz in China vorzubereiten und sie während ihres Aufenthaltes zu begleiten. Er soll die Unterschiede zwischen der chinesischen und der deutschen Kultur aufzeigen und konkrete Handlungsempfehlungen liefern, um kulturelle Herausforderungen zu meistern. Der Leitfaden konzentriert sich dabei auf die Besonderheiten der Region um Beijing und Hebei.
- Kulturvergleich Deutschland - China
- Interkulturelle Sensibilität und Handlungskompetenz
- Kulturdimensionen nach Hofstede und Hall
- Kulturelle Unterschiede in der Kommunikation und Zusammenarbeit
- Praktische Handlungsempfehlungen für den interkulturellen Austausch
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort
Der Leitfaden erläutert den Hintergrund des Projekts, die Bedeutung des chinesischen Marktes für das Unternehmen und die Ziele des Programms „Neuer Markt - neue Chancen und Herausforderungen“. Er hebt die Bedeutung von interkultureller Sensibilität für den Erfolg von Auslandsmanagementaufgaben hervor.
Chinesische Kultur
Dieses Kapitel definiert Kultur als ein Zusammenspiel von geteilten Werten, Überzeugungen und Interpretationen. Es stellt die Kulturdimensionen nach Hofstede und Hall vor und erläutert deren Anwendung auf den Vergleich zwischen Deutschland und China. Darüber hinaus werden Besonderheiten der chinesischen Kultur im Kontext des Projekts, z.B. die kulturelle Heterogenität, beleuchtet.
Handlungsempfehlungen
Dieses Kapitel bietet konkrete Tipps und Empfehlungen für die Bewältigung kultureller Herausforderungen im interkulturellen Kontext. Es konzentriert sich auf Themen wie die Begrüßung, Teamarbeit, Feedback-Runden und Vertragsabschlüsse.
Fazit und Ausblick
Dieses Kapitel fasst die Kernaussagen des Leitfadens zusammen und bietet einen Ausblick auf weitere Möglichkeiten des interkulturellen Austauschs.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kompetenz, Kulturdimensionen, Hofstede, Hall, Deutschland, China, Beijing, Hebei, Handlungsempfehlungen, Kommunikation, Zusammenarbeit, Auslandsmanagement, Vertragsabschluss, Kulturvergleich, Kulturunterschiede.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Ein Kulturvergleich zwischen Deutschland und China. Leitfaden für den Einsatz als Auslandsmanager in China, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1036136