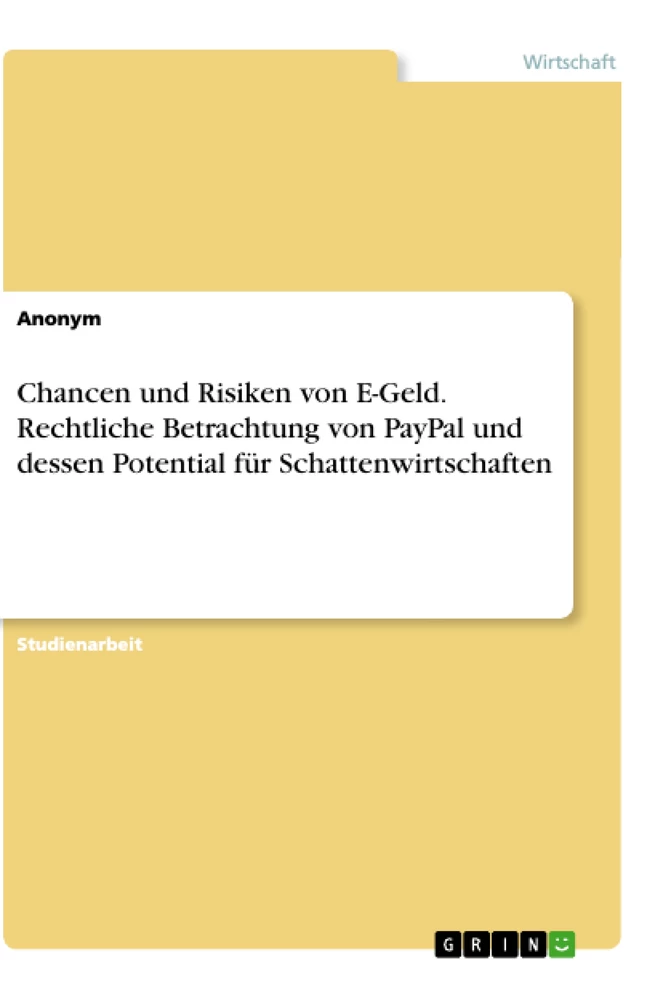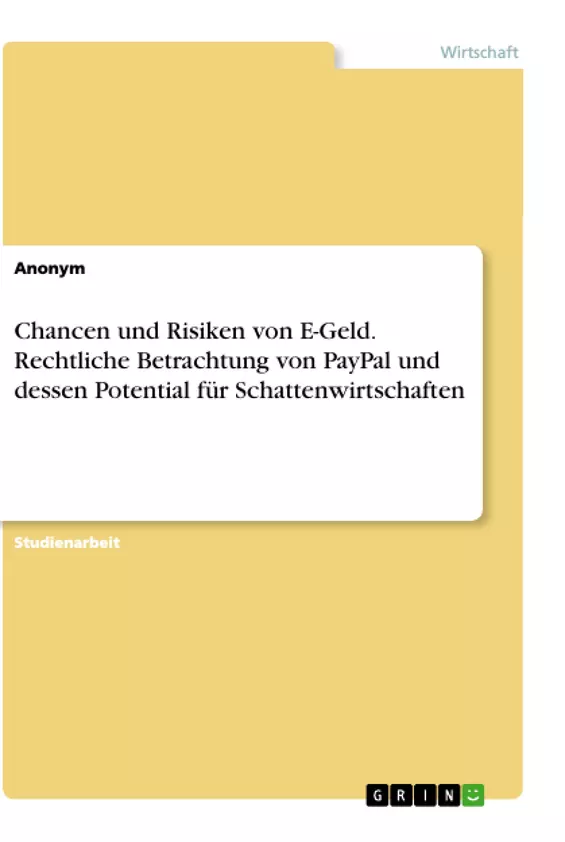Im Rahmen dieser Hausarbeit möchte ich mich näher mit den gesetzlichen Anforderungen an E-Geld-Institute auseinandersetzen. Da die Alternativen zu Bargeld sehr umfangreich sind, soll diese Hausarbeit eine rechtliche Betrachtung von E-Geld-Instituten und ihrem Potential für Geldwäsche am Beispiel von PayPal sein.
Begonnen wird damit, die begrifflichen Grundlagen zu schaffen. Danach wird der rechtliche Rahmen für E-Geld-Institute näher beleuchtet. Dafür möchte ich die EU-Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinie 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG näher betrachten. Aufbauend darauf folgt eine nähere Betrachtung der Geldwäschegesetze in Deutschland. Dafür wird die Funktionsweise anhand des dreigliedrigen Phasenmodells erläutert und die Möglichkeiten für die Geldwäsche mit PayPal aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Grundlagen
- Alternative Bezahlverfahren
- Electronic Purse
- Electronic Wallet
- Mobile Payment
- Elektronisches Geld (E-Geld)
- E-Geld Institut
- BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- Alternative Bezahlverfahren
- Rechtliche Grundlagen
- EU-Richtlinie 2009/110/EG
- Geldwäsche Regelung
- PayPal
- Funktionsweise von PayPal
- PayPal Käuferschutz
- Vertragstypen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die rechtlichen Anforderungen an E-Geld-Institute und deren Potenzial für Geldwäsche, am Beispiel von PayPal. Die Arbeit beleuchtet begriffliche Grundlagen, den rechtlichen Rahmen (insbesondere die EU-Richtlinie 2009/110/EG und Geldwäschegesetze), und die Funktionsweise von PayPal inklusive des Käuferschutzes.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung von alternativen Bezahlverfahren
- Rechtliche Rahmenbedingungen für E-Geld-Institute und deren Regulierung
- Analyse der Funktionsweise von PayPal als E-Geld-Institut
- Bewertung des Risikos von Geldwäsche im Zusammenhang mit PayPal
- Untersuchung des PayPal-Käuferschutzes und dessen rechtliche Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der bargeldlosen Zahlungssysteme ein und erläutert die steigende Bedeutung von E-Geld im Kontext des wachsenden E-Commerce. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentrale Fragestellung, die sich mit den rechtlichen Anforderungen an E-Geld-Institute und deren Anfälligkeit für Geldwäsche befasst, wobei PayPal als Fallbeispiel dient. Die Einleitung hebt die Notwendigkeit einer rechtlichen Betrachtung von E-Geld-Instituten und deren Potenzial für Geldwäsche hervor und skizziert die Methodik der Arbeit.
Begriffliche Grundlagen: Dieses Kapitel legt die begrifflichen Grundlagen für das Verständnis von E-Geld und alternativen Bezahlverfahren. Es differenziert zwischen klassischen und alternativen Bezahlmethoden, wobei Kartenzahlungen, Lastschriftverfahren etc. als etablierte Methoden eingeordnet werden. Im Kern werden verschiedene Arten elektronischer Geldbörsen wie Electronic Purse und Electronic Wallet erklärt, und die Funktionsweise von Mobile Payment angesprochen. Die Beschreibungen umfassen die Unterschiede in der Speicherung des E-Gelds (Chipkarte vs. Server), die Aufladeverfahren und die jeweiligen Vor- und Nachteile.
Rechtliche Grundlagen: Hier werden die relevanten rechtlichen Grundlagen, insbesondere die EU-Richtlinie 2009/110/EG über E-Geld-Institute und die deutschen Geldwäschegesetze, analysiert. Das Kapitel beleuchtet die regulatorischen Anforderungen an E-Geld-Institute, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für deren Betrieb und Aufsicht zu definieren. Der Fokus liegt auf der Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche. Die Analyse der Rechtslage bildet die Basis für die spätere Betrachtung von PayPal.
PayPal: Dieses Kapitel analysiert PayPal als konkretes Beispiel eines E-Geld-Instituts. Es erläutert detailliert die Funktionsweise von PayPal, die verschiedenen Vertragstypen zwischen Käufer und Verkäufer, und insbesondere den PayPal-Käuferschutz. Die Analyse umfasst die Abwicklung von Zahlungen, die Rolle des Käuferschutzes und die damit verbundenen rechtlichen Implikationen im Vergleich zum BGB. Es wird untersucht, wie der Käuferschutz potenzielle Konflikte mit dem bürgerlichen Recht löst.
Schlüsselwörter
E-Geld, alternative Bezahlverfahren, PayPal, EU-Richtlinie 2009/110/EG, Geldwäsche, E-Geld-Institut, Electronic Purse, Electronic Wallet, Mobile Payment, Rechtliche Regulierung, Käuferschutz, Finanzdienstleistungsaufsicht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Rechtliche Anforderungen an E-Geld-Institute und deren Potenzial für Geldwäsche am Beispiel von PayPal
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die rechtlichen Anforderungen an E-Geld-Institute und deren Anfälligkeit für Geldwäsche, anhand von PayPal als Fallbeispiel. Sie beleuchtet begriffliche Grundlagen, den rechtlichen Rahmen (EU-Richtlinie 2009/110/EG und Geldwäschegesetze) und die Funktionsweise von PayPal inklusive Käuferschutz.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Begriffsbestimmung und Abgrenzung alternativer Bezahlverfahren, die rechtlichen Rahmenbedingungen für E-Geld-Institute und deren Regulierung, die Analyse der Funktionsweise von PayPal, die Bewertung des Geldwäscherisikos im Zusammenhang mit PayPal und die Untersuchung des PayPal-Käuferschutzes und dessen rechtlicher Implikationen.
Welche begrifflichen Grundlagen werden erläutert?
Die Arbeit erklärt und differenziert verschiedene Arten elektronischer Geldbörsen (Electronic Purse, Electronic Wallet), Mobile Payment, Elektronisches Geld (E-Geld) und E-Geld-Institute. Sie beschreibt Unterschiede in der E-Geld-Speicherung, Aufladeverfahren und Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren.
Welche rechtlichen Grundlagen werden analysiert?
Die relevanten rechtlichen Grundlagen sind die EU-Richtlinie 2009/110/EG über E-Geld-Institute und die deutschen Geldwäschegesetze. Die Analyse fokussiert auf die regulatorischen Anforderungen an E-Geld-Institute und die Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche.
Wie wird PayPal in der Arbeit behandelt?
PayPal wird als konkretes Beispiel eines E-Geld-Instituts detailliert analysiert. Die Funktionsweise, verschiedene Vertragstypen, der PayPal-Käuferschutz und dessen rechtliche Implikationen im Vergleich zum BGB werden untersucht. Der Fokus liegt auf der Abwicklung von Zahlungen und der Konfliktlösung durch den Käuferschutz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Begrifflichen Grundlagen, ein Kapitel zu den Rechtlichen Grundlagen, ein Kapitel zu PayPal und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aspekten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: E-Geld, alternative Bezahlverfahren, PayPal, EU-Richtlinie 2009/110/EG, Geldwäsche, E-Geld-Institut, Electronic Purse, Electronic Wallet, Mobile Payment, Rechtliche Regulierung, Käuferschutz, Finanzdienstleistungsaufsicht.
Welche Fragestellung steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Fragestellung befasst sich mit den rechtlichen Anforderungen an E-Geld-Institute und deren Anfälligkeit für Geldwäsche, wobei PayPal als Fallbeispiel dient.
Wie ist der Aufbau der Hausarbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik einführt und den Aufbau erläutert. Es folgen Kapitel zu den Begrifflichen und Rechtlichen Grundlagen, eine detaillierte Analyse von PayPal und abschließend ein Fazit.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2018, Chancen und Risiken von E-Geld. Rechtliche Betrachtung von PayPal und dessen Potential für Schattenwirtschaften, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1037462