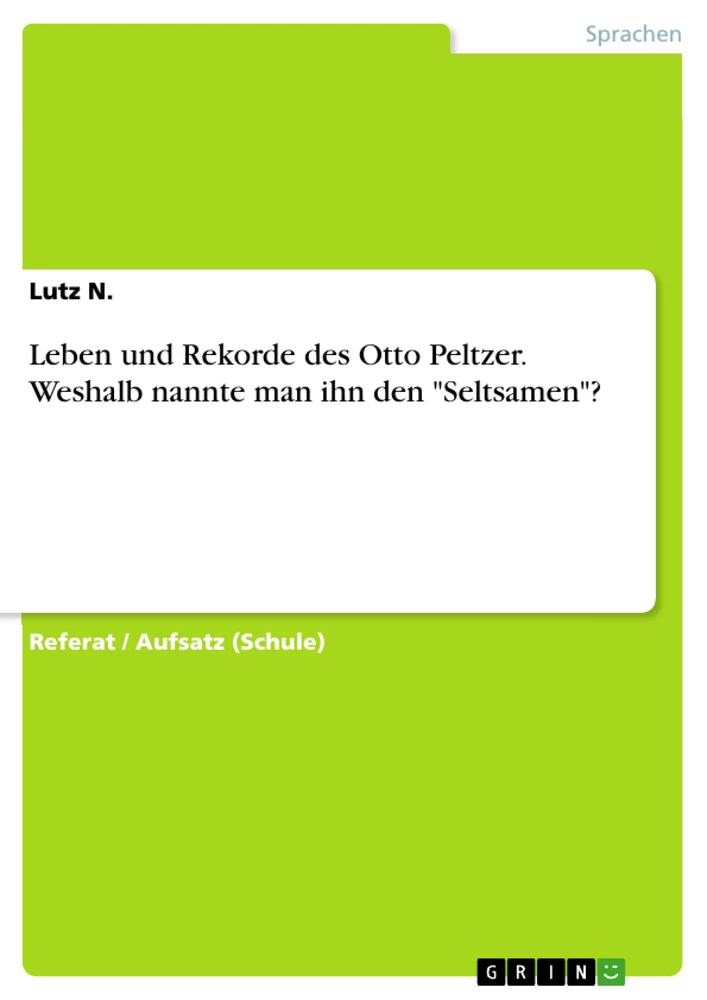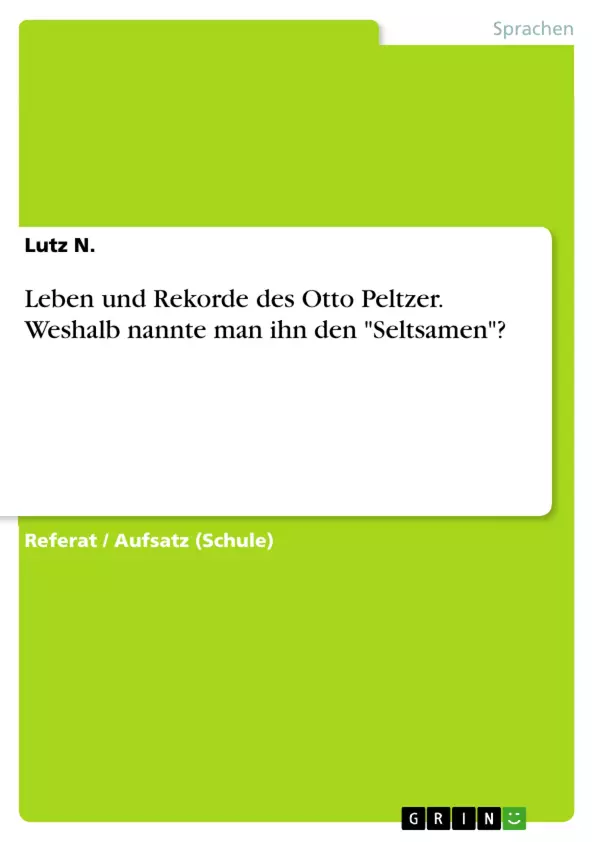Stellen Sie sich vor: Ein Mann, zerrissen zwischen Ruhm und Verfolgung, ein Pionier seiner Zeit, verkannt und doch unvergessen. Begeben Sie sich auf eine fesselnde Reise in das Leben von Otto Peltzer, einer Ikone der Goldenen Zwanziger, dessen außergewöhnliche sportliche Leistungen – vier Weltrekorde und fünfzehn deutsche Meistertitel – von einem Leben voller Kontroversen und persönlicher Tragödien überschattet wurden. War er wirklich der "seltsame Otto", wie er genannt wurde, oder nur ein Mann seiner Zeit, der den Mut besaß, gegen den Strom zu schwimmen? Diese packende Biografie enthüllt die vielschichtige Persönlichkeit eines Ausnahmesportlers, dessen humanistisches Weltbild ihn in Konflikt mit den aufkommenden Nationalsozialisten brachte und ihn zur Flucht zwang. Erleben Sie seinen Kampf gegen die Widrigkeiten des NS-Regimes, seine Internierung in Mauthausen und seinen unermüdlichen Einsatz für den Sport in der Nachkriegszeit. Von den glanzvollen Stadien der Weimarer Republik bis zu den entbehrungsreichen Jahren in Indien, wo er eine neue Generation von Athleten inspirierte, zeichnet dieses Buch das bewegende Porträt eines Mannes, der trotz aller Rückschläge nie seinen Idealen untreu wurde. Tauchen Sie ein in eine wahre Geschichte von Triumph und Tragödie, von unerschütterlichem Willen und der einsamen Suche nach Anerkennung. Entdecken Sie Otto Peltzer, den visionären Athleten, den gebrochenen Mann und den unvergessenen Helden, dessen Vermächtnis bis heute nachwirkt. Eine inspirierende Lektüre für alle, die sich für Sportgeschichte, Biografien und die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit interessieren. Erfahren Sie mehr über die goldenen Zwanziger, Leichtathletik, Weltrekorde, Nationalsozialismus, Verfolgung, Mauthausen, Wiederaufbau, Indien, Sportgeschichte und Biografie. Ein Muss für jeden, der die wahre Geschichte hinter den sportlichen Erfolgen sucht und die komplexe Persönlichkeit eines einsamen Kämpfers verstehen möchte. Lassen Sie sich von Otto Peltzers Lebensweg inspirieren und berühren.
Inhalt
1. Einleitung
2. Lebensabschnitte
2.1. Kindheit
2.2. Jugend
2.3. Entwicklung zum liberalen Humanisten
2.4. Sportlerjahre
2.5. Flucht vor den Nazis
2.6. Mauthausen
2.7. Wiederaufbaujahre
2.8. Indien
3. Weltrekorde
4. Resümee
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Otto Peltzer, ein Spotstar der Goldenen Zwanziger, wurde auch „Otto der Seltsame“ genannt. In seiner Sportlerkarriere erreichte er 4 Weltrekorde und 19 Deutsche Rekorde. Er nahm an 24 Deutschen Meisterschaften teil, und wurde davon 15 Mal Deutscher Meister. Zudem war er zweimal Teilnehmer der Olympischen Spiele.
Doch wieso nannte man O. Peltzer den „Seltsamen“ ? Was war an diesem Menschen so seltsam, wo er doch solche Siege erreichte.
Schließlich war er einer der Besten, wenn nicht sogar der beste Mittelstreckenläufer Deutschlands.
Und der Untertitel des Buches „Otto der Seltsame“, von Volker Kluge lautet: „Die Einsamkeit eines Mittelstreckenläufers“. Kann man daraus schließen, dass Otto Peltzer ein einsamer Sportler war, der in seinem Leben nie richtige Freunde besaß? Oder bezieht sich die Einsamkeit nur auf die Wettkampfstrecke ?
In der folgenden Hausarbeit möchte ich Otto Peltzers wichtigsten Lebensabschnitte kurz darstellen und versuchen, meine Fragen dadurch zu beantworten.
2. Lebensabschnitte
2.1. Kindheit
Dr. Otto Paul Eberhard Peltzer erblickte am 08. März 1900 das Licht der Welt. Seine Eltern Elly Peltzer und Paul Peltzer wohnten zu dieser Zeit in Ellerbrock, im Kreis Steinburg in Holstein, das südlich von Stettin liegt.
Mit 7 Jahren kam O. Peltzer in ein Krankenhaus, weil er über starke Schmerzen in der Hüfte klagte. Doch folge einer Fehldiagnose und einer daraufhin falschen Behandlung Hatte Peltzer nach der Entlassung ein kürzeres linkes Bein und linken Arm. Als Kind besuchte O. Peltzer eine Privatschule, in der es noch keinen Turnunterricht gab. Seine Familie zog dann nach Remmels zum Großvater. Die neue Schule bot Turnunterricht am Nachmittag an. Doch weil O. Peltzer jeden Morgen 5 km Schulmarsch zur Schule hin und zurück absolvieren musste, trauten ihm seine Eltern den gleichen Weg am Nachmittag zum Turnunterricht nicht noch einmal zu, da O. Peltzer von schmählicher Gestalt war. In seiner Freizeit las O. Peltzer gerne und viel.
Ein Jahr später zog er und seine Familie dann nach Pommern um.
Inzwischen war O. Peltzer 13 Jahre alt und besuchte das Oberschulen - Internat in Stargrad, welches er mit der Oberprimarreife abschloss.
Das Internat war einen Kilometer von der Schule entfernt. O. Peltzer, der immer erst im letzten Moment aufstand, rannte meist die Strecke, damit er nicht zu spät zum Unterricht kommt.Gut in der Schule war O. Peltzer jedoch nicht. Er war körperlich sehr ungeschickt. Bekam im Turnunterricht meist die Note 4. Seine Geschwister, Ilse, Inge und Werner nannten ihn wegen seinen langen Beinen immer den Storch. Und seine Eltern glaubten, er wäre ein Versager wegen der schlechten Schulnoten. Er war das „schwarze Schaf der Familie“. (zitiert in Kluge 2000, 15)
2.2. Jugend
Um sich vor seinen Mitschülern behaupten zu können, wünschte er sich zu seinem Geburtstag Hantelstange und Gewichte.
Wegen des Kriegsausbruches wurde auch in den Schulen die „Jugendwehr“ eingeführt. In dieser Ausbildung ist O. Peltzer das erste Mal gegen eine Stoppuhr gelaufen. Sein Trainingszustand verbesserte sich zusehens. Dennoch wurde er bei der Musterung wegen allgemeiner Körperschwäche zurück gestellt.
O. Peltzer entschloss sich im Winter 1917/18 Offizier zu werden. Er wurde dann auch im darauf folgendem Sommer als Fahnenjunker zu den 2. Grenadieren nach Stettin eingezogen. Die Ausbildung war für ihn sehr schwer.
Doch als der Krieg zu Ende war, war O. Peltzer enttäuscht über die Niederlage Deutschlands. Dadurch prägte ihn überspitzter Patriotismus.
So entschloss er sich das Abitur zu machen. Dafür musste er jedoch an einem Kriegsteilnehmerkurs teilnehmen.
2.3. Entwicklung zum liberalen Humanisten
Politisch wurde O. Peltzer immer aktiver. Er wurde Leiter der Stettiner Gruppe von der „völkischen Bewegung“. Später wurde er Landesvorsitzender in Pommern. Die "völkische Bewegung" waren Protagonisten vom altgermanischen Heldentum.
O. Peltzer wurde später als Vertreter der „nationalistischen Jugendverbände Ostdeutschland“ gewählt. Dort wurde er als gefürchteter Debattenredner berühmt. Die Organisationen hatten jedoch nichts mit den Nationalisten zu tun. O. Peltzer hatte Hitler öfter sprechen gehört, fühlte sich aber vom hysterischen Geschrei Hitlers abgestoßen.
In seinen Jugendverbänden führte er auch die Leichtathletik ein. Er wollte in der Jugend die Begeisterung zum Sport wecken. Er selbst versuchte sich im Lauf, Sprung und Speerwerfen. Lief nach einigem Trainieren die 400m sogar unter 60 sec. So bestritt er in den 20 Jahren auch mehrere 800m und 1500m Läufe.
2.4. Sportlerjahre
Seine Eltern hatten jedoch eine Abneigung gegen den Sport. O. Peltzer jedoch träumte von einer Olympiateilnahme 1924.
Gearbeitet hat er in der Zeit als Ingenieur bei den Stettiner Vulkan Werken. Die Arbeit war ihm jedoch zu anstrengend, was der Grund war seinen Vater zu bitten, ob er nicht Volkswirtschaft studieren könne. Dieser willigte ein, jedoch mit der Bedingung Rechts- und Staatswissenschaften zu studieren.
So begann er ab 1920 auf der Universität in Jena Rechts- und Staatswissenschaften zu studieren. Er wohnte in der Zeit bei einem Sozialwissenschaftler namens Gerhard Kessler. Dieser machte durch viele Diskussionsrunden einen neuen Menschen. Doch glücklich war er in Jena nicht. Er vermisste seine Stettiner Trainingskameraden. So entschloss er sich am Ende des Semesters nach München zu wechseln. Doch schon im Frühjahr 1922 meldete er sich wieder ab, um sein Studium in Berlin fortzusetzen. Am 29. Mai 1921 wurde O. Peltzer durch viel Training Deutscher Rekordhalter über 400m Hürden. Ab nun begann sein sportlicher Aufstieg. Daraufhin erhielt er eine Einladung zum Istaf, wo er zum ersten Mal die 800m unter 2 Minuten lief und damit zum Erstaunen vieler Dritter wurde. Mit 1:58,2 gehörte er von nun an zur deutschen Spitze. (vgl. Kluge 2000, 22)
In der Zeit war er als Redakteur der Zeitung „Reichswacht“ mit dem Untertitel „Monatsschrift für national-politische Jugendbewegung“ tätig.
O. Peltzer lernte in der Hochschule Berlin auch den Arzt Dr. Martin Brustmann kennen, der ihm den Wert von Massage, Wechselbädern und Sauna erklärte. Langsam bekam O. Peltzer den Ruf „Otto der Seltsame“ weg, weil er im Training den Restschnee zur Durchblutungsförderung nutzte, indem er sich auf ihn legte. Er lief auch, ob Winter oder Sommer, immer mit langen Unterhosen.
In Duisburg 1922 gewann er seine ersten Deutschen Meisterschaften über 1500m.
Am 17. November 1923 meldete sich O. Peltzer dann wieder zum Studium zurück.
Zu den olympischen Spielen wurde Deutschland 1924 nicht eingeladen, was O. Peltzer um seine Medalienchance brachte, da er im gleichen Jahr den Silbermedaliengewinner Willy Schäfer in einem Wettkampf schlug.
Sein Studium beendete er mit einem Doktortitel, was seine Popularität beträchtlich steigerte. O. Peltzer arbeitete nebenbei bei der Zeitung „Stettiner General-Anzeiger“.
Er war kein Athlet der vom Sport lebte, sondern ein Intellektueller, dem der Sport dazu diente, seine Persönlichkeit zu vervollkommnen. (zitiert in Kluge 2000, 29 )
O. Peltzer wurde von Medien und Massen geliebt. Er konnte durchaus Stadien füllen, weil Anspruch und Leistung stimmten. Das Publikum spürte, dass er ein Kämpfer war. Und so wurde er 1926 vier Mal Deutscher Meister.
Im Winter verstärkte sich die Zusammenarbeit mit Dr. Brustmann. Er war ein erfahrender Arzt, der schon seit 1906 viele sportmedizinische Untersuchungen vorgenommen hatte. Zusammen machten sie viele Tests. Dr. Brustmann gab O. Peltzer viele Tipps für sein Training, was Nahrung, Erholung und effektives Training anging.
In diesem Jahr 1926 rannte O. Peltzer seinen ersten Weltrekord über 500m in 1:03:06 sec. „Mein Siegerwille wuchs mit jedem Schritt“, schrieb O. Peltzer später. (zitiert in Kluge 2000, 31)
Einen Monat später waren Englische Meisterschaften. Die Deutschen und so auch
O. Peltzer reisten mit kleinem Flugzeug an. Ihnen wurde fast allen Kotzübel. Trotz der schweren Anreise wurden sie zum Erstaunen von einem randlos überfüllten Stadion mit Zuschauern überrascht, obwohl dieses kleine Stadion am Rande der Stadt mit einer schlechten Grasbahn nicht gerade zum Zuschauen einlud.
O. Peltzer begann seinen Wettkampf wie üblich mit Fehlstart, welches zu seiner Taktik gehörte, um Anspannung zu lösen. Mit am Start war Olympiasieger Lowe.
O. Peltzer rannte dort vor tobender Zuschauermenge Weltrekord und gewann mit 1:51,6 min auf 880 Yards. Er war somit erster Deutsche, der sich auf einer olympischen Strecke ins Rekordbuch eintragen durfte.
Zurück in Deutschland wurde O. Peltzer vom Bürgermeister und Chören empfangen. Ehrenjungfrauen überreichten Lorbeerkränze.
Im gleichen Jahr wurde er nach Berlin zu den „Internationalen Wettkämpfen“, die parallel zu der Funkausstellung lief, eingeladen. Knüller war hier das zusammentreffen des Olympiasiegers über 1.500m Paavo Nurmi. Obwohl O. Peltzer bis dahin 37 Wettkampf bestritten hatte und von den vielen Wettkämpfen völlig schlapp war, trat er am
11. September 1926 auf dem Platz des Berliner SCC zum Wettkampf an. Er träumte schon lange davon gegen Nurmi zu laufen, und nun bot sich die Möglichkeit. Es waren 20.000 Zuschauer gekommen, um sich das Spektakel anzusehen. O. Peltzer machte wie gewöhnlich einen Fehlstart. Ungewöhnlich war diesmal, dass er sogar einen zweiten Fehlstart machte. Er musste wohl sehr angespannt sein. O. Peltzer lag vom Start an, an zweiter Stelle und erst 40m vor Ziel passierte er den an der Spitze führenden Paavo Nurmi und wurde so Sieger. Ein Sturm von Begeisterung machte sich breit. O. Peltzer lief Weltrekord in 3:51min, und die Zuschauer sangen vor Begeisterung das Deutschlandlied.
Die Zeitungen waren begeistert von O. Peltzers überwältigender Leistung. Sie brachten Extrablätter heraus, und O. Peltzer bekam Glückwünsche aus aller Welt zugeschickt Wochenlang blieb O. Peltzer Gesprächsthema Nummer eins, und auch noch Jahre danach analysierten Fachleute wie der Reichstrainer Josef Waitzer seine Lauftechnik. (vgl. Kluge 2000, 36-37)
Daraufhin wurden auch zwei amerikanischen Agenten auf O. Peltzer aufmerksam und machten ihn ein Angebot, dass er für 250.000 Doller plus Werbeeinnahmen im Jahr, in den Pausen von Football- und Baseballspielen laufen könne. Der Kurs lag damals bei 4,20 DM pro Doller. Doch O. Peltzer lehnte das Angebot ab, da er lieber bei den olympischen Spielen starten wollte. Denn dafür musste man Amateur sein, und durfte nicht mit seinem Sport Geld verdienen.
Am 15. Oktober 1926 nahm O. Peltzer eine Lehrerstelle in der freien Schulgemeinde Wickkdorf an. Er Unterrichtete dort Geographie, Geschichte und Biologie. Da er jedoch Amateur bleiben wollte, konnte er nur Inoffiziell Sport unterrichten. Die Schulleitung erwartete von O. Peltzer, dass er auf seinen Reisen Schüler werben sollte. Dafür bekam er als Gegenleistung Provision. Bald darauf wurde die Schule sehr bekannt und es herrschte große Anfrage.
1926 lief O. Peltzer insgesamt dreimal Weltrekord und errang vier Deutsche Rekorde.
Nebenbei schrieb er zwei Bücher, mit den Namen „Vergangenheit und Zukunft der Deutschen Leichtathletik“ und „Das Trainingsbuch des Leichtathleten“. 1927 kam dann noch das Buch „Der Weg zum Erfolg“ hinzu.
O. Peltzer verschaffte sich durch seine ausgesprochne gute Leistung eine menge Neider, und aufgrund seiner vielen Reisen meinten viele, er würde gegen das Amateurgesetz verstoßen. Die Sportbehörde verordnete darauf hin eine Untersuchung an. Eigentlich wollte er im Dezember 1927 nach Amerika reisen, um amerikanische Gegner bei ihren Wettkämpfen zu beobachten, was ihm zuerst wegen den Untersuchungen verboten wurde. Dennoch reiste er nach Amerika, wo er herzlich empfangen, und ihm zu Ehre ein Fest veranstaltet wurde. Es regnete Wellen von Einladungen, einer der Größten war wohl die vom US-Präsidenten ins Weiße Haus.
O. Peltzer verbrachte auch Weihnachten in Kalifornien, studierte dort die Verhältnisse von Universitäten und Schulen.
Im Februar 1928 bestritt O. Peltzer drei Wettkämpfe in Amerika, gewann davon aber nur einen. Und so kehrte er schließlich im März 1928 zurück. Zu Hause verletzte er sich aber beim Feldhandballspiel. Folge war ein Mittelfußbruch und ein vierter Platz bei den Deutschen Meisterschaften. Wegen seiner Verletzung hatte er auch kein Erfolg bei den Olympischen Spielen. So schied er im 800m Zwischenlauf und 1500m Vorlauf aus. Anfang 1929 erkrankte O. Peltzer an einer Gelbsucht, und dennoch rannte er Ende 1929 wieder Bestleistungen. Nämlich in Tokio, als er beim Umsteigen in Moskau seinen Zug verpasste und so vier Tage später als die Deutschen Nationalmannschaft in Tokio eintraf. Carl Diem, damaliger Generalsekretär des Deutschen Reisausschusses sah O. Peltzer als Reizfigur für die Mannschaft. Er besorge sich immer Vorteile,“... im Auto braucht er den Platz neben dem Chauffeur, damit er seine Beine ausruhe, im japanischen Restaurant streckt er sich sofort lang, wickelt sich ein und schläft etwas, im Hotel kann er nicht schlafen, weil es zu laut ist, er opfert sich, indem er abseits in ein Bürgerquartier zieht...Dies alles zum Wohle und Ansehen unseres Vaterlandes“.
(zitiert in Kluge 2000, 60)
O. Peltzer reiste, von Tokio zurück, am 26. Oktober nach Australien weiter und wurde dort am 25. Januar 1930 Australischer Meister über 880 Yards.
Zurück in Deutschland startete er im August 1930 bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin und gewann seinen Vorlauf. Jedoch durfte er durch ein Verbot des DSB nicht am Endlauf teilnehmen. Grund war sein „unkorrektes“ Verhalten auf seiner Weltreise. Die Beweise dafür hatte Diem dem DSB vorgelegt. Die Suspension wurde jedoch ein paar Tage darauf wieder zurück genommen.
In dieser Zeit begannen die Nationalsozialisten mit der „Neuordnung“ des Schulsystems. Und auch O. Peltzer war davon betroffen. Schließlich war er ja Lehrer an der Schule in Wickkersdorf. Auch er wurde als Lehrer entlassen. Dies erfuhr er aber erst, als er von den olympischen Spielen in Los Angeles wieder zurück kam.
Doch viel Glück hatte O. Peltzer nicht, denn zu den Olympischen Spielen 1932 war er wieder erkrankt. Diesmal an Rippenfellentzündung. Zu groß war der Trainingsausfall. Dennoch erreichte er im 800m Lauf den neunten Platz, und im 4x400 m mit der Mannschaft den vierten Platz.
Doch schon wieder zwei Jahre später wurde er zum 15. Mal Deutscher Meister.
Zurück in Deutschland traf er dann ein Abkommen mit der Wirtschaftsleitung, das ihn für ein festes Gehalt zur Schülerwerbung verpflichtete. Im Frühjahr 1933 erklärte er seinen Eintritt in die NSDAP und der SS; angeblich - so seine Darstellung - um Wickersdorf zu retten. (vgl. Kluge 2000, 69)
Doch trotz Beitrittserklärung war O. Peltzer für den SA- Gruppenführer Hans von Tschammer und Osten ein Anti- Held und Dorn im Auge. Um so mehr feierte dieser es 1933 bei den Deutschen Meisterschaften in Köln, als der von einem Malaria-Anfall geschwächter „Altmeister“ - Peltzer hatte sich auf seiner Weltreise in Sumatra infiziert - im 800 m Endlauf nur sechster wurde. Jetzt musste man ihn für die Länderkämpfe gegen England und Frankreich nicht berücksichtigen. (vgl. Kluge 2000, 69)
Im Oktober 1933 zog O. Peltzer nach Berlin und nahm dort im Juni 1934 beim Verein SC Teutonia 1899 eine Trainerstelle an.
Im gleichen Jahr, 1934 lief er bei den Deutschen Meisterschaften die 800m und gewann diese mit seinen 34 Jahren.
2.5. Flucht vor den Nazis
Als Wickersdorf die Zusammenarbeit mit ihm einstellte, hätte er gewarnt werden müssen. So wurde er im Spätsommer 1934 verhaftet. Der Vorwurf lautete auf “Verbrechen gegen §175 StGB“ und was den Fall schwerwiegend machte, wegen „Unzucht mit Minderjährigen.“ (zitiert in Kluge 2000, 72)
Durch die Hilfe von seinem alten Freund Dr. Brustmann kam er jedoch nach 3 Wochen wieder frei.
Am 16. März 1935 wurde O. Peltzer erneuert verhaftet. Von seinem Rechtsanwalt erfuhr er, dass der Reichssportführer ihn wohl aus dem Verkehr ziehen wollte. So wurde er wegen „Sittlichkeitsverbrechen“ zu einem Jahr und sechs Monate in Plötzensee verurteilt. Zudem wurde ihm der Doktortitel aberkannt.
O. Peltzers Bestrafung sorgte im Inn- und Ausland für großes Aufsehen. Jedoch blieb jeglicher Protest ergebnislos.
Am vierten Tag der Olympischen Spiele 1936 in Berlin kam O. Peltzer frei. Doch schon zwei Tage nach den Olympischen Spielen, am 18. August 1936 wurde er wieder verhaftet und zu einem Jahr und zehn Monate auf Bewehrung verurteilt.
Sein Freund Dr. Brustmann, der inzwischen SS-Arzt im Reichssicherheitshauptamt war, verschaffte O. Peltzer einen 5 Jahre gültigen Reisepass und riet ihm damit ins Ausland zu gehen. Am Anfang zögernd, siedelte er schließlich Anfang 1938 nach Schweden über. Doch die schwedischen Behörden wollten O. Peltzer so schnell wie möglich wieder los werden. Deshalb musste er nach 2 Tagen Aufenthalt schon wieder aussiedeln. So reist er weiter nach Finnland und suchte dort seinen alten Sportsfreund Nurmi auf. Dieser verschaffte ihn Arbeit in Helsinki wo, er an Universitäten Vorlesungen gab und nebenbei als Trainer wirkte. Aber auch dort war O. Peltzer nicht sicher. So wurde er von den Nazis observiert, sollte auch festgenommen werden. Konnte aber im letzten Moment zurück nach Schweden fliehen.
Als er am 11. September 1939 in Schweden ankam, wurde er dort mit 40 Grad Fieber ins Krankenhaus eingeliefert. Glück im Unglück hatte O. Peltzer, der im Krankenhaus vom Chefredakteur der Schwedischen Sportzeitung „Idrottsbladet“ angesprochen wurde und ihm das Angebot machte, für die Sportzeitung zu schreiben. nahm freudig an. Durch die Hilfe der „Organisation intellektueller Emigranten“ erkannte man O. Peltzer als politischen Flüchtling an. In seinen Zeitungsberichten enthielt er sich jeder politischen Äußerung, um seine Aufenthaltsgenehmigung nicht zu gefährden. Er wurde jedoch dort die ganze Zeit von der Gestapo überwacht.
Durch die Vermittlung von Edwin Wide bekam O. Peltzer eine Trainerstelle in dessen Verein „Linnèa.“ Auch dort noch machte O. Peltzer mit seinen inzwischen 40 Jahre einige Wettkämpfe mit. Offizielle Starts waren ihm als Ausländer jedoch verboten.
O. Peltzer schrieb viele Artikel, die der Reichssportführer sehr kritisierte. Deshalb hatte er vor, O. Peltzer wieder nach Deutschland zurück zu holen, und ihn dann aus den Verkehr zu ziehen. Doch trotz aller Spitzelei ist es nicht gelungen, O. Peltzer etwas anzuhängen, Belastungsmaterial zusammenzutragen, die eine Ausweisung gerechtfertigt hätte. Deshalb beantragte die Gestapo Leitstätte, ihm die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, um nach Deutschland zurückkehren zu müssen.
Ein neuer Artikel von O. Peltzer sorgte wieder für den Anlass der Nationalsozialisten, tatkräftig zu werden. Am 9. September 1940 bekam O. Peltzer die Nachricht, Schweden zu verlassen, da seine Aufenthaltsgenehmigung ablief. Trotz aller Versuche die Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern, lieferten ihn die schwedischen Behörden am 6. Februar 1941 der Gestapo aus. In Deutschland angekommen, wurde er in Berlin verhört. Anschließend durfte er seine Familie benachrichtigen, worauf sein Bruder und seine „Verlobte“ Gerda nach Berlin kamen. O. Peltzer wurde gesagt, er käme für 3 Monate zur politischen Umschulung, und würde dann wieder frei gelassen. Doch zur Verwunderung O. Peltzer traf dieser am 11. April 1941 ins KZ Lager Mauthausen ein.
2.6. Mauthausen
Was ihn dort erwartete, bekam er schon bei der Ankunft zu spüren. O. Peltzer bekam als zur Begrüßung einen Faustschlag ins Gesicht, wobei er einen Zahn verlor. Als er dann dem Lagerkommandanten mitteilte, dass er zur politischen Umschulung hier wäre und nach 3 Monaten wieder entlassen werden sollte meinte dieser, wenn er 3 Monate aushalten würde könne er durch diesen Ausgang gehen, und zeigte dabei mit einem Finger auf einen Schornstein. (vgl. Kluge 2000, 91)
O. Peltzer musste dort hart arbeiten. Nahm in dieser Zeit viel ab. Nach 3 Monaten wurde Er zum Kommandanten gerufen, der sich empörte, dass O. Peltzer noch lebe und versetzte ihn deshalb in den „Wiener Graben“, den Steinbruch. Wer dazu gehörte, war dem Tod geweiht. (vgl. Kluge 2000, 91)
Von Woche zu Woche spürte O. Peltzer wie ihn seine Kräfte verließen. Einmal wurde er von einem Wärter so verprügelt, dass er alle Vorderzähne verlor.
Einen Tag nach 44. Geburtstag, am 9. März 1944 wurde O. Peltzer zu seinem Glück nach Ebensee verlegt. Ab dort war er Arbeitssklave von “Siemens-Bauunion.” Der verantwortliche Ingenieur war Jupp Berg, der 1938 Deutscher Meister über 10.000 m wurde. Dieser wusste wohl wer Otto Peltzer war, und mit dessen Hilfe O. Peltzer in die Kaste der Häftlingsfunktionäre aufrückte. Durch die leichtere Arbeit und bessere Verpflegung erholte sich O. Peltzer sogar ein wenig.
Am 9. Februar 1945 bekam er überraschend den Befehl zur „Rücküberführung nach Mauthausen“, was in der Regel das Todesurteil unter den Häftlingen bedeutete. Doch aufgrund des Durcheinanders, kurz vor dem Kriegsende hatte O. Peltzer Glück gehabt. Da jeden Tag neue Häftlinge dazu kamen, herrschte im Lager katastrophale Verhältnisse. So blieb O. Peltzer verschont.
Am 5. Mai 1945 wurden alle Häftlinge von Matthausen von den Amerikanern befreit.
So erfuhr er im Herbst 1945, dass all seine Verwandten Tod waren. Sein Vater und sein Bruder wurden erschossen, seine Schwester vergewaltigt. Daraufhin hat sich dann und seine Mutter erhängt.
2.7. Wiederaufbaujahre
Ohne jeglichen Besitz ging O. Peltzer nach Frankfurt am Main. Er hoffte dort wenigstens seine Großtante wieder zu finden. Doch ohne Erfolg.
Am 30. September 1945 lief O. Peltzer auf einem Sportplatz in Frankfurt seinen ersten Wettkampf nach dem Krieg. Er wurde von Amerikanern organisiert, und obwohl er nur noch aus Haut und Knochen bestand, lief er die 5000 m.
O. Peltzer arbeitete jetzt die meiste Zeit an seinem Buch „Von Stockholm nach Mauthausen“, welches jedoch nie veröffentlicht wurde. Stattdessen veröffentlichte er 1947 das Buch „Sport und Erziehung. Gedanken über eine Neugestaltung“. Damit wollte er „Der Jugend neue Wege im Sport weisen“ (vgl. Kluge 2000, 100)
O. Peltzer war ein Gegner von Carl Diems veralterte Trainingsmethoden und Vorstellung von Leibesübungen. Dieser wurde nach dem Krieg wieder Rector der Sporthochschule in Köln. Carl Diem tat alles, damit O. Peltzer nicht im Sport aktiv werden würde. Wo sich
O. Peltzer auch bewarb, wurde er abgelehnt. So verdiente er sich sein Geld mit Artikeln und Vorträgen in der „Rhein-Zeitung.“
Durch seinen Freund Dr. Paul Martin bekam O. Peltzer 1947 eine Stelle als Sportlehrer in der Internatsschule in Zürich. Auch wenn’s ihm dort nicht so gefiel, hatte er wenigstens wieder Zeit zum trainieren. Dort traf er seinen alten Konkurrenten Mario Lanzi wieder. Sie trainierten zusammen und machten Wettkämpfe.
Mit Hilfe von Paul Martin wollte O. Peltzer seine Idee verwirklichen, eine internationale Vereinigung aller Rekord- und Meistersportler zu gründen. Grund war der internationaler Kongress des PEN-Clubs im Juni 1947.
In der Tat wurde in den 50 Jahren die Vereinigung „Olympian International“ gegründet, aus der 1995 die Weltvereinigung der Olympiateilnehmer (WOA) entstand.
O. Peltzer reiste am 20. Juni 1947 nach Montana (Schweiz), wo er als Erzieher angestellt wurde. Dort bemühte er sich die Schüler für den Sport zu begeistern. Doch als seine Aufenthaltsgenehmigung 1948 ablief, kehrte er wieder zurück nach Deutschland, wo sich der Sport durch den Deutschen Leichtathletik Ausschusses immer weiter entwickelte. O. Peltzer wollte in Deutschland bei der Entwicklung des Sportes mitwirken, doch in den Augen vieler Funktionäre war er ein Spinner. Niemand wollte O. Peltzer haben, bis an den Tag, als zwei reiche Geschäftsmänner (Hartmann u. Vogel) ihr Vermögen in den Sport investieren wollten, indem sie die beste 4x400 m Staffel zusammen stellen. Sie nahmen sich die besten Sprinter unter Vertrag und wollten O. Peltzer als Trainer.
Für die „Preußen“ war es offenbar eine unerhörte Provokation. So kamen alte Gerüchte wieder zum Vorschein. Selbst Carl Diem riet dringend von dieser Idee ab. Dennoch entschlossen sich die Geschäftsmänner für O. Peltzer, nachdem Sie sich in der Schweiz nach dessen Referenzen erkundigt, und nur Gutes über ihn gehört hatten.
O. Peltzer war somit als Sportlehrer beim CSV Marathon 1910 verpflichtet worden, und trat am 1. Dezember 1949 offiziell zum Dienste an. Von dort an wurde er sehr schlecht durch die Presse gezogen. Man versuchte alles, um O. Peltzer zu schaden. Doch sein Verein, für den er arbeitete, hielt zu ihm. Unter der Wucht von Vorwürfen wurde
O. Peltzer immer leiser, und aufgrund eines dummen Fehlers, er riet schriftlich Hans Geißler den Verein zu wechseln, dieser Brief geriet jedoch in falsche Hände, wurde er am 18. März 1950 wegen Verstoßes des Amateurgesetzes zu einer Sperre von 6 Monate verurteilt. Diese wurde in einer zweiten Verhandlung noch mal um 2 Jahre verlängert. So verlor O. Peltzer wegen damaliger Aberkennung seines Dr. Titels, was sein Verein durch die Verhandlung erfuhr, seine Trainerstelle. Am 13. Oktober 1950 hatte O. Peltzer einen Motorratunfall und somit einen 3 Monate andauernden Krankenhausaufenthalt. In dieser Zeit entschloss er sich ins Ausland zu gehen und dort als Trainer zu arbeiten.
Doch währenddessen zeichnete sich in Deutschland eine politische und auch sportliche Teilung ab. Sollte in der BRD, im Westen Deutschlands ein Schleier des Vergessens über
O. Peltzer ausgebreitet werden, wurde er in der DDR bei einer Leichtathletikveranstaltung als „Friedenskämpfer“ offiziell eingeladen und stürmisch von 30.000 FDJlern begrüßt, worauf er unter turbenden Beifall eine Ehrenrunde lief.
Was ihm in der Bundesrepublik nicht gelungen war, glückte in der DDR. Dort veröffentlichte er seine Autobiographie „Umkämpftes Leben. Sportjahre zwischen Nurmi und Zatopek“, an der er wie ein Wilder 1953 dran gearbeitet hatte. Es erschien Mitte 1955, und trotz 50.000 verkauften Exemplaren fand O. Peltzer, dass das Buch viel zu wenig anklang gefunden hatte. Am 18. November 1956 flog O. Peltzer offiziell nach Australien, mit einem Presseausweis der „Heilbronner Stimme“ und des Nürnberger „Sport-Magazin“, um von den olympischen Spielen zu berichten. Sein eigentliches Ziel war jedoch dort zu bleiben um dort als Trainer zu wirken, was er schon seit Jahren plante. Doch dort bekam er keine Stelle, und ging so weiter nach Indonesien, Indien und Pakistan, wo er sich im November 1957 in Teheran vorstellte. Der dortige Leichtathletikverband bot ihn einen Vertrag für 2 Jahre als Trainer an. Doch wenige Tage nachdem die deutsche Botschaft die iranische Sportbehörde über O. Peltzer Vergangenheit durch eine Einschätzung Carl Diems konsultiert hatte, kündigten sie ihm den Vertrag vorfristig.
2.8. Indien
Am 1. April 1958 reiste O. Peltzer nach Bagdad ab, und von dort aus nach Tokio zu den Asienspielen, um neue Kontakte zu knüpfen. Von dort aus reiste er weiter nach Indien, wo er sich 1959 durch Vorlesungen an Unis sein Lebensunterhalt verdiente. Zudem war er Cheftrainer einige Läufer. O. Peltzer wohnte in einem primitiven Brettverschlag im Nationalstadion, wo er auch sein siebentes Buch „Dr. Peltzer`s extract of modern athletic systems“ schrieb, welches 1960 erschien.
Was er dort leistete, wurde im Oktober 1962 klar, als die DLV-Mannschaft zum Länderkampf gegen Indien antrat und verlor.
Nachdem viele Kinder nach einen internationalen Wettkampf zu O. Peltzer kamen, um bei ihm Leichtathletik zu erlernen, gründete O. Peltzer den Sportclub „Olympic Youth Delhi“.(OYD) So trainierten dort mit der Zeit bei ihm über 50 Kinder, die ihn liebevoll den „Doc“ nannten. Wo „The Peltzers Boys“ auch auf auftauchten, gewannen sie. Einer von ihnen wurde bald Indiens bester 10 Kämpfer, und so langsam wuchs in Indien das Verständnis für die Arbeit von O. Peltzer.
Doch mit der Zeit ging es ihm gesundheitlich immer schlechter. Er bekam eine Herzattacke und musste ins Krankenhaus. Dort verschlechterte sich sein Gesundheitszustand drastisch, so dass seine Freunde Adolf Metzner und Franz Buthe- Pieper zu ihm nach Indien flogen, um ihn nach Deutschland zurück zu holen. Vor dem Rückflug verabschiedete sich O. Peltzer auf den Sportplatz von all seinen Sportlern, die mit Tränen in den Augen vollzählig vor ihm standen. Er überreichte ihnen persönliche Trophäen und landete nach 11 Jahren Auslandaufenthalt am 14. Dezember 1967 in Frankfurt, von wo er aus gleich ins Krankenhaus gebracht wurde.
O. Peltzer versuchte immer seine Indischen Sportler zu Wettkämpfen nach Deutschland zu holen. Happy Sikand, der Kapitän des OYD -Teams, 19 facher indischer Jugendmeister traf 1970 in Mante ein, um sich auf die Olympischen Spiele 1972 vorzubereiten. Natürlich wohnte er in der Zeit beim „Doc“, mit dem er zusammen trainierte.
Am 11. September 1970 auf dem Sportplatz Waldeck in Eutin, als Peltzer seinen Lieblingsschüler, der bei einem Abendsportfest die 1500m lief, die Zwischenzeiten zurief, ging O. Peltzer danach in Richtung Parkplatz, um auf Happy zu warten. Später fand man ihn auf einem Feldweg, Tot- um seinen Hals hing noch die Stoppuhr. (zitiert in Kluge 2000, 146)
3. Weltrekorde
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Resümee
Otto Peltzer hieß also auch „Otto der Seltsame“, weil er durch seine Trainingsmethoden unter den Sportlern und Trainern auffiel. Er lief ob kalt oder warm mit langen Unterhosen, legte sich auf Restschnee um seine Durchblutung zu fördern. Und das Wichtigste, er machte bei jeden Wettkampf einen Fehlstart. Doch das alleine verschaffte ihn nicht den Namen. Otto Peltzer war ein Revolutionär im Sport. Er wusste, wie wichtig Erholung, Ernährung und richtiges Training zusammen wirken. Wollte dieses auch gerne Weitergeben. Doch in Deutschland wollte ihm kaum jemand zuhören. Funktionäre des Sports waren stur auf ihre alten Leibesertüchtigungen verharrt. Machten O. Peltzer dadurch das Leben schwer. In ihren Augen war er nur der „Seltsame“, doch aus dem heutigen Blickwinkel kann man fast behaupten, dass er der Einzige war, der nicht seltsam lebte, sondern ein wichtige Persönlichkeit, die für den Sport lebte.
Was ihn auf einer Seite durch die Verfolgung und Verurteilung als Sittlichkeitsverbrecher durchaus als Einsam erschienen lies. Anderseits hat er durch die vielen Wettkämpfe und den Weltreisen so viele Menschen und auch Freunde kennen gelernt, dass er doch nie wirklich einsam war. Ich denke, Otto Peltzer war zufrieden mit seinem Leben. Sicherlich hätte er gerne mehr für den Sport in Deutschland getan, doch niemand interessierte sich für seine Erkenntnisse.
Und selbst in seinem letzten Lebensabschnitt, in Indien und zum Schluss in Deutschland, hat sich sein Leben nur um den Sport gedreht.
So denke ich, ist das Einzige, was ihn hätte Einsam gemacht, ein Leben ohne Sport.
5. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes über Otto Peltzer?
Der Text ist eine umfassende Übersicht über das Leben von Otto Peltzer, einem deutschen Mittelstreckenläufer der "Goldenen Zwanziger", auch bekannt als "Otto der Seltsame". Er enthält eine Inhaltsangabe, die Peltzers Lebensabschnitte, Weltrekorde und ein Resümee abdeckt.
Welche Lebensabschnitte Otto Peltzers werden im Text behandelt?
Der Text behandelt Peltzers Kindheit, Jugend, seine Entwicklung zum liberalen Humanisten, seine Sportlerjahre, die Flucht vor den Nazis, seine Zeit in Mauthausen, die Wiederaufbaujahre und sein Leben in Indien.
Welche sportlichen Erfolge werden Otto Peltzer zugeschrieben?
Otto Peltzer erreichte 4 Weltrekorde und 19 Deutsche Rekorde. Er nahm an 24 Deutschen Meisterschaften teil und wurde davon 15 Mal Deutscher Meister. Zudem war er zweimal Teilnehmer der Olympischen Spiele.
Warum wurde Otto Peltzer als "Otto der Seltsame" bezeichnet?
Peltzer wurde "Otto der Seltsame" genannt, weil er im Training ungewöhnliche Methoden anwandte, z.B. sich auf Schnee legte, um die Durchblutung zu fördern und stets lange Unterhosen trug. Hinzu kamen seine unkonventionelle Trainingsweise und sein revolutionäres Denken im Sport, was ihn von anderen Athleten und Trainern unterschied.
Welche Rolle spielte Otto Peltzer im Sport nach dem Zweiten Weltkrieg?
Nach dem Krieg versuchte Peltzer, im deutschen Sport wieder aktiv zu werden, stieß aber auf Widerstand. Er arbeitete als Trainer im Ausland und warb für seine Trainingsmethoden.
Was geschah Otto Peltzer während der Zeit des Nationalsozialismus?
Peltzer wurde aufgrund von Anschuldigungen verhaftet und verurteilt. Er floh aus Deutschland, wurde ausgeliefert und in das Konzentrationslager Mauthausen deportiert. Er überlebte das Lager und kehrte nach dem Krieg nach Deutschland zurück.
Welche Bücher hat Otto Peltzer geschrieben?
Otto Peltzer schrieb die Bücher "Vergangenheit und Zukunft der Deutschen Leichtathletik", "Das Trainingsbuch des Leichtathleten", "Der Weg zum Erfolg" und veröffentlichte in der DDR seine Autobiographie "Umkämpftes Leben. Sportjahre zwischen Nurmi und Zatopek".
Wie endete Otto Peltzers Leben?
Otto Peltzer starb am 11. September 1970, nachdem er seinen Schüler Happy Sikand bei einem Wettkampf beobachtet hatte. Er wurde tot aufgefunden; um seinen Hals hing noch die Stoppuhr.
Was ist die Hauptaussage des Resümees über Otto Peltzer?
Das Resümee stellt fest, dass Otto Peltzer durch seine Trainingsmethoden auffiel und ein Revolutionär im Sport war. Trotz der Verfolgung in der NS-Zeit und der Schwierigkeiten nach dem Krieg war er durch seine Leidenschaft für den Sport nie wirklich einsam.
Wer ist Volker Kluge?
Volker Kluge ist der Autor des Buches "Otto der Seltsame: Die Einsamkeit eines Mittelstreckenläufers. Otto Peltzer (1900-1970)", das als Hauptquelle für diesen Text diente.
- Arbeit zitieren
- Lutz N. (Autor:in), 2001, Leben und Rekorde des Otto Peltzer. Weshalb nannte man ihn den "Seltsamen"?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103773