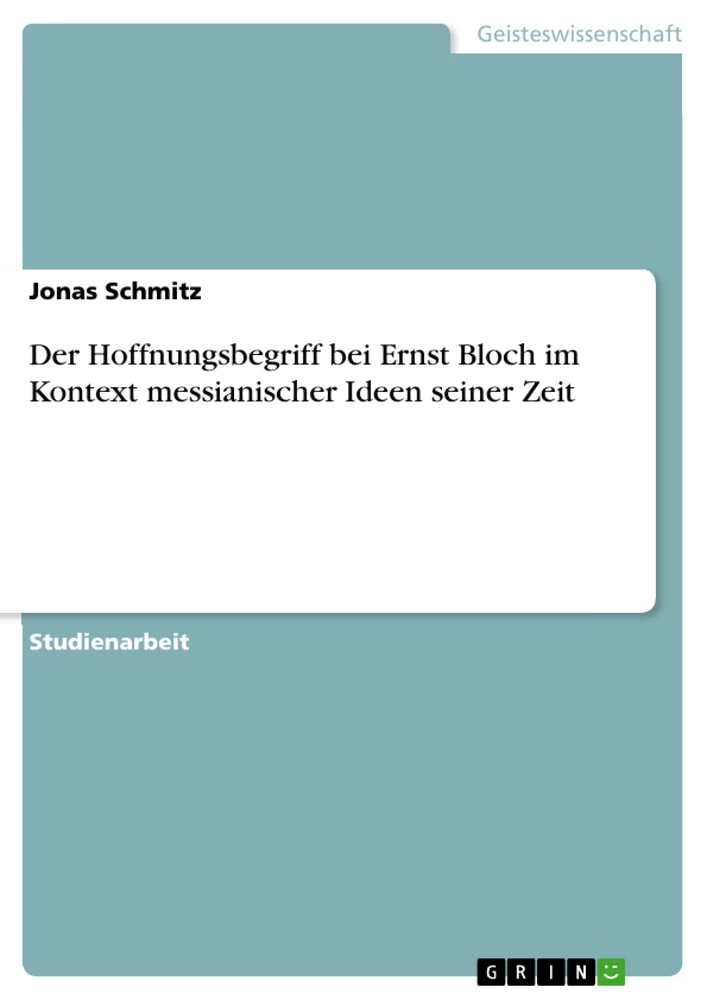Der Hoffnungsbegriff nimmt in der Religionsphilosophie eine zentrale Stelle ein, ist für das Christentum beispielsweise eine der Haupttugenden; und wird auch gegenwärtig als ein zentrales Phänomen der menschlichen Existenz angesehen und dies auch ohne eine religiöse Konnotation. Doch was wäre unter Hoffnung zu verstehen, in welcher Beziehung steht sie zur Religion und zu säkularen, philosophischen Diskursen?
Neben dieser kurzen Problemerörterung wird hauptsächlich der wohl bekannteste Versuch einer systematischen, konkreten Einordnung und Bewertung des Hoffnungsbegriffs in den Blick genommen, welcher mit dem Hauptwerk Ernst Blochs vorliegt, dem Prinzip Hoffnung. Es werden die zentralen Begrifflichkeiten der Bloch'schen Arbeit – das Noch-Nicht-Bewusste, das Mögliche, die konkrete Utopie – expliziert und in den im Seminar erarbeiteten Kontext des Messianismus und messianischer Elemente von Walter Benjamin, Max Horkheimer und Theodor W. Adornos gestellt. Es handelt sich um vier Personen, die sich teilweise untereinander kannten und engen Austausch pflegten und durch ähnliche Schicksale geprägt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Phänomen Hoffnung
- Noch-Nicht – Hoffnung bei Bloch
- Das Noch-Nicht-Bewusste/ Noch-Nicht-Seiende und die Komposition des Suchens
- Das Mögliche
- Die konkrete Utopie
- Das Messianische
- Noch-Nicht – Hoffnung bei Bloch
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Phänomen Hoffnung anhand des Hauptwerks Ernst Blochs, "Das Prinzip Hoffnung", zu untersuchen. Insbesondere wird die Blochsche Konzeption der Hoffnung als "docta spes", als gelernte und lernbare Hoffnung, beleuchtet und in den Kontext des Messianismus sowie der Gedanken von Walter Benjamin, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno gestellt.
- Der Begriff der Hoffnung in der Religionsphilosophie und in säkularen Diskursen
- Die zentrale Rolle des Noch-Nicht-Bewussten und des Möglichen in Blochs Werk
- Die Bedeutung der konkreten Utopie als Motor der Hoffnung
- Die Verbindung von Bloch's Philosophie mit dem Messianismus und den Ideen von Benjamin, Horkheimer und Adorno
- Die Bedeutung der Hoffnung in Zeiten von Krisen und Brüchen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Hoffnung ein und stellt die zentrale Bedeutung des Begriffs in der Religionsphilosophie und der menschlichen Existenz heraus. Sie erläutert die Relevanz von Ernst Blochs Werk "Das Prinzip Hoffnung" und skizziert die im Seminar erarbeiteten Kontexte des Messianismus und der Gedanken von Walter Benjamin, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno.
Das Phänomen Hoffnung
Dieses Kapitel beleuchtet die lange Geschichte der Hoffnung in der Mythologie, Religion und Philosophie. Es wird die Rolle der Hoffnung im Judentum und Christentum hervorgehoben und die Frage nach dem Verständnis von Hoffnung im Vergleich zu Begriffen wie Utopie, Glauben und Wünschen untersucht.
Noch-Nicht – Hoffnung bei Bloch
Dieses Kapitel widmet sich der Bloch'schen Konzeption der Hoffnung als "docta spes". Es erklärt das Konzept des Noch-Nicht-Bewussten und des Möglichen und setzt diese in Beziehung zur Bloch'schen Theorie der konkreten Utopie.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Hoffnung, Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Noch-Nicht-Bewusste, Mögliches, konkrete Utopie, Messianismus, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, docta spes, Teleologie, Defizienz, Fundamentalbrüche, Philosophiegeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Ernst Bloch unter dem "Prinzip Hoffnung"?
Hoffnung ist für Bloch eine "docta spes" (gelehrte Hoffnung), ein aktiver Motor der menschlichen Existenz, der auf die Veränderung der Welt hin zu einer besseren Zukunft zielt.
Was bedeutet das Konzept des "Noch-Nicht-Bewussten"?
Es beschreibt Möglichkeiten und Ideen, die in der Gegenwart bereits angelegt, aber noch nicht vollständig realisiert oder im Bewusstsein verankert sind.
Was ist eine "konkrete Utopie"?
Im Gegensatz zur bloßen Träumerei ist die konkrete Utopie eine realistische Zielvorstellung, die an die objektiven Tendenzen der geschichtlichen Entwicklung anknüpft.
Wie steht Blochs Denken im Verhältnis zum Messianismus?
Die Arbeit setzt Blochs Hoffnungsbegriff in den Kontext messianischer Ideen von Denkern wie Walter Benjamin und Theodor W. Adorno, die Erlösung und gesellschaftliche Befreiung thematisieren.
Ist Hoffnung bei Bloch religiös oder säkular?
Obwohl Bloch religiöse Motive aufgreift, transformiert er sie in eine säkulare, marxistisch orientierte Philosophie der Zukunft.
- Arbeit zitieren
- Jonas Schmitz (Autor:in), 2020, Der Hoffnungsbegriff bei Ernst Bloch im Kontext messianischer Ideen seiner Zeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1037862