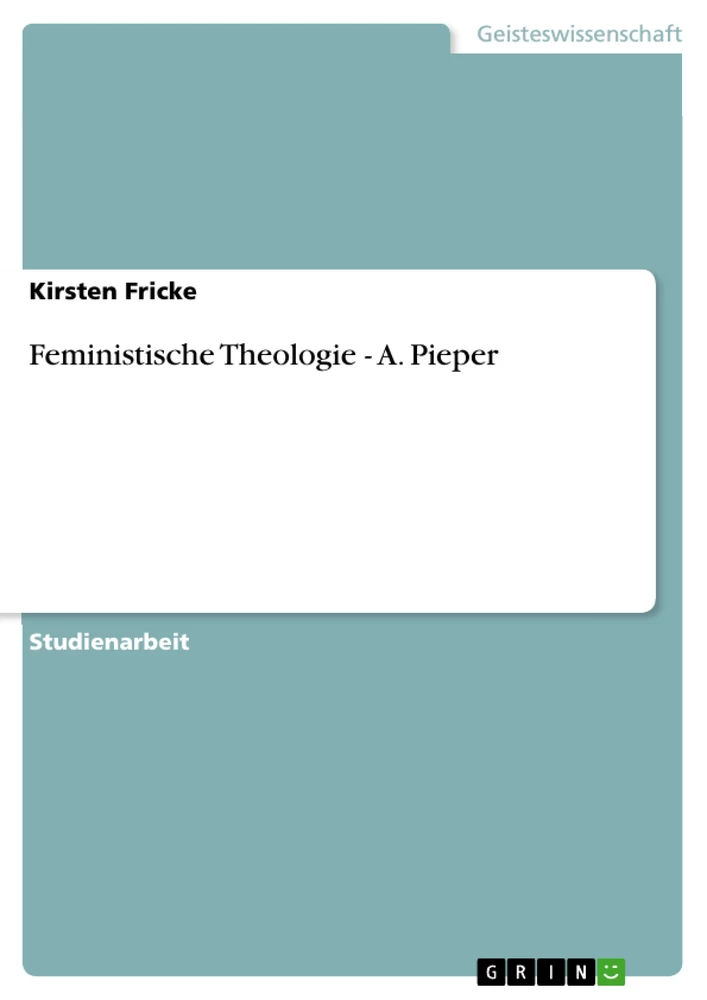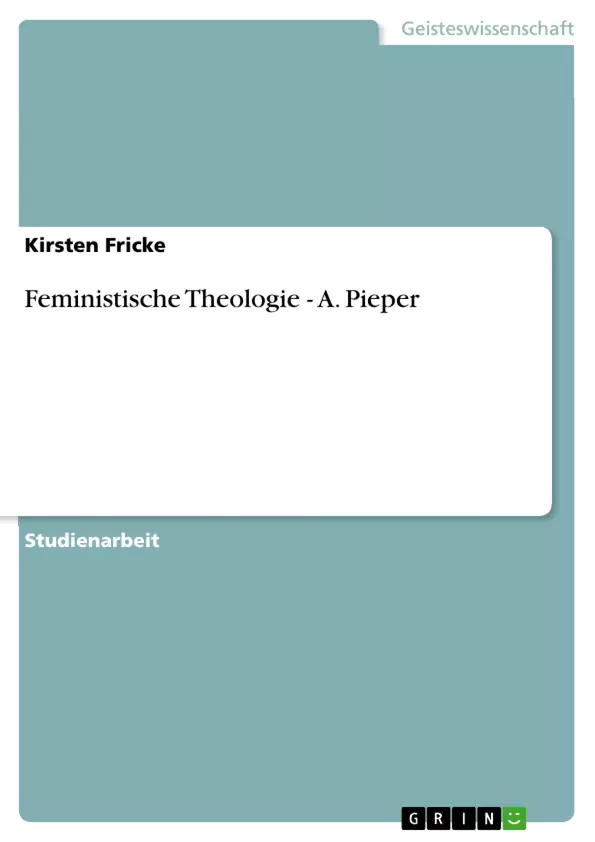Zusammenfassung: Pieper, A., Gibt es eine feministische Ethik?
München 1998, cap 5
A. Pieper beschäftigt sich im 5. Kapitel ihres Buches mit der Frage der zwei Moralen: Moral der Gerechtigkeit und Moral der Fürsorglichkeit. Im ersten Teil geht sie der Frage Fürsorglichkeit versus Gerechtigkeit nach. Sie schließt sich der Meinung Carol Gilligans an, und referiert im folgenden Gilligans Ausführungen zur Moral. Auch sie plädiert, wie diese, daß die weibliche Fürsorgemoral und die männliche Gerechtigkeitsmoral als einander ergänzende Formen angenommen werden sollen. (S. 90)
(Ich möchte hier nicht auf weitere Ausführungen von Pieper über Gilligan eingehen, da jene das Werk in Kurzform darbringt, was wir im Reader auch tun.) Als Kritik äußert Pieper an Gilligan, daß sie keinen Weg bietet, wie im Konfliktfall ein Konsens zwischen den beiden unterschiedlichen Standpunkten erzielt werden kann, wenn jeder gemäß seiner Binnenlogik moralisch gerechtfertigt werden kann (S. 99). Was also macht die Einheit der Moralen aus und wie ist sie herstellbar? Gilligan kommt es darauf an, die Grenzen der eigenen Perspektive zu erkennen und damit zu einer unzuverlässigen Verengung und Einseitigkeit bei moralischen Urteilen entgegenzuwirken.
Als Fazit aus der Diskussion mit Gilligan zieht Pieper: „Es gilt somit zu lernen, den Blick auf die jeweils andere Moralperspektive zu fokussieren, um einerseits das (männliche) Vorurteil auszuräumen, zwischenmenschliche Beziehungen seien ein Hindernis für Autonomie und Unabhängigkeit, und andererseits dem (weiblichen) Vorurteil zu begegnen, das Streben nach Autonomie führe automatisch zu Isolation und Brutalität.“ (S. 100).
Im zweiten Teil widmet sie sich dem Pro und Contra in der Gilligan - Kontroverse. Uns ist es wichtig, sowohl positive als auch negative Aspekte der Gilligan - Analyse aufzuzeigen.
Seyla Benhabib hat in der Kontroverse Stellung für Gilligan bezogen. Für sie sind in der Moderne die männliche und weibliche Kompetenz streng getrennt: auf der einen Seite der der Gerechtigkeit verpflichtete autonome Mann, auf der anderen Seite die zum Zweck der Fürsorge in den Haushalt abkommandierte Frau. Benhabib ergänzt Gilligan, indem sie die historischen Wurzeln der in der Gegenwart vernehmbaren „anderen Stimme“ als das Echo jenes Befehls hörbar macht, den die Frauen unter dem Druck der Verhältnisse als ihr Über-Ich internalisiert haben.
Gudrun Nummer-Winkler versucht den Nachweis zu erbringen, daß die Zuordnung
von Moralorientierungen und Geschlecht nicht haltbar ist. Sie beruft sich darauf, daß Kinder sehr früh begreifen, daß in einer Gesellschaft bestimmte Regeln gelten, die allgemein und unabhängig von Autoritäten Gültigkeit haben. Diese Regeln, die überall Bedeutung haben, sind moralische Regeln. In ihren Tests urteilten sowohl Jungen als auch Mädchen aus beiden Moralperspektiven. Hierzu sagt Pieper, daß die Testergebnisse Nummer-Winklers nicht verwunderlich seien, da sie den männlichen Mythos von der einen Moral bestätigen, denn alle traditionelle Moral ist in der Wurzel männlich. Die weibliche Moral ist nur eine Erfindung von Männern, die Autonomie für sich zu reklamieren und den Frauen jene Tätigkeiten auftrugen, die eines Mannes nicht als würdig erachtet wurden.
Marilyn Friedmanns These nach werden die Geschlechter auf unterschiedliche Weise moralisiert. Sie ist der Meinung, daß die Übereinstimmung der meisten Frauen mit Gilligans Buch, ein Indiz dafür sei, daß sie „die symbolische moralische Stimme der Frau wahrgenommen und sie von der symbolisch männlichen losgelöst hat.“ (S. 104). Sie will damit zum Ausdruck bringen, daß Männer und Frauen mit unterschiedlichen moralischen Werten und Normen in Verbindung gebracht werden. Sie stimmt den Ergebnissen Gilligans also zu.
Nel Noddings versucht der traditionellen Prinzipienethik eine Ethik entgegen zu setzten, die auf dem weiblichen Prinzip der Eros basiert. Sie stellt die Idee der Beziehung in die Mitte ihrer Überlegungen und bezeichnet die beiden Bezugsgrößen als „Sorgenden-Teil“ und „Um sorgten-Teil“. „Eine auf dem Sorgen aufgebaute Ethik ist meines Erachtens dem Charakter nach feminin - was selbstverständlich nicht heißt, daß eine solche Ethik nicht auch von Männern geteilt werden kann.“ (S. 107) Wer aus dem Sorgeprinzip handelt, tut dieses weniger regelgeleitet und prinzipiengeleitet aus einem inneren Engagement für das konkrete, individuelle „ethische Selbst“, dessen jeweilige Situiertheit es zu berücksichtigen gilt. Gegen die Position Noddings argumentiert Sarah Lucia Hoagland. Sie ist der Meinung Noddings würde durch ihre Ausführungen nur das alte Rollenklischee bestätigen. Für Hoagland ist das Weibliche kein Gegenmittel zum Männlichen. Ihrer Meinung nach, muß das Stereotyp der bedingungslosen, opferbereiten und hingebungsvollen Liebe für den Umsorgtenteil in einer patriarchalen Gesellschaft ersetzt werden durch „die Sorge der Amazonen, welche die aus den Werten der Väter resultierenden Ungerechtigkeiten in Frage stellt.“ (S. 109)
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Piepers Analyse der feministischen Ethik?
A. Pieper untersucht im 5. Kapitel ihres Buches die Unterscheidung zwischen einer Moral der Gerechtigkeit und einer Moral der Fürsorglichkeit. Sie stützt sich dabei auf die Arbeiten von Carol Gilligan und argumentiert, dass beide Moralvorstellungen, die weibliche Fürsorgemoral und die männliche Gerechtigkeitsmoral, sich gegenseitig ergänzen sollten.
Welche Kritik übt Pieper an Gilligans Ansatz?
Pieper kritisiert, dass Gilligans Ansatz keine Lösung für Konflikte zwischen den beiden Moralvorstellungen bietet, wenn jede Perspektive innerhalb ihrer eigenen Logik moralisch gerechtfertigt werden kann. Es fehlt ein Weg, um einen Konsens zwischen den unterschiedlichen Standpunkten zu erzielen.
Was ist Piepers Fazit aus der Diskussion mit Gilligan?
Pieper schlussfolgert, dass es wichtig ist, die Perspektive der jeweils anderen Moralvorstellung zu berücksichtigen, um Vorurteile abzubauen. Dies bedeutet, das männliche Vorurteil, dass zwischenmenschliche Beziehungen ein Hindernis für Autonomie darstellen, zu beseitigen und das weibliche Vorurteil zu bekämpfen, dass das Streben nach Autonomie automatisch zu Isolation und Brutalität führt.
Welche Position vertritt Seyla Benhabib in der Gilligan-Kontroverse?
Seyla Benhabib verteidigt Gilligans Ansatz und argumentiert, dass in der Moderne männliche und weibliche Kompetenzen streng getrennt sind: der autonome Mann, der der Gerechtigkeit verpflichtet ist, und die Frau, die zum Zweck der Fürsorge in den Haushalt abkommandiert wird. Benhabib ergänzt Gilligan, indem sie die historischen Wurzeln der "anderen Stimme" als ein Echo des Befehls interpretiert, den Frauen unter dem Druck der Verhältnisse internalisiert haben.
Wie versucht Gudrun Nummer-Winkler die Geschlechterzuordnung von Moralorientierungen zu widerlegen?
Gudrun Nummer-Winkler argumentiert, dass Kinder frühzeitig erkennen, dass in einer Gesellschaft bestimmte Regeln gelten, die allgemein und unabhängig von Autoritäten Gültigkeit haben. In ihren Tests urteilten sowohl Jungen als auch Mädchen aus beiden Moralperspektiven. Pieper argumentiert, dass Nummer-Winklers Ergebnisse den männlichen Mythos von der einen Moral bestätigen, da alle traditionelle Moral im Wesentlichen männlich ist.
Welche These vertritt Marilyn Friedman?
Marilyn Friedman argumentiert, dass die Geschlechter auf unterschiedliche Weise moralisiert werden. Sie sieht die Übereinstimmung der meisten Frauen mit Gilligans Buch als Indiz dafür, dass sie "die symbolische moralische Stimme der Frau wahrgenommen und sie von der symbolisch männlichen losgelöst hat". Sie stimmt den Ergebnissen Gilligans also zu.
Welche Kritik übt Sarah Lucia Hoagland an Nel Noddings' Ethik der Fürsorge?
Sarah Lucia Hoagland kritisiert Noddings' Ethik der Fürsorge, da sie befürchtet, dass diese lediglich das alte Rollenklischee bestätigt. Für Hoagland ist das Weibliche kein Gegenmittel zum Männlichen. Sie plädiert für "die Sorge der Amazonen, welche die aus den Werten der Väter resultierenden Ungerechtigkeiten in Frage stellt."
Wie nähert sich Andrea Maihofer der Diskussion juristisch?
Andrea Maihofer stellt fest, dass "aus einer geschlechtlichen Differenz eine menschliche Differenz wird, und aus einer menschlichen Verschiedenheit eine gesellschaftliche und rechtliche Ungleichheit." Sie kritisiert, dass der allgemeine Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes der BRD in der Praxis am "Wesen des Mannes" gemessen wird. Sie fordert ein nicht-hierarchisierendes, geschlechterdifferenzierendes Recht, das es der Frau erlaubt, als eigenständiges Rechtssubjekt ihre Rechte wahrzunehmen.
- Arbeit zitieren
- Kirsten Fricke (Autor:in), 2000, Feministische Theologie - A. Pieper, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103793