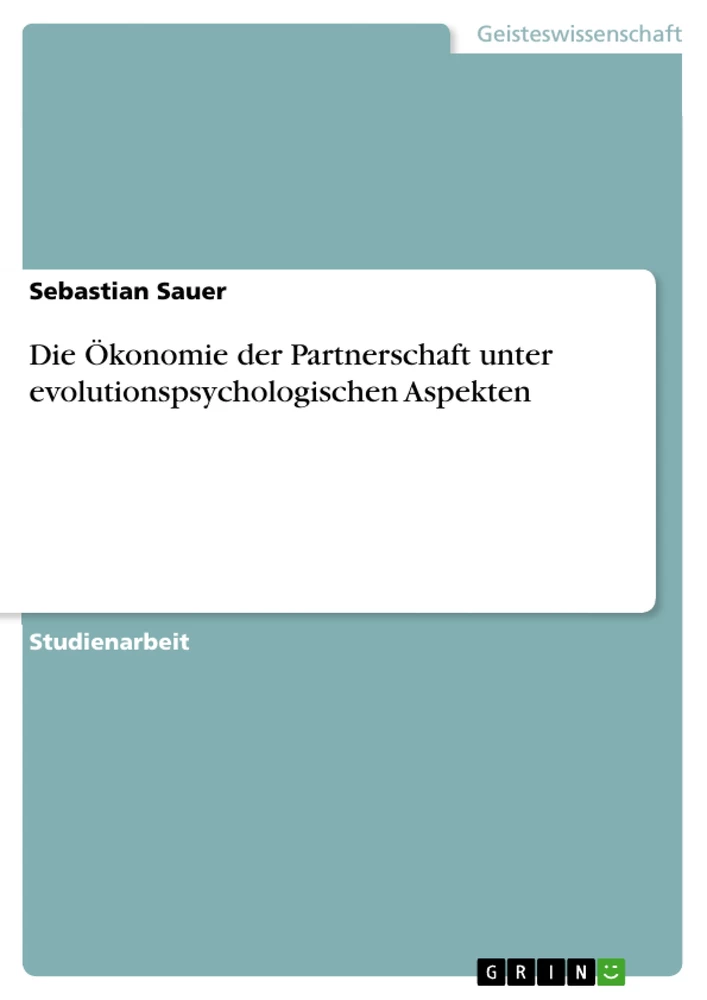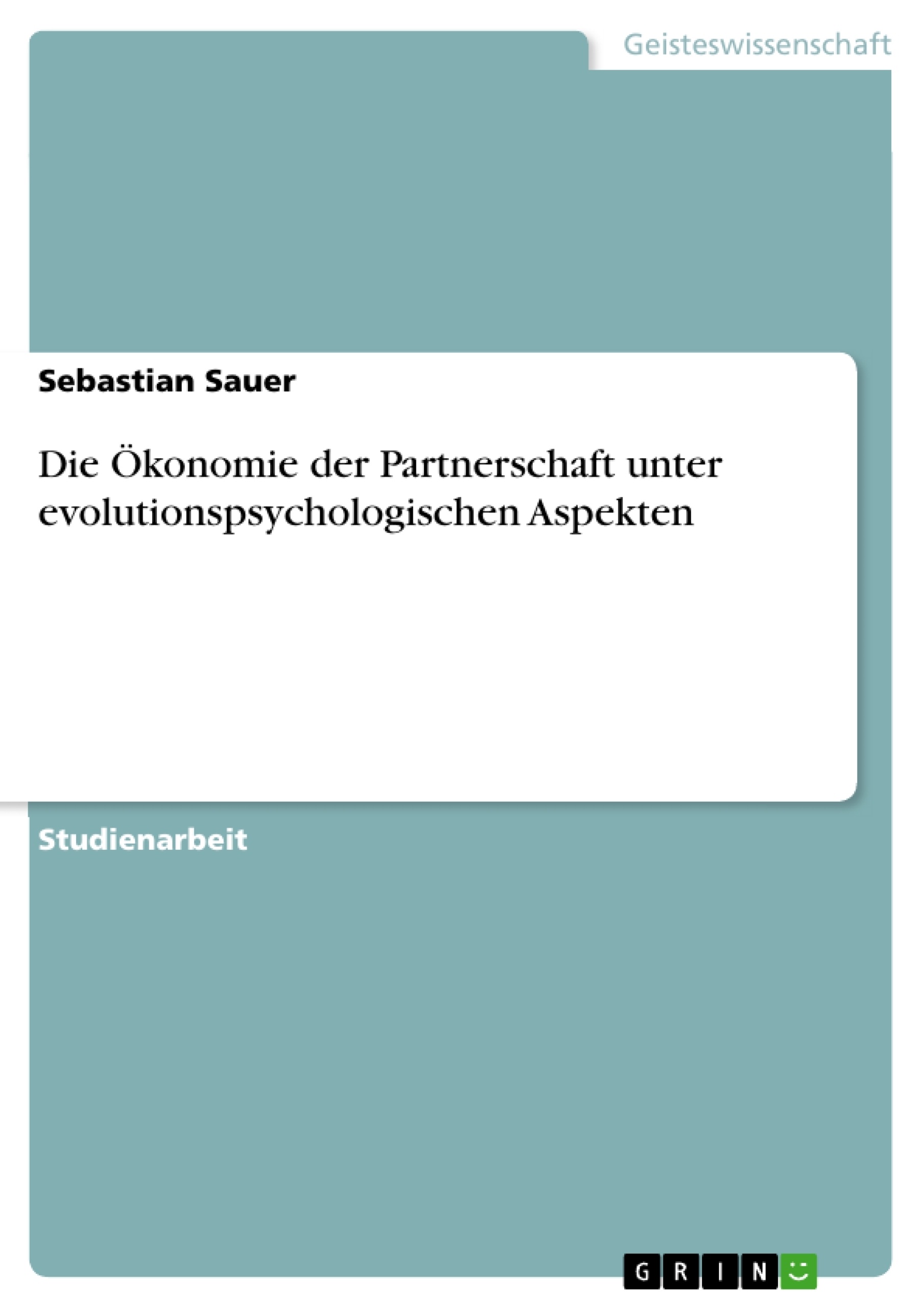Warum verlieben wir uns? Was treibt uns an, Bindungen einzugehen und uns für einen Partner zu entscheiden? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der evolutionären Psychologie und entdecken Sie die verborgenen Mechanismen, die unser Paarungsverhalten steuern. Dieses Buch enthüllt die tief verwurzelten biologischen Grundlagen unserer Partnerwahl, von den Kosten-Nutzen-Aspekten des "Mate Value" bis hin zu den subtilen Signalen, die wir unbewusst aussenden und empfangen. Erforschen Sie die geschlechtsspezifischen Strategien, die sich im Laufe der Evolution entwickelt haben, um den Fortpflanzungserfolg zu maximieren, und lernen Sie, wie sexuelle Eifersucht, Spermienkonkurrenz und die verborgene Ovulation unsere Beziehungen beeinflussen. Entdecken Sie, wie Alter, Status und äußeres Erscheinungsbild als Indikatoren für Fruchtbarkeit und Ressourcen dienen und wie die Handicaptheorie und die Heiratsmarkttheorie unsere Entscheidungen lenken. Verstehen Sie die Bedeutung von assortative mating und inklusiver Fitness für die Stabilität von Partnerschaften. Dieses Buch bietet intrigante Einblicke in die komplexen Dynamiken der Liebe und des Begehrens und regt zum Nachdenken über unsere eigenen Verhaltensmuster an. Es beleuchtet die evolutionären Wurzeln scheinbar irrationaler Verhaltensweisen und bietet neue Perspektiven auf die Herausforderungen und Chancen moderner Beziehungen. Eine fesselnde Reise durch die Wissenschaft der Liebe, die unser Verständnis von uns selbst und unseren Beziehungen revolutionieren wird. Lassen Sie sich von den verblüffenden Erkenntnissen über die biologischen Triebkräfte unseres Verhaltens überraschen und entdecken Sie, wie diese unbewussten Prozesse unsere Partnerwahl beeinflussen. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die die Geheimnisse der Liebe und des Begehrens entschlüsseln wollen, indem es die evolutionären Wurzeln unserer komplexen sozialen Interaktionen aufzeigt. Es ist eine Einladung, die Tiefen unserer menschlichen Natur zu ergründen und die evolutionären Kräfte zu verstehen, die uns zu dem machen, was wir sind: soziale Wesen, die nach Bindung und Fortpflanzung streben, gesteuert von archaischen Instinkten und modernen Ansprüchen. Eine intellektuelle Entdeckungsreise, die Ihr Verständnis von Liebe, Partnerschaft und menschlicher Natur für immer verändern wird, indem sie die evolutionären Grundlagen unseres Verhaltens in den Mittelpunkt stellt und neue Perspektiven auf die zeitlosen Fragen der menschlichen Existenz eröffnet.
Inhaltsverzeichnis
1 Evolutionstheoretische Grundlagen von Paarverhalten
1.1 Die Bedeutung der genetischen Variabilität
1.2 Evolution und Postmoderne
1.3 Anisogamie und Unterschiede der Fortpflanzungsorgane
1.4 Die Sexy-Söhne-Hypothese
2 Kosten- und Nutzenaspekte zum mate value
2.1 Asymmetrie des Investments
2.2 Maximierungstendenzen
2.2.1 Alter und Status
2.2.2 Handicaptheorie
2.2.3 Heiratsmarkttheorie
2.3 Optimierungstendenzen
2.3.1 assortative mating
2.3.2 Die inklusive Fitness
2.4 Sexökonomiemodell
3 Konsequenzen der geschlechtsspezifischen mating-Strategien
3.1 sexuelle Eifersucht
3.2 sperm competition
3.3 stille Ovulation
4 Kritikansätze und Schlussbemerkung
5 Literaturverzeichnis
1 Evolutionstheoretische Grundlagen von Paarverhalten
1.1 Die Bedeutung der genetischen Variabilität
Zu aller erst soll mittels eines kurzen Überblicks der wichtigsten Zusammenhänge der Evolutionstheorie die nötigen Grundlagen vermittelt werden um ein Nachvollziehen der weiteren Argumentation zu ermöglichen. Hierbei werden kurz Begriffe wie Variation, Kampf ums Dasein, Mutation, sexuelle Rekombination, genetische Vielfalt, sexuelle Selektion und intrasexuelle Konkurrenz erklärt.
Evolutionstheoretische Betrachtungen gehen davon aus, dass die komple- xen Charakteristika des Menschen Langzeitprodukte der Individualselektion sind. Ein Grundgedanke evolutionstheoretischer Betrachtungen ist, dass Organismen versuchen, ihre Gene möglichst erfolgreich zu verbreiten. Hierfür ist wiederum ein erfolgreiches Auseinandersetzen mit der Umwelt nötig. Genetische Variation ist weiterhin ein zentraler Faktor im Kampf ums Dasein. Sie ist die Voraussetzung um die verschiedensten ökologischen Nischen zu besetzen. Die Fähigkeit, sich an möglichst viele unvorhergesehene Situation anzupassen, bringt Erfolg1. Ohne die- se Möglichkeit der Anpassung müsste eine Art aussterben, sobald sich die ökolo- gischen Gegebenheiten ändern. Die Fähigkeit, sich spontan zu vermehren, wird durch die Begrenztheit der Ressourcen wie Nahrung, Raum und Wasser, limitiert. Dies zwingt die Lebewesen zu existenzieller Konkurrenz, zum „Kampf ums Da- sein“ („struggle for live“ (Darwin, 1871)) - je besser die „Angepasstheit“, desto hö- her der Reproduktionserfolg2.
Die Vielfalt der Lebewesen wird hauptsächlich durch zwei Mechanismen gewährleistet: Mutation und sexuelle Rekombination.
Die Mutationsrate eines Gens schätzt man auf 10-8, d.h. 1:100.000.000. Un-ter 100.000.000 ist mindestens eine Mutante. Je nach Art der Mutation verändert sich der Phänotyp des Individuums mehr oder weniger. Normalerweise sind Muta- tionen für die einzelnen Individuen von Nachteil, was sich aber bei geänderten Umweltbedingen ändern kann3. Unter bestimmten Bedingungen ist eine Mutante der ursprünglichen Form gegenüber im Vorteil. Die verschiedenen Variationen konkurrieren nun in Abhängigkeit der Umweltbedingungen uns der Lebensräume. Die bestangepasste Version setzt sich mit der Zeit durch, da sie sich rascher ver- mehren kann.
Allerdings haben diejenigen Genome, die nicht auf eine Mutation warten müssen, sondern zusätzlich auf sexuelle Neukombinationen zurückgreifen, größere, Überlebenschancen.
Durch die Zufallsaufteilung des diploiden menschlichen Chromosomensatzes in zwei haploide Gameten, wird bei deren Vereinigung, die Neukombination des genetischen Materials sichergestellt4. So entstehen (abgesehen von eineiigen Zwillingen) immer verschieden Genome. Biologisch gesehen, ist der alleinige Sinn und Zweck der Sexualität die „Durchmischung“ des genetischen Materials. Die zum Überleben erforderliche „adaptive Elastizität“ wäre ohne die genetische Variabilität zweier Elternteile nicht denkbar (Bischof, 1980).
Darwin (1871) zeigte, dass es üblicherweise die Männchen sind, die Wettbewerb betreiben und die Weibchen, die Männchen auswählen ( - female choice (Wrangham, 1986)); man spricht von sexueller Selektion.
Crook (1972) postuliert den Begriff der „intrasexuelle Konkurrenz“ und schreibt dazu:
Intrasexuelle Konkurrenz zwischen Maskulinen entsteht nicht nur um den Zugang sexuell empfängnisbereiter Femininen, sondern weniger direkt auch zu den Ressourcen, den Gebrauchsgegens-tänden, womit sie eine Gruppe von Femininen unterhalten kön-nen, um ihre Jungen bis zur Reife aufzuziehen.
Insofern geht es um Verhaltensmerkmale „um dem Individuum biologische Vorteile zu gewähren im Hinblick auf (Crook, 1972):“
- ein Überleben vor der Reproduktion
- Bildung von Zygoten, also Paarungserfolg
- Geburt von Nachkommen
- deren Aufzucht bis zur Reife, also Reproduktionserfolg
- die Beförderung naher Verwandter5 (Tekla 1994).
1.2 Evolution und Postmoderne
Sobald also Sexualität eine bedeutende Rolle fürs Überleben spielt, gewinnt auch die Partnerwahl (mating) an Brisanz. Dabei muss das phylogenetische Erbe des Menschen im Hinterkopf behalten werden, wenn es darum geht, auffällig redundante Verhaltensmuster und Rituale zu verstehen.
In diesem Aufsatz sollen Verhaltensphänomene besprochen werden, die sich entwickeln konnten, weil sie besonders gute evolutionäre Anpassungen darstell- ten. Eine solche Anpassung (wie zum Beispiel die Eifersucht6 ) ist entstanden, weil sie sich in der Steinzeit gut bewährt hat. 99 Prozent seiner Entwicklungsgeschich- te, respektive 4,5 Millionen Jahre lang, lebte der Mensch als Jäger und Sammler, ehedem in der Savanne Afrikas (Der Spiegel, 16/2000). Das Bestehen dieser An- passungen ist unabhängig davon, wie vernünftig dieses archaische Verhalten heu- te ist. Dies wäre eine Erklärung, warum bestimmte Verhaltensmuster aus heutiger Sicht unvernünftig sind. Barkow (1992) argumentiert, dass Verhaltensmechanis- men, die sich als Anpassung an eine bestimmte, Hunderttausende von Jahren währende Umweltsituation entwickelt haben, nicht mehr angepasst sind, wenn sich die Umweltsituation inzwischen geändert hat. Die ursprünglichen Anpassun-gen sind erst in Zehntausenden von Jahren selektiert worden. Dieser Zeitraum ist für evolutionäre Anpassungen notwendig. Die beschleunigte Änderung der Umwelt durch eine sich explosionsartig ausbreitende und technisch immer versiertere Menschheit lässt der Evolution nicht die Zeit, entsprechende Adaptionen hervor- zubringen. Das heutige postmoderne Leben in den Millionenstädten unserer Tage unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem der Jäger und Sammler, die unse- re Vorfahren waren. Nahrungsüberfluss, Bewegungsarmut, geringe Kindersterb- lichkeit sind alles Faktoren, die phylogenetisch gesehen, vollkommen neu sind7. Um Sinn und (scheinbaren) Unsinn von Verhaltenstendenzen zu verstehen, sollte dies in Erinnerung behalten werden. Insbesondere im Bereich der Partnerwahl verdient folgende Hypothese Beachtung: Je kritischer ein Entwicklungsstadium für den Fortpflanzungserfolg eines Organismus ist, desto rigider müssen die entspre- chenden Passungen sein (Grammer und Atzwanger, 1993). Neben Geburt, Säug- lings- und Kleinkindalter und Pubertät ist die Phase der Partnerwahl ein solch kriti- sches Stadium (Grammer, 2000):
Abbildung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Lebenszyklen des Menschen und kritische Stadien: Sterberaten in Deutschland 1972/75
1.3 Anisogamie und Unterschiede der Fortpflanzungsorgane
Festzuhalten bleibt, dass die Entwicklung der Sexualität für das Überleben der Genome überlebensnotwendig war. In diesem Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, wie sich zwei verschiedene Geschlechter, bezüglich Gameten und Fortpflanzungsorganen, entwickeln konnten.
Parker et al (1972) gehen davon aus, dass die Gameten ursprünglich etwa gleich groß waren (Isogameten). So entstehen durch Kombination zweier Game- ten zu einer Zygote im Laufe der Zeit unterschiedlich große Zygoten. Indem man davon ausgeht, dass die Fitness einer Zygote mit ihrem Volumen proportional wächst, dann haben Individuen, die auf einen großen Nährstoffanteil zurückgreifen können, einen Wachstumsvorsprung zu den Individuen, bei denen dies nicht der Fall ist. So könnte eine Selektion zu großen Gameten hin angesetzt haben (Rei- mers, 1994).
Kleine Geschlechtszellen wiederum haben den Vorteil, dass sie erstens mobiler und zweitens leichter herzustellen sind. Somit ist die Auftreffenswahr- scheinlichkeit zweier kleiner Gameten am größten. Es werden auch ein kleiner und ein großer Gamet aufeinander treffen; zwei große jedoch seltener (da sie sel- tener und langsamer sind). So könnte eine Selektion zu kleinen Zellen hin ange- setzt haben. Zudem haben kleinere Zellen eine höhere Mutationsrate, da sie zahl- reicher sind - Sie sind also schneller beim „Herausfinden“ von Strategien die zu einer Verschmelzung führen.
Der Reproduktionserfolg eines Gameten hängt also von 2 Faktoren ab:
- ihrem Nährstoffanteil
- ihrer Mobilität.
Computersimulationen von Parker et al. (1972) zeigen, dass eine Selektion zu Extremtypen hin entsteht: Erzeuger großer Gameten, die ihren Nachkommen viel Nährstoff mit auf den Weg geben gegenüber von Erzeugern sehr vieler kleiner Gameten. Zwei große Gameten hätten einen Nährstoffvorsprung, sind aber selten und müssten daher viel Energie zur Suche verwenden. Zwei kleine Zellen wiederum hätten wenig Energiereserven.
Die Fitness einer Zygote steigt also proportional zu der Fusionswahrscheinlichkeit ihrer Gameten und der Zygotengröße.
Damit entstünden zwei konträre Fortpflanzungsstrategien: Samenproduzen- ten (kleiner Gameten) - männlich - und Eiproduzenten (großer Gameten) - weib- lich (Reimers, 1994).
Dass beide Geschlechter unterschiedliche Fortpflanzungsorgane haben, erklärt sich aus der „Erfindung der inneren Befruchtung“ (Bischof, 1980). Dies ist effektiver, als das Keimmaterial ins Meerwasser zu entlassen. Aufgrund der höheren Beweglichkeit der Samenzelle findet die Fusion beider Gameten im Organismus des Produzenten der großen Gameten statt (Hejj, 1996).
1.4 Die Sexy-Söhne-Hypothese
Fischer (1930) geht davon aus, dass durch die weibliche Wahl bestimmte männli- che Attribute favorisiert werden. Dadurch verschöbe sich bei Wahl an absoluten Kriterien das Erscheinungsbild der Männer bis es schließlich den Vorstellungen der Frauen entspräche. Wählen nun die Frauen anstelle absoluter relative Krite- rien, erreichen sie eine kontinuierliche Verschiebung der Verteilung dieses Merk- mals in der männlichen Population, da die Söhne der Männer, die dem weiblichen Ideal entsprechen ihre Gene bevorzugt in die nächste Generation bringen (diese Söhne sind also „sexier“ im Vergleich zu denjenigen, die dem weiblichen Ideal weniger entsprechen). Damit muss sich dann auch die Präferenzen der Frauen ins Extremere hin verschieben. Die Frauen folgender Generationen werden daraufhin gezwungen sein, noch extremer zu wählen, damit ihre Söhne als Partner zukünfti- ger Frauen interessant bleiben. Dies führt dazu, dass sich weibliche Präferenzen und männliche Attribute mit zunehmender Geschwindigkeit in die selbe Richtung bewegen (Grammer, 2000).
Eine Selektion in eine andere Richtung ist immer dann vorstellbar, wenn Umweltbedingungen den Überlebensvorteil deutlich höher bewerten als die „Sexyness“ der Männer (Grammer, 2000).
2 Kosten- und Nutzenaspekte zum mate value
2.1 Asymmetrie des Investments
Aufgrund der oben erläuterten Voraussetzungen produzieren Männchen eine große Anzahl von Spermien. Ihr Investment (Kosten) in die Kopulation ist sehr niedrig. Ökonomisch betrachtet lohnt es sich, zu investieren, wenn die Kosten sehr niedrig sind, der potenzielle Nutzen hingegen hoch. Maskuline könn(t)en in rascher Abfolge eine große Anzahl von Weibchen begatten. Der limitierende Faktor, der den Fortpflanzungserfolg begrenzt ist (nur) die Fähigkeit, Weibchen anzulocken. Aus diesem Grund ist zu erwarten, dass Männchen um Möglichkeiten der Befruchtung miteinander im Wettstreit liegen.
Weibchen stehen meist nur eine sehr begrenzte Anzahl von Gameten zur Verfügung (beim Menschen etwa 35 Jahre lang monatlich ein Ei). Dazu kommt, im Falle einer Befruchtung, eine hohe Investition an Zeit und Ressourcen. Auch nach der Geburt endet das Investment für das Weibchen nicht; sie ist gezwungen weiter zu investieren - will sie das bisherige Investment nicht verlieren. Ein Männchen kann kopulieren und dann verschwinden, mit der antizipierten Versorgung des Nachwuchs durch das Weibchen. Das Weibchen gut daran, das Männchen zum Bleiben zu überreden. So senkt sie ihre Kosten zulasten des Männchens, der in diesem Zeitraum weiteren Nachwuchs zeugen könnte. Deswegen sollten Weib- chen, wie diese ökonomischen Überlegungen zeigen, in der Auswahl ihrer Ge- schlechtspartner weit wählerischer sein (Grammer, 2000). Diese Befunde wurden von Bateman (1948) an der Drosophilia Melanogaster empirisch erhärtet. Trivers (1972) schlägt vor, dass das Weibchen höhere Ansprüche an den Partner hat als das Männchen. Es lohnt sich anspruchsvoll zu sein: die Kosten der Paarung kön-nen schließlich niedriger sein bei sorgfältiger Prüfung - im Gegensatz zu einer zufälligen Verpaarung.
Diese angenommene Asymmetrie hat weitreichende Folgen. Die Frauen stellen einen Engpass der Vermehrung für die Männer dar. Die Summe aller Kin- der von Männern muss der Summer der Kinder der Frauen entsprechen. Da sich in vielen Kulturen die Männer häufiger fortpflanzen heißt das, bei angenommener gleicher Häufigkeit beider Geschlechter, dass sich einige Männer gar nicht fort- pflanzen.
In dem Moment nun, wo zwei Individuen zusammen mehr Nachwuchs hervorbringen, als jeweils zwei einzelne, wird eine Selektion zu väterlichem Investment in Gang gesetzt (Grammer, 2000). Eine plausible Schlussfolgerung wäre demnach, dass das Männchen dem Weibchen bei der Aufzucht der Jungen hilft und nebenbei versucht, möglichst viele Weibchen zu befruchten (was rein ökonomisch betrachtet den höchsten Gewinn verspricht).
Trivers (1972) führt weiterhin an, dass bei monogamen Arten derjenige Partner, der das geringere Investment trägt, in Versuchung geführt wird, seinen Partner nach der Kopulation zu verlassen. Er kann darauf spekulieren, dass der Zurückgebliebene, um seine bisherigen Investitionen nicht zu verlieren, die weite- ren Kosten übernimmt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass er weniger zu verlie- ren hat, bzw. die Motivation für Folgeinvestition beim „Sitzengelassenen“ höher ist. Beim Menschen hieße das, dass der Mann aufgrund dieser Investmentasymmetrie (praktisch) nichts verlöre, ließe er die Frau direkt nach der Kopulation zurück - rein in Kosten-Nutzen-Relation dieser Theorie gesehen. Gelingt es der Frau, dem Mann zum Bleiben zu bewegen und sich so das Investmentverhältnis verschiebt, kann es zu einem Ausgleich kommen, wenn beide etwa gleich viel investiert ha- ben. Somit erlischt die Versuchung zum „Sitzen lassen“ dann.
Die Zeit die beide Geschlechter zur Entscheidung brauchen, ist unter- schiedlich: Männer werden zur schnellen Entscheidung drängen, Frauen hingeben sich Zeit lassen. Für Männer ist Zeit kostbar, da sie in dieser Zeit schon wieder andere Frauen umwerben könnten. Außerdem lauert für den Mann immer die Ge-fahr des Betrugs durch die Frau. Für Frauen hingegen steht mehr Investment auf dem Spiel. Letztlich geht es für sie um zwei Dingen: erstens um die Bereitschaft und Fähigkeit zum Folgeinvestments des Mannes und zweitens um die Qualität seiner Gene. Der Mann wird versuchen die Frau von beidem zu überzeugen. Die Frau hingegen sollte eingehend prüfen (Grammer, 2000).
Im nächsten Absatz soll untersucht werden, anhand einiger ausgewählter An- sätze, die keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, welches die hohen Ansprüche der Frauen an Männer nun sind und welche die der Männer an Frauen.
2.2 Maximierungstendenzen
Aufgrund der vorhergehenden Überlegungen kann man leicht auf ein ideales An- forderungsprofil der Femininen an Maskuline schließen. Je mehr Bereitschaft und Fähigkeit das Männchen zum (Folge-)Investments zeigt, desto besser für das Weibchen. Wo die Varianz der Männchen diesbezüglich nur genügend hoch ist, wird das väterliche Investment zum kritischen Faktor. Die Hypothese, dass Weib- chen sich in erster Linie mit Männchen einlassen, welche die größeren Geschenke bringen, wurde empirisch bei mehreren Arten erhärtet (Lack 1940, Trivers 1985). Dies hat zwei Vorteile für Weibchen:
- Einen direkten materiellen für das Weibchen und seinen Nachwuchs
- Wenn die Qualitäten des Vaters (wenigstens teilweise) vererbbar sind, einen reproduktiven Vorteil für die Söhne des Weibchens.
Hinde (1984) postuliert deswegen wie folgt:
In der sexuellen Attraktivität sollten wir Geschlechtsunterschiede fin- den. Männer sollten Frauen anziehend finden, deren Charakteristika aussagen, dass sie den Nachwuchs des Mannes erfolgreich aufzie- hen können. Im Gegensatz dazu sollten Frauen Männer anziehend finden, die signalisieren, dass sie gute Versorger und Beschützer sind.
Männlichsein und Weiblichsein sind demnach zwei unterschiedliche Überlebensstrategien, die sehr unterschiedliche Ziele verfolgen. Sie haben nur ein Problem gemeinsam, nämlich den bestmöglichen Partner zu finden und so die Fitness direkt zu steigern (Wickler und Seibt, 1977).
2.2.1 Alter und Status
Relativ einfache Ansatzpunkte für Partnersuchbilder aus evolutionstheoretischer Sicht sind Alter und Status. Der mate value ist das Merkmal, das die Suche in ers- ter Linie bestimmt. Er hängt bei einer Frau nach Triver (1972) stark von ihrem Alter ab. In allen Kulturen sind weibliche Fruchtbarkeit und reproduktiver Wert sehr stark altersabhängig (Williams, 1975). Bei Männern spielt das Alter diesbezüglich eine weit weniger wichtige Rolle. Der reproduktive Wert kann als Einheiten von zukünftig erwarteten reproduktiven Einheiten definiert werden. Mit etwa 15 Jahren erreicht er bei Frauen einen Höhepunkt und nimmt daraufhin immer weiter ab. Für Fruchtbarkeit der Frau verhält es sich analog, nur dass der Höhepunkt in den frü- hen Zwanzigern liegt. Chisholm (1991) argumentiert hingegen, dass Männer sich bevorzugt Frauen in den Spätzwanzigern aussuchen, da diese den qualitativ hochwertigsten Nachwuchs hervorbrächten8. Darüber hinaus werden junge Frau- en zu oft und zu schnell schwanger, was verhängnisvolle Folgen für das Kind und für ihre eigene reproduktive Zukunft hat (Lancaster und Hamburg, 1986, Winikoff, 1983).
In beiden Fällen ist es das äußere Erscheinungsbild9, das an Jugendlichkeit verweist, wie weiche Haut, glänzende Haare oder ein Hüften-Taille-Verhältnis vonn .7 (Spiegel, 16/2000). Also alles Signale, die für gute Reproduktionskapazitäten und Fruchtbarkeit sprechen. Diese Indikatoren sollten für Männer attraktiv sein10.
Analog sollte für Frauen das äußere Erscheinungsbild von Männern - dies- bezüglich - weniger wichtig sein. Da wie oben bereits erwähnt, die Frau ihre Kos- ten in die Nachkommen nur durch das Folgeinvestment des Mannes reduzieren kann, sollte sie vor allem Wert auf den Status des Mannes legen. „Status“ definie- ren wir als die Fähigkeit und Bereitschaft eines Mannes zum Investment in den Nachwuchs. Darunter fällt auch die Potential der Überlebenssicherung des Nach- wuchs. Saddala et al (1987) konnten auch tatsächlich feststellen, dass Frauen Männer attraktiv bewerten, die nicht-sprachliche Zeichen von Dominanz zeigten. In seiner Studie (1989) konnte Buss zeigen, dass in 36 von 37 Kulturen die Ver- dienstmöglichkeiten des Mannes, sein Ehrgeiz und seine Unternehmungslust von Frauen als Partnerwahlkriterium wichtiger bewertet wurde als von Männern11. Safi- lios-Rothschild (1976) belegte, dass Frauen den Status des Partners höher schät- zen als Männer den Status einer möglichen Partnerin (Abbildung 2):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 Ansprüche an den Status des Partners und eigener Status
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3 Ansprüche an die Attraktivität des Partners und sozialer Status
* Hohe Prozentwerte in Fragebogenpunkte geben an, dass dieser Punkt für die Person von hoher Bedeutung ist.
Wohingegen Männer mit steigendem eigenem sozialen Status die Attraktivität ihrer Partnerin zunehmend wichtiger wird (Abbildung 3).
Dass es ein tatsächliches, dieser weiblichen Suchstrategie entsprechendes männliches Verhalten gibt, konnte Phelps (1988) zeigen. Demnach besteht ein Zusammenhang zwischen väterlichem Investment in den Nachwuchs und einer Tendenz im Geschäftsleben nach Macht zu streben. Es zeigt sich, dass ein Familienoberhaupt eifriger versucht, sein Vermögen zu vermehren und dieses dann auch in die Kinder investiert.
2.2.2 Handicaptheorie
Zahavi (1975) schlägt vor, dass Männchen mit Extremcharakteristiken dem Weib- chen demonstrieren, dass sie sogar mit diesem „Handicap“ überleben können. Wenn sich ein Männchen also ein hohes Handicap leisten kann, wäre es also ein guter Partner. Weibchen wählen dann diese Männchen aus und werden dann da- für mit hoher Fitness ihres männlichen und weiblichen Nachwuchs belohnt. Extrem große sekundäre Geschlechtsmerkmale (bei Männern beispielsweise breites Kinn und breiter Nacken und Bart (Hirschberg et al, 1978)) entstehen unter dem Ein- fluss von Sexualhormonen. Testosteron ist nun auch ein starker Immunsuppres- sor. Das Weibchen könnte nun annehmen, dass das Männchen sehr wieder- standsfähig sein muss, mit einem geschwächten Immunsystem überlebt zu haben. Ferner ist jedoch nicht eine hohe Konzentration an Testosteron nötig um das ein- mal geschaffene (gewachsene) Merkmal aufrecht zu erhalten. Es ist also möglich, dass das Handicap nur zu einem Zeitpunkt eine Behinderung darstellte (Wickler und Seibt, 1997).
2.2.3 Heiratsmarkttheorie
Eine Reihe von nach evolutionstheoretischen Überlegungen geprägten Wahlpa- rametern prägt das Mating-Verhalten auch heute. Zentral ist, dass die Partnersu- chenden in ihren Ansprüchen ihren eigenen mate-value verrechnen. Männer zie- hen hierfür ihren Status in Kalkulation. Grammer (2000) stellt dar, dass für Männer mit hohem Einkommen Attraktivität, Sexyness, Submissivität und Konservativität eine wichtige Rolle spielt. Eine aufregende Persönlichkeit empfinden sie als an- ziehend. Hingegen Männer mit geringem Status geben an, emotionale Wärme, Häuslichkeit, Kinderwunsch und Dominanz zu bevorzugen. Für Frauen lassen sich ähnliche Befunde feststellen.
Wilson (1987) argumentiert nun, dass Angebot und Nachfrage den mate- value einer Person diktieren. Der mate-value eines Merkmalträgers ist umso höher je seltener ein wichtiges Merkmal (je geringer das Angebot und je höher die Nach- frage) ist, welches er besitzt. Der mate-value beschreibt, wie viele potentielle Part- ner das Individuum haben könnte. Personen werden sich nur solche Partner su-chen, die ihrem Partnerwert entsprechen. Das bedeutet also, dass diejenigen, die ihren mate-value als hoch erachten, ihre Ansprüche entsprechend nach oben schrauben werden12.
Logische Konsequenz dieser Heiratsmarkttheorie wäre, dass sich Paare aufgrund der sozialen und physischen Attraktivität zusammenschlössen. Jeder Bewerber wählte den attraktivsten Partner aus. Nach einiger Zeit wären die be- gehrtesten Individuen vergeben. Nun sollte eine Wahl nach Gleichheit einsetzen, vor allem dann, wenn ein Individuum feststellt, dass die Zeit knapp wird. Das heißt, der Partnersuchende wird sich mit einer Person (höchstens) mittlerer Attrak- tivität begnügen müssen. Berscheid et al (1971) konnte dies empirisch belegen. Dies führt uns zu Homogamie- und assortative-mating-Überlegungen, die im nächsten Absatz erörtert werden sollen.
2.3 Optimierungstendenzen
2.3.1 assortative mating
Es ist also davon auszugehen, dass der Heiratsmarkt eine Tendenz zur Passung der Attraktivität induziert.
„Gleich und Gleich gesellt sich gern“ ist eine volkstümliche Deutung des Partnerwahlkriteriums der Homogamie. Einen Beleg für diese Thesen liefert Has- sebrauck (1990). Es zeigte sich bei einer Erhebung mittels dem FPI, dass die von Frauen wahrgenommene Qualität einer intimen Sozialbeziehung hoch mit den an- tizipierten Einstellungsüberschneidungen korreliert. Darüber hinaus kann Olbrich (1987) eine Reihe von Studien zitieren, die auch für Rasse, Nationalität und Reli-giosität die Homogamiethese unterstützen. Jäckel (1980) kann für München eine Homogamie der sozialen Schichten nachweisen - geheiratet wird nur in die eige- nen Kreise. Die Relevanz der räumlichen Nähe können Katz und Hill (1958) bele- gen. Assortative mating tritt also sowohl bei anthropometrischen Merkmalen wie Aussehen auf, aber auch bei psychischen und sozialen Attributen (Amelang, 1995)13.
Falls assortative mating genetisch determinierte Attribute betrifft, wird es zu einer Zunahme von Homozygotie kommen. Bei rezessiven oder polygenen Erb- gängen mit Schwelleneffekt kann es überhaupt erst zu einer phänotypischen Manifestation eines Merkmals führen. (Amelang, 1995). Die Verwandten einer Familie werden sich untereinander ähnlicher werden, wohingegen die Unterschiede zwischen den Familien größer werden mit der Zeit. Damit wird auch die Spannweite an Merkmalsunterschieden in der Population insgesamt größer, wie Jensen (1978) zeigen konnte. Auch wies er darauf hin, dass aufgrund von (positive) assortative mating es etwa zwanzigmal mehr Personen mit einen IQ über 160 gibt, als man durch Zufallspaarungen erwarten könnte. Über viele Generationen hinweg muss davon ausgegangen werden, dass die kumulativen Effekte enorm sein könnten.
Disassortment hingegen verhindert solche Divergierungstrends, da es Mi- scherbigkeit fördert, so dass weniger Extremtypen entstehen. Extreme Merkmals- träger werden von der Selektion am ehesten gefördert oder benachteiligt. Daher behindert disassortment die Möglichkeit einer gerichteten Evolution (Amelang, 1995).
Allerdings führen epigenetische Regeln zu einer oberen Grenze von assor- tativen Verheiraten. Durch negative sexuelle Prägung von Menschen, die mitein- ander aufwachsen, wird Inzest durch zu eng verwandtschaftliches Verheiraten verhindert (Lumsden und Wilson, 1981). Inzucht hat negative Auswirkungen auf den Reproduktionserfolg des Nachwuchses, wie unter anderem Schull und Nell (1965) feststellten. Sie verglichen in Japan 2300 Kinder von Ehen zwischen Cousins ersten Grades mit Kindern aus Ehen, in denen die Eltern nicht verwandt waren. Es geht klar aus diesen Studien hervor, dass die Kinder der ersten Gruppe in Vergleichen der Gesundheit, Lebenserwartung, Leistungsfähigkeit deutlich schlechter abschneiden.
Reinerbigkeit wirkt sich zudem negativ auf die Parasitenresistenz aus. Zu- dem sind Personen je mischerbiger sie sind, generell attraktiver (Grammer, 2000).
Demnach muss es eine optimale genetische Entfernung zum Partner ge- ben. Darauf und auf die Konsequenzen soll im nächsten Abschnitt eingegangen werden.
2.3.2 Die inklusive Fitness
Hamilton (1964) fragt nun, wie sich ein Gleichheitsprinzip bei Paaren im Laufe der Evolution entwickelt haben könnte. Erfolgreiche Gene bergen nicht nur Vorteile für den Träger, sondern auch für dessen Verwandte. Zum einen bedeutet dies, dass Verwandte zumindest teilweise die selben Gene besitzen und zum andern dass sich deshalb diese Gene nicht nur durch ihren Träger, sondern auch durch ihre Auswirkungen auf dessen Verwandten ausbreiten können.
Das Prinzip der inklusiven Fitness beruht nun auf Kosten- (k) und Nutzenvergleichen (n) von Verhalten. Das bedeutet, ein Verhalten wird ausgeführt, wenn sein Nutzen größer ist als dessen Kosten. Sind die Kosten größer, muss derjenige zu dessen Nutzen ich handle, mit mir verwandt sein (r). Je näher die Verwandtschaft, respektive je größer r, desto höher dürfen die Kosten sein:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dies ist der Ansatzpunkt für die assortative Paarbildung und ihre Obergren- ze. Individuen sollten die Genübergabe optimieren, indem sie mit Partnern kopu- lieren, die ähnliche Gene teilen. Das Ergebnis wären Kinder, die mehr als die nor- mal zu erwartenden 50% Genüberseinstimmung mit dem Elternteil vorweisen. Logisch schlüssig wird die Überlegung, da hierdurch ein Gewinn an Genvermeh- rung erzielt wird, ohne dass mehr Investment getätigt werden muss. Ebenfalls werden durch den höheren „Verwandtschaftsgrad“ die Kosten für altruistisches Verhalten vergleichsweise reduziert. Wenn sich also zwei Ehepartner ähnlich sind, werden sich ihre Kinder noch mehr ähneln, in der Familie wird es also altruisti- scher zugehen, als in einer Familie, in der die Eltern nur eine durchschnittliche Ähnlichkeit vorweisen. Empirisch erhärtet werden kann diese Hypothese durch Rushton (1989). Er stellt fest, dass Kinder die ihren Eltern sehr unähnlich sind, wie zum Beispiel Stiefkinder, in Gefahr laufen, nicht altruistisch behandelt zu werden. Ein überverhältnismäßig hoher Anteil an Kindern, die geschlagen werden, sind Stiefkinder (Lightcap, 1982). Grammer (2000) fasst zusammen:
Die Hauptselektion geht in Richtung positive assortative Verpaa- rung, obwohl der Grad, zu dem dies möglich ist, durch die poten- ziellen Gefahren der Inzuchtdepression und die Nachteile der Reinerbigkeit in Bezug auf Parasitenresistenz eingeschränkt wird. Individuen heiraten sich aufgrund von Ähnlichkeit bis zu dem Punkt, an dem erhöhte Reinerbigkeit die Überlebensfähig- keit verringert.
2.4 Sexökonomiemodell
Symons (1979) entwickelte ein Modell, mit dem sich geschlechtsspezifische Ma- ting-Strategien erklären und einige Aussagemöglichkeiten treffen lassen. Es wird davon ausgegangen, dass Männer eine höhere Varianz bezüglich der sexuellen Attraktivität aufweisen als Frauen. Dazu kommt, dass Männer Frauen anziehender finden als umgekehrt - das Attraktivitätsmittel der Frauen ist also höher als der Männerpopulation. Grammer (2000) konnte dies empirisch belegen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4 Attraktivitätseinschätzungen (N = 79, Wilcoxon p = .02)
Die Durchschnittsfrau ist also für Männer sexuell attraktiver als der Durch- schnittsmann für Frauen. Jedes Individuum wird nun versuchen, einen möglichst „hochwertigen“ Partner zu bekommen. Da es viele begehrenswerte Frauen aber nur wenige in selben Maße begehrenswerte Männer gibt, werden diese wenigen Männer schnell vom Markt genommen sein. Nach der Heiratsmarktheorie verpaa- ren sich bezüglich des mate-value nur gleichwertige Individuen. Es tritt also der Fall ein, dass der typische Mann der typischen Frau zusätzliches Investment ent- gegen bringen muss, um ihren höheren Kosten auszugleichen14. Ansonsten würde ihr geringerer Nutzen - durch ihre höhere Attraktivität - nicht ausgeglichen wer- den15. Dem vielleicht berechtigten Einwand, finanzielle Unterstützung macht den Mann nicht sexier kann entgegen gehalten werden, dass Investment in Form von „emotionaler Zuwendung“ allerdings sehr wohl diesen Effekt haben kann. Faktoren wie „Spaß“ oder Liebe werden in diesem rein ökonomischen Modell nicht mit be- rücksichtigt, was die Aussagekraft aber nicht schmält. Und in der Tat scheint es so, dass Männer Vorleistungen erbringen um die Differenz des Partnermarktwer- tes auszugleichen. Taylor und Glenn (1976) belegten, dass attraktive Frauen Männer mit hohem Status heiraten. Ein Hinweis darauf, dass Frauen Sex für In-vestment eintauschen und Männer Investment für Sex. Frauen beurteilen die Att- raktivität eines Mannes in Abhängigkeit von dessen Status (Townsend und Levy, 1993).
3 Konsequenzen der geschlechtsspezifischen mating-Strategien
3.1 sexuelle Eifersucht
Hat sich ein Mann zum Folgeinvestment entschlossen, steht er vor folgendem Problem: Sobald er nämlich tatsächlich investiert, muss er sicher sein, dass das Kind auch sein eigenes ist16. Fatal wäre Zeit und Energie in den Nachwuchs eines anderen zu stecken und gleichzeitig auf die Möglichkeit verzichten seine Gene bei einer anderen Frau in die nächste Generation zu bringen. Es wird deswegen eine Selektion angesetzt haben, die Vaterschaftswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Dies könnte der evolutionäre Ansatzpunkt für die Notwendigkeit der sexuellen Eifer- sucht der Männer sein. Die Männer wären also gut beraten, Bewachungsverhalten zu zeigen. In den ersten Tagen der Kennenlernens sollten Männer eine Kopulation vermeiden, da die Frau bereits von einem anderen schwanger sein könnte. Auch von promisken Frauen wäre Männern abzuraten (Hinde, 1984). Es ist also für Männer biologisch sinnvoll, die Frau davon abzuhalten, sich von einem anderen befruchten zu lassen. Tut er das nicht, verliert er das Investment, das er bisher getätigt hat (Daly et al, 1982). Es lässt sich also die Hypothese aufstellen, dass die männliche sexuelle Eifersucht direkt an weibliche Untreue gebunden ist.
Demgegenüber steht das Bedürfnis der Frau, nicht verlassen zu werden und einen Partner zu haben, der bei der Aufzucht der Kinder mitinvestiert. Es wer- den sich also Anpassungen bei Frauen ausgebildet haben, die Vaterschaft sozu- sagen im Gegenzug zu verschleiern oder den Mann so zu manipulieren, dass der in jedem Fall hilft (Grammer, 2000). Die negativen Folgen der Untreue des Man- nes ist für die Frau zwar weniger gravierend, aber dennoch vorhanden. Ohne Tak-tiken zu entwickeln zur Beobachtung und Kontrolle und um den Mann an sich zu binden, verlöre sie unter Umständen den Zugang zu seinen Ressourcen wie Geld, Status und Schutz vor anderen Männern.
Hadjiyannakis (1979) stellte fest, dass fast alle mediterranen Völker von Ägyptern über Syrer, Römer, Hebräer, Spartanern den Ehebruch über den Verheiratungsstatus der Frau bestimmten. Der Gedanke hierbei ist, dass bei einer verheirateten Frau der Mann immer zum Hahnrei gemacht wird, unabhängig ab der Nebenbuhler selber verheirat ist oder nicht. Bullough (1976) kommt für exotischere Völker zum selben Ergebnis.
3.2 sperm competition
Essock-Vitale und McGuire (1985) stellt bei verheirateten kalifornischen Frauen aller Schichten einen Prozentsatz an außerehelichen Affären von 23 Prozent fest. Athanasiou und Sarkin (1964) schätzen, das 40 Prozent der Männer und 30 Prozent der Frauen fremdgehen.
Der Vorteil von Extrapaarkopulationen für Männer scheint leicht einsehbar. Sie können so ihren Fortpflanzungserfolg drastisch erhöhen (Trivers, 1972). Für Frauen ist der Vorteil in sogenannten Doppelpaarkopulationen zu suchen. Dabei kommt es zu einem Geschlechtsakt mit einem zweiten Mann, während sie noch den Samen des ersten Mannes in sich trägt. Das fruchtbare Leben eines Spermi- ums ist noch nicht genau bekannt. Mann kann jedoch davon ausgehen, dass es mindestens fünf Tage überleben kann (Barret und Marshall (1969)). Diese Zeit kann sogar länger dauern - bis zu vierzehn Tage (Smith, 1984). Die Spermien treten nun in Wettbewerb um die Befruchtung der Eizelle. Die durchsetzungsfähi- geren Spermien werden Erfolg haben und falls diese Eigenschaft genetisch de- terminiert und damit vererbbar, werden ihre Nachkommen einen höheren repro- duktiven Erfolg haben (Fischer, 1930). Einen Indiz für die Tragweite dieser These liefern Barret und Marshall (1969): Bei Untersuchungen des weiblichen Zyklus und der Häufigkeit von Extrapaarkopulationen stellten sie fest, dass sich der Höhe-punkt der Extrapaarkopulationen mit dem Höhepunkt der Empfängniswahrschein-lichkeit deckt. „Fremdgegangen“ wird nur an fruchtbaren Tagen :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5 Empfängniswahrscheinlichkeit und weiblicher Zyklus (nach Barret und Marshall (1969))
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6 Fremdgehen und weiblicher Zyklus (nach Bellis und Baker (1991))
Exakt zum Zeitpunkt der höchsten Empfängniswahrscheinlichkeit (Abbildung 5) gehen Frauen am häufigsten fremd (Abbildung 6). Dies gilt für einfaches Fremdgehen (Extrappar-kopulationen), aber auch für Doppelverpaarungen, d. h. Geschlechtsverkehr mit einem Fremden und dem Partner in kurzem Abstand.
Wenn man sich die Hintergründe überlegt, könnte man von der Prämisse ausgehen, dass Frauen oft von Männern unterdrückt und in Ehen gezwungen worden sind. Die Frau konnte sich so anderweitig die „guten Gene“ holen, ohne dabei die Ressourcen ihres Mannes einzubüßen. Der Ehemann muss oft nicht der reproduktiv günstigste Partner sein.
3.3 stille Ovulation
„Im Gegensatz zu den meisten anderen Primaten ist beim Menschen die Emp- fängnisbereitschaft der Frau nicht durch äußere Zeichen erkennbar.“, so Grammer (2000). Alexander und Noonan (1979) stellten die wohl bekannteste Hypothese in diesem Zusammenhang auf. Der verborgene Östrus war insofern ein Selektions- vorteil, weil er Frauen halft, Männer in eine Beziehung zu locken. Männer, die nicht wissen, wann der Eisprung und damit die fruchtbaren Tage der Frau sind, müssen die ganze Zeit bei der Frau bleiben um sie zu bewachen und so ihre Va- terschaft zu sichern. Die Überlegungen von Symons (1970) gehen in die gleiche Richtung. In einer archaischen, promiskuitiven Gesellschaft könnten die Männer den Frauen Jagdbeute für Sex angeboten haben. Für Frauen war es damit von Vorteil, den Zeitraum ihrer potenziellen sexuellen Attraktivität zu verlängern.
Von einer gegensätzlichen Perspektive gehen Benshoof und Thornhill (1979) aus. Durch den verborgenen Östrus, so die Autoren, gewinne die Frau die Möglichkeit ihren Mann einfacher zu betrügen17. Frauen, die keine Ovulation anzeigen, nehmen ihren Männern die Möglichkeit ihren Zyklus zu kontrollieren. Die Frau wird in die Lage gesetzt, sich das bessere genetische Material zu suchen und dennoch nicht die Unterstützung von ihrem Mann zu verlieren.
4 Kritikansätze und Schlussbemerkung
Bestimmte biologische Grundlagen des Paarverhaltens sind nicht von der Hand zu weisen. Jedoch darf nicht unerwähnt bleiben, dass auch soziologische und indivi- dualpsychologische Faktoren eine Rolle spielen. Das gesellschaftliche Verheira- tungssystem spielt eine Rolle, ebenso wie die Erreichbarkeit von Partnern. Zwar kann nicht bewiesen werden, dass sich ein Entscheidung des freien Willens ent- gegen mögliche evolutionäre Adaptionen gänzlich durchsetzen kann, doch kann sich dennoch eine moderne Frau heute bewusst dafür entscheiden, nicht vom Sta- tus eines Mannes abhängig zu sein.
Darüber hinaus mag es auch noch andere, vielleicht wichtiger Beweggründe für einen Mann geben, mit einer Frau zusammenleben zu wollen, als seine „Fortpflanzungsbilanz ums eins zu erhöhen“.
Evolutionäre Theorien, die sicherlich nicht eines hohen Wahrheitsgehaltes entbehren, unterliegen demselben Manko wie andere Theorien auch: Sie be- schreiben ein möglichen Grund für eine bestimmte Verhaltensweise. Es mag an- dere Gründe darüber hinaus geben. Gerade ob der Eindringlichkeit des evolutio- nären Theoriennetzwerkes darf man nicht in einen biologischen Determinismus verfallen, der jedes Verhalten als evolutionsbiologische Notwendigkeit propa- giert18.
5 Literaturverzeichnis
Adams, J.S. (1965). Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (Hrsg.), Advances in Experimental Social Psychology (S. 267-299). New York: Academic Press.
Alexander, R.D. & Noonan, K.M. (1979). Concealment of ovulation, parental care, and human social evolution. In N.A. Chagnon, & W.G. Irons (Hrsg.), Evolutionary biology and human social organization (S.436-453). North Scituate. Duxbury.
Amelang, M., Ahrens, H.-J. & Bierhoff, H. W. (Hrsg.). (1995). Attraktion und Liebe. Göttingen: Hogregfe.
Anderson, S.M. & Bem, S.L. (1981). Sex typing and androgyny in dyadic interaction: Individual differences in responsiveness to physical attractiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 41, S. 74-86.
Athanasou, R & Sarkin, R. (1974). Premarital sexual behaviour and postmarital adjustment. Archieves of Sexual Behaviour, 3, S. 207-225.
Barkow, J.H. (1992). Beneath new culture is old psychology: Gossip and social stratification. In J. Barkow, L. Cosmides & J. Tooby (Hrsg.), The adapted Mind. Evolutionary psychology and the genration of culture (S. 25-637). New York: New Oxford Press.
Barret, J.C. & Marshall, J. (1969). The risk of conception on different days of the menstrual cycle. Population Studies, 23, S.455-461.
Bateman, A.J. (1948). Inter-sexual selection in drosophilia. Heredity, 2, S.349-368
Bellis, M.A. & Baker, R.R (1991). Do females promote sperm competition? Data for humans. Animal Behaviour, 40, S. 997-999.
Benshoof, L. & Thornhill, R. (1979). The evolution of monogamy and concealed ovulation in humans. Journal of Social and Biological Structures, 2, S. 95-106.
Berscheid, E. et al (1971). Physical attractiveness and dating choice: A test of the matching hypothesis. Journal of Experimental Social Psychology, 7, S. 173-189.
Bischof, N. (1980). Biologie als Schicksal? In N. Bischof & H. Preuschoft (Hrsg.), Geschlechtsunterschiede: Entstehung und Entwicklung (S. 25-42). München: C.H. Beck Verlag.
Blech, J. (2000). Dämonen der Begierde. Der Spiegel, (16), S.254-265.
Bullough, V.L. (1976). Sexual variance in society and history. New York: Wiley.
Chisholm, J.S. (1976). On the Evolution of rules. In M.R.A. Chance. & R. R:
Larsen (Hrsg.), The social structure of attention (S. 325-352), New York: Wiley.
Crook, J.H. (1972): Sexual selection, dimorphism, and social organization in the primates. In B. Campbell (Hrsg.), Sexual selection and the descent of man. London: Heinemann.
Daly, M. & Wilson, M. (1982). Whom are newborn babies said to resemble? Ethology and Sociobiology, 3, S.69-78.
Darwin, C. (1871). The descent of man and selection in relation to sex. London: John Murray.
Doncaster, C.P., Pound, G.E. & Cox, S.J. (2000). The ecological cost of sex. Nature, 404, (Mar 16), S.281-5.
Essock-Vitale, S.M. & McGuire, M.T. (1985). Women’s lives viewed from an evolutionary perspective. . Ethology and Sociobiology, 6, S.137-154.
Fisher, R.A. (1930). The genetical theory of natural selection. London: Oxford University Press.
Gavrilets, S. (2000). Rapid evolution of reproductive barriers driven by sexual conflict. Nature, 403, (Feb 24), S.886-9.
Grammer, K. & Atzwanger, K. (1993). Wie du mir, so ich dir: Freundschaften, Verhaltensstrategien und soziale Reziprozität. In U. Krebs & W. Adieck (Hrsg.), Evolution, Erziehung, Schule (S.171-194). Erlangen: Univesitätsbund.
Grammer, K. (2000). Signale der Liebe - Die biologischen Gesetze der Partnerschaft. München: dtv.
Hadjiyannakis, C.(1969). Les tendances temporaines concernant la répression du délit adultère. Thessaloniki : Ass. Internationale de Droit Pénal.
Hamilton, W.D. (1964). The Genetical Evolution of Social Behaviour. Journal of Theoretical Biology, 7, S. 1-52.
Hassebrauck, M. (1990). Über den Zusammenhang der Ähnlichkeit von Attitüden, Interessen und Persönlichkeitsmerkmalen und der Qualität heterosexueller Paarbeziehungen. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 21, S. 265-273.
Hassebrauck, M. & Niketta, R. (Hrsg.). (1993). Physische Attraktivität. Göttingen: Hogrefe.
Hejj, A. (1996). Traumpartner - Evolutionspsychologische Aspekte der Partnerwahl. Berlin: Springer.
Hejj, A. (1997). Jung, ledig, sucht? Die Welt der Singles. Zeitschrift für Familienforschung,. 9,(2), S.26-47.
Hinde, R.A. (1984). Why do the sexes behave differently in close relationships? Journal of Social and Personal Relationship, 1, S. 471-501.
Hirschberg, N. et al (1978). What’s in a face: Individual differences in face perception. Journal of Research in Personality, 12, S.588-599.
Jäckel, U. (1980). Partnerwahl und Eheerfolg. Stuttgart: Enke.
Jensen, A.R. (1978). Genetic and behavioural effects of non-random mating. In
R.T. Osborne, C.E. Noble & N.J. Wey (Hrsg.), Human variations. Biopsychology of age, race and sex (S. 51-105). New York: Academic Press.
Lumsden, C.J. & Wilson, C.O. (1981); Genes, mind and culture: the coevolutionary process. Cambridge: Harvard University Press.
Mikula, G. & Stroebe, W. (Hrsg.). 1977). Sympathie, Freundschaft und Ehe. Bern: Verlag Hans Huber.
Lack, D. (1940). Pair formation in birds. Condor, 42, S.269-286.
Lancaster, J. & Hamburg, B. (1986). School-age pregnancy and parenthood. New York: Aldine de Gruyter.
Lightcap, J.L. et al (1982).Child abuse : A test of some predictions from evolutionary theory. Ethology and Sociobiology, 3, S.61-67.
Olbrich, E. (1987). Frühes Erwachsenenalter: Entwicklung im Familienzyklus. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (S.339-360). MünchenWeinheim: Psychologie Verlags Union.
Orians, G. (1969). On the evolution of mating systems in birds and mammals. American Naturalist, 103, S.589-603.
Parker, G.A. et al (1972). The origin of evolution of gamete dimorphism and the male-female phenomenon. Journal of Theoretical Biology, 36, S.529-553.
Phelps, C.D. (1988). Caring and family income. Journal of Economic Behaviour and Organization, 10, S.83-98.
Reimers, T. (1994). Die Natur des Geschlechterverhältnisses. Frankfurt/ Main: Campus Forschung.
Rushton, J.P. (1987). Genetic similarity, mate choice, and fecundity in humans. Ethology and Sociobiology, 9, S.329-333.
Sadalla, E.K. et al (1987). Dominance and heterosexual attraction. Journal of Personality and Social Psychology,52, S. 730-738.
Safilios-Rothschild, C. (1977). Love, Sex and sex roles. Englewood-Cliffs: Prentice-Hall.
Schull, W.J. & Neel, J.V. (1965). The effect of inbreeding on Japanese Children. New York: Harper and Row.
Sigall, H. & Landy, D. (1973). Radiating beauty: effects on having a physical attractive partner on person perception. Journal of Personality and Social Psychology, 28, S. 218-224.
Smith, R.L. (1984). Human sperm competion. In R.L. Smith (Hrsg.). Sperm competion and the evolution of animal mating systems. London: Academic Press.
Symons, D. (1979). The evolution of human sexuality. Oxford: Oxford University Press.
Trivers, R.L. (1972): Parental investment and sexual selection. In B. Campbell (Hrsg.), Sexual selection and the descent of man 1871-1971 (S.136-179). Chicago: Aldine.
Taylor, P.A. & Glenn, N.D. (1976). The utility of education and attractiveness for females’ status attainment through marriage. American Sociological Review, 41, S.484-498.
Townsend, J.M. & Levy, G.D. (1990). Effects of potential partner’s physical attractiveness and socioeconomic status on sexuality and partner selection. Archives of Sexual Behaviour, 19, S.149-164.
Trivers, R.L. (1985). Social evolution. Menlo Park: Benjamin Cummings.
Wickler, W. & Seibt. U. (1977). Das Prinzip Eigennutz. Hamburg: Hoffmann und Campe.
William, G.C. (1975). Sex and evolution. In R.M. May (Hrsg.), Monographs in population biology (S.200ff). Princeton: Princeton University Press.
Wilson, W.J. (1987). The truly disadvantaged. Chicago: Chicago University Press.
Winikoff, B. (1983). The effect of birth spacing on child and maternal health. Studies in Family Planning, 14, S.231-245.
Wrangham, R.W. (1986). Ecology and social relationship in two species of chimpanzee.
In D.J. Rubenstein & R.W. Wrangham (Hrsg.), Ecological aspects of social evolution (S. 352-378). Princeton: Princeton University Press.
Zahavi, A. (1975). Mate selection- A selection for a handicap. Journal of Theoretical Biology, 53, S.205-214.
[...]
1 Beispielsweise gibt es bestimmte Insektenarten, die sich auf normalerweise weißen Birken aufhalten und da sie dieselbe Farbe wie ihr Untergrund aufweisen, perfekt getarnt sind. Da sich nun durch Industrieruß in bestimmten Gebieten viele Birken grau-schwarz verfärbt haben, haben sich diese Tiere entsprechend angepasst: Ehemals weiß wie die Birkenrinde, sind sie nunmehr ebenfalls rußig grau und wiederum adäquat getarnt! Neuangepasstheit an sich ändernde Umweltanforderungen innerhalb kürzester Zeit!
2 Der genetische Reproduktionserfolg, d. h. die Anzahl genetisch möglichst gleicher Nachkommen ist der Maßstab für die „Fitness“ eines Individuums. Die Fitness resultiert aus der genetischen Veranlagung eines Individuums, deren phänotypsicher Realisierung, den physischen Umweltbedingungen und der sozialen Konkurrenz (Reimers, 1994).
3 Die Sichelzellenanämie, beispielsweise, welche die Leistungsfähigkeit des Organismus aufgrund eines Defekt des Stoffwechsels, der mit Sauerstofftransport in Zusammenhang steht, verändert, gewährt jedoch zugleich den Vorteil der Malariaresistenz.
4 Beim Menschen mit 46 Chromosomen sind dies 223 Kombinationsmöglichkeiten.
5 vgl. Absatz 2.3.2
6 vgl. Absatz 3.1
7 Der Frage, inwiefern diese neuen Lebensumstände diese Adaptionen überflüssig machen, geht Barkow (1992) nach.
8 Die Entscheidung „Qualität statt Quantität“.
9 Aus der Studie von Anderson und Bem (1981) ging hervor, dass von physischer Attraktivität auch auf soziale Attribute wie verständnisvoll, sexuell attraktiv, interessant, humorvoll, sexuell permissiv, hohe Bereitschaft zum Ausgehen, humorvoll, warm und sozial angepasst geschlossen. Es ist wohl nicht vorschnell zu behaupten, dass es attraktive Menschen leichter im Leben haben und dass man ihnen positiver entgegentritt.
10 Die männliche Wahl nach Attraktivität hat sogar eine Entsprechung in der Wahrnehmung und Beurteilung durch Männer. Sigall und Landy (1973) zeigten, dass Männer gar nach der „Schönheit“ ihrer weiblichen Begleitung beurteilt wurden. In „ansehnlicher“ Begleitung wird ein Mann als erfolg- reich und positiv bewertet. Jedoch wird er als berufliche Versager angesehen, wenn seine weibli- che Begleitung bestimmten Ansprüchen an die äußere Erscheinung nicht gerecht werden kann.
11 Durch das Statuswahlprinzip der Frauen entsteht Wettbewerb unter den Frauen um das Statusgefälle der Männer. Die dadurch notwendig gewordenen Alternativstrategien erklärt ansatzweise Orians (1969) mit seinem sogenannten Polygynie-Schwellenmodell.
12 Die Heiratsmarkttheorie weißt Theorien zur Equity-Theorie (Adams, 1965) auf. Nach diesen ba- lancetheoretischen Ansätze verrechnet jeder Interaktionspartner in jeder sozialen (Austausch- )Situation den Quotienten aus seinem Investment (Kosten) zu seinem Income (Nutzen). mit dem seines Kommunikationspartners:[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]Sind die Quotienten jedoch nicht gleich groß, wird Inequity empfunden - eine unangenehme Spannung im affektiven Subsystem. Das Individuum strebt danach, diese Spannung zu reduzieren. Eine plausible Strategie bei Benachteiligung wäre, den Austauschpartner dazu zu bringen, mehr Investment in die Austauschbeziehung einzubringen - adäquater Weise Aufwand in Form von mate-value.
13 Das Sprichwort „Gegensätze ziehen sich an“ veranschaulicht die Gegenthese - Heterogamie. Dies konnte meines Wissens nicht empirisch belegt werden, obwohl beispielsweise der Psychoanalytiker Erikson (1977) sie als Erklärungsmodell anführt.
14 Eine andere Möglichkeit bestünde darin, Gewalt anzuwenden. Eine interessante Hypothese, die es empirisch zu belegen gilt, nimmt an, dass Männer von geringem sozialen Status, die nur wenig Möglichkeiten zu Investment (im materieller Form) haben, eher zu Vergewaltigung oder Gewaltanwendung und Zwang greifen als Männer höherem Status.
15 Die Parallelen zur balancetheoretischen Ansätze der Equity-Theorie werden hier wieder deut- lich.
16 Ein Sprichwort sagt: Mama’s baby - papa’s maybe.
17 Vgl. hierzu auch 3.2: sperm competition
Häufig gestellte Fragen
Was sind die evolutionstheoretischen Grundlagen von Paarverhalten?
Der Text behandelt die evolutionstheoretischen Grundlagen von Paarverhalten, beginnend mit der Bedeutung der genetischen Variabilität. Er erklärt Begriffe wie Variation, Kampf ums Dasein, Mutation, sexuelle Rekombination, genetische Vielfalt, sexuelle Selektion und intrasexuelle Konkurrenz. Außerdem wird der Bezug zur Postmoderne und die veränderte Umwelt des Menschen diskutiert.
Was sind die Kosten- und Nutzenaspekte in Bezug auf "mate value"?
Der Text erläutert die Asymmetrie des Investments zwischen Männchen und Weibchen in die Fortpflanzung. Es werden Maximierungs- und Optimierungstendenzen wie Alter, Status, Handicaptheorie, Heiratsmarkttheorie, assortative mating, inklusive Fitness und das Sexökonomiemodell behandelt.
Welche Konsequenzen ergeben sich aus geschlechtsspezifischen mating-Strategien?
Der Text diskutiert die Konsequenzen geschlechtsspezifischer Strategien, insbesondere sexuelle Eifersucht (männliche und weibliche), sperm competition und stille Ovulation beim Menschen.
Welche Kritikansätze gibt es und was ist die Schlussbemerkung?
Der Text thematisiert Kritik an rein biologischen Erklärungsmodellen für Paarverhalten und betont die Bedeutung soziologischer und individualpsychologischer Faktoren. Es wird vor einem biologischen Determinismus gewarnt.
Welche Themen werden behandelt?
Der Text behandelt die Themen: Evolutionstheoretische Grundlagen von Paarverhalten, Kosten- und Nutzenaspekte zum mate value, Konsequenzen der geschlechtsspezifischen mating-Strategien und Kritikansätze sowie Schlussbemerkungen.
Was bedeutet "assortative mating"?
Assortative mating bezieht sich auf die Tendenz, dass sich Partner aufgrund von Ähnlichkeiten in verschiedenen Merkmalen (z.B. Aussehen, psychische und soziale Attribute) zusammenfinden. Der Text diskutiert die genetischen Konsequenzen und die Grenzen dieser Tendenz.
Was ist die Sexy-Söhne-Hypothese?
Die Sexy-Söhne-Hypothese besagt, dass Frauen durch die Wahl bestimmter männlicher Attribute die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ihre Söhne ebenfalls attraktiv und erfolgreich bei der Partnerwahl sein werden. Dies führt zu einer kontinuierlichen Verschiebung der Präferenzen und Attribute in der männlichen Population.
Was ist die inklusive Fitness?
Die inklusive Fitness ist ein Konzept, das besagt, dass der Erfolg eines Gens nicht nur von seinem Effekt auf den Träger abhängt, sondern auch von seinem Effekt auf verwandte Individuen. Dies wird als Grundlage für altruistisches Verhalten und die Präferenz für Partner mit ähnlichen Genen diskutiert.
- Quote paper
- Sebastian Sauer (Author), 2001, Die Ökonomie der Partnerschaft unter evolutionspsychologischen Aspekten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103820